Zweites Kapitel
Den angeführten Beispielen von offenem Raub der Braut, Entführung, Abpressung oder Besiegung des Vaters, Gatten oder Verlobten liegt ein und derselbe Gedanke zu Grunde: Wer durch Tapferkeit, Klugheit oder Macht imstande ist, ein Mädchen zu erringen, dem gehört es, wie jede andere Kriegsbeute, von Rechtswegen zu. Dass diese Auffassung an den uralten Begriff vom Brautraube nicht bloß erinnert, sondern durchaus der gleichen Anschauung entsprungen ist, dürfte kaum zu bezweifeln sein.
Halten wir nun daran fest, dass der Begriff der Tapferkeit die Ursache zu der Entstehung des Brautraubes war, so führt uns derselbe. Begriff zugleich auf ein an sich gänzlich entgegengesetztes Gebiet, dessen Kernpunkt aber gleichfalls der Begriff der Tapferkeit bildet, auf das Erdienen der Braut Dieser im Mittelalter so weit verbreitete Gebrauch ist, genau genommen, eigentlich nichts anderes als ein Brautkauf, bei welchem der Preis nur nicht in Geld oder Gut, sondern eben durch die Dienste des Käufers abgezahlt wurde. Bevor wir indes auf die näheren Umstände eingehen, unter welchen dieser Brautdienst, der in jener Zeit meist ritterlicher Art war, statt hatte, wollen wir die Frage erörtern: Finden sich in altfranzösischen Epen Beispiele von eigentlichem Brautkauf, d. h. dem Abschluss von Ehen in der Weise, dass der Freier die Braut von ihrem Vater oder nächsten Anverwandten durch Geld oder Geschenke erkauft? Von diesem Gebrauch sind nur schwache Andeutungen vorhanden. Im Cléomades findet sich folgender Zug: Drei afrikanische Könige werben um die drei Schwestern des Cléomades, indem jeder ein kostbares Brautgeschenk herbeibringt, darunter auch jenes oben erwähnte wunderbare Pferd, mit dessen Hülfe Cléomades sich nachher der von ihm geliebten Prinzessin bemächtigt. — An einer Stelle des Aubéri le Bourgoing hält der Räuber Lambert d'Oridon um die Hand der Seneheut, Aubéris Stieftochter, an, indem er sich für einen mächtigen Grafen ausgibt und unermessliche Schätze als Brautgeschenke bietet. — Als Gegenstück hierzu ist eine Stelle der schon erwähnten Chanson de Geste „Aye d'Avignon“ von Interesse. Bérenger, der Sohn des Verräters Ganelon, landet mit seiner Gattin Aye, die er seinerseits ihrem rechtmäßigen Gatten entführt hat, an der Küste der Balearen. Der sarazenische König dieser Inseln, Ganor, hält Aye für eine Verwandte („cosine ou parente“) Bérengers und ersucht ihn, sie ihm zu verkaufen. Dieser aber weigert sich mit den Worten, es sei in Frankreich nicht Mode, dass man seine Frauen verkaufe. Es spricht sich hierin eine deutliche Abneigung gegen die bei den Muselmännern übliche Sitte des Brautkaufes aus. Dass diese Abneigung bestanden haben muss bestätigt sich auch durch die außerordentliche Spärlichkeit der Überreste, welche sich vom Brautkauf in der französischen Dichtung des Mittelalters finden, und dass eine auf so wenig ritterlichen Anschauungen beruhende Einrichtung wie der Brautkauf in jener Blütezeit höfischen Wesens nicht zu Ansehen kommen konnte, ist leicht begreiflich.
In einer Zeit, wo ritterliche Taten in so hohem Ansehen standen, war es natürlich, dass bei der Brautwerbung niemand würdiger erschien als wer durch Kühnheit und Tapferkeit hervorragte. Wer also, ohne zum Brautraub oder zur List seine Zuflucht nehmen zu wollen, um die Hand eines Mädchens warb, musste sich zunächst durch irgendwelche ritterlichen Dienste ihrer würdig erweisen.*) So bildete sich der Gebrauch heraus, dass der Ritter hei seiner Dame in ein förmliches Dienstverhältnis trat, welches oft auch äußerlich durch ein dem Ritter von seiner Herrin verliehenes Abzeichen angedeutet wurde. In vielen Fällen stellte diese selber Aufgaben, deren einfachste Form das an den Ritter gerichtete Verlangen der Tapferkeit war. So fordert in dem schon genannten Epos Bueves de Commarchis die Prinzessin Malatrie von ihrem Vorlobten, er solle durch eine ritterliche Tat beweisen, dass er des verheißenen Lohnes würdig sei. Als dann jener in einem unter den Augen seiner Braut stattfindenden Zweikampfe besiegt wird, hat dieser Umschwung seines Kriegsglückes zugleich den Verlust seiner Geliebten zur Folge. **)
*) Manchmal war die Forderung ritterlicher Dienste in einer Klausel verborgen. So bekommt in dem — aus dem Englischen entlehnten (vgl. Körting, Grundriss der Gesch. der engl. Litt. § 88) — Lai de Havelock, H., ein Küchenjunge, die Hand einer Königstochter, infolge einer Bestimmung, welche deren Vater sterbend getroffen hatte, man solle seine Tochter dereinst dem Stärksten im Lande vermählen; und als dieser war H. bekannt.
**) Ähnlich im Méraugis de Portlesguez von Raoul de Houdene, public .... par H. Michelant, Paris 1869, S- 45, Vers 49 f., wo Lidoine von dem ihr durch einen unter Vorsitz der Königin gefällten Urteilsspruch zugesprochenen M. verlangt, er solle zuvor ein Jahr lang seine kriegerische Tüchtigkeit erweisen.
Zuverlässiger erweist sich Guy of Warwiek, der die noch weit anspruchsvolleren Forderungen einer englischen Prinzessin getreulich vollführt. Mehrmals kehrt er nach Vollbringung der unglaublichsten Heldentaten zu seiner Angebeteten zurück, immer hoffend, das ihm gesteckte Ziel des größten Helden der Christenheit erreicht zu haben. Nach langen Jahren und nach Bestehung der härtesten Proben findet er endlich Erhörung. Im direkten Gegensatz zu diesen, den unverkennbaren Stempel ihrer Zeit tragenden Dichtungen steht ein auf germanischer Grundlage beruhendes Gedicht, Horn, welches eine ganz andere Auffassung der Liebe zeigt. Hier ist es nicht der Mann, sondern das Mädchen, welches das erste Liebesgeständnis macht. Die Königstochter Rimel liebt den jungen Horn, der, obwohl Königssohn, dennoch nicht als solcher, sondern als einfacher Knappe an ihres Vaters Hofe lebt, da er in jungen Jahren sein Vaterland hat verlassen müssen. Rimel entbietet Horn zu sich und gesteht ihm ihre Liebe. Er aber erwidert, er sei ihrer noch nicht würdig; wenn er dereinst den Ruf eines tapferen Ritters erlangt habe, dann sei er bereit, mit Genehmigung ihres Vaters, des Königs, ihre Wünsche zu erfüllen. Trotz der sich hier aussprechenden Verschiedenheit der altgermanischen Anschauung von der romanischen, die übrigens in dem altenglischen Gedichte King Horn *) noch deutlicher hervortritt zeigt sich dennoch die Auffassung des Brautdienstes nicht minder klar: Die Liebe der Jungfrau war ein Lohn, der erst durch ritterliche Taten erworben werden musste. Ob diese nun von der Jungfrau selber gefordert werden, oder ob der Ritter der Vernünftige ist und die Liebe des Mädchens erst annehmen will, wenn er ihr einen berühmten Namen zu bieten vermag, bleibt sich für diese Auffassung völlig gleich. Umgekehrt wurde Feigheit des Gatten oder Verlobten als genügender Grund für die Frau angesehen, ihn zu verlassen. So geht es Lanzelet, als er mit seiner Gattin in eine verzauberte Stadt kommt. Jeder Ritter, der sie betrat, wurde in der Art umgewandelt, dass er umso schwächlicher und feiger wurde, je tapferer und kühner er vorher gewesen war. Lanzelet wird von sämtlichen Rittern, die der Herrscher der Stadt dort gefangen hält und nach Belieben beleidigt oder töten lässt, alsbald der jämmerlichste und duldet die gröbsten Schmähungen. Die arme Frau, die sich die Umwandlung ihres Gatten nicht zu erklären weiß, entschließt sich zuletzt schweren Herzens, ihn zu verlassen. Dem Charakter der Ritterromane gemäß, die doch vorzugsweise auf eine Verherrlichung des Ritterstandes hinausliefen, wenigstens wenn man von den Karikaturen der späteren Zeit absieht, sind Beispiele, wie das letzte, natürlich selten.
*) Inh. des französischen Roman de Horn, bist litt., Bd. 22, S. 559 f.
Der englische King Horn, herausgegeben von Dr. Horstmann, Horrigs Archiv, Bd. 50, 1872, S. 39 ff., Vors 250-598.
Auf die Eigentümlichkeit der germanischen Auffassung im Horn hat zuerst Ten Brink aufmerksam gemacht, vgl. Wissmann, Studium zu King Horn, Anglia 4, S. 372 ff.
Umso häufiger findet sich, und zwar namentlich in Romanen bretonischen Ursprungs, die Erscheinung, dass die Geliebte von ihrem Ritter nicht, wie im Bueves de Commarchis, allgemeine Betätigung der Tapferkeit verlangte, sondern dass sie ihm Einzelaufgaben stellte, die oft von der seltsamsten und abenteuerlichsten Art sind. Der Wunsch, welchen im Torec *) die schöne Mirande ausspricht, ihr Verehrer Torec möchte sämtliche Ritter von Artus' Tafelrunde aus dem Sattel heben, was er denn auch glücklich vollbringt, erscheint noch bescheiden im Vergleich zu den ungeheuerlichen Gefahren, welche die Launenhaftigkeit anderer Schönen ihren ebenso todesmutigen als geduldigen Anbetern auferlegt. Im Lai de Doon **) hat Doon sich durch Vollbringung eines Probestücks, eines Dauerrittes von Southampton bis Edinburgh in einem Tage, ein Anrecht auf die Hand einer Königstochter erworben. Diese aber, mit der ersten Leistung nicht zufrieden, verlangt noch obendrein, Doon solle es zu Pferde mit einem im Fluge begriffenen Schwan aufnehmen. Als er auch dies glücklich vollführt, wird das ihm gegebene Versprechen endlich eingelöst. Ein nicht minder anspruchsvolles Ansinnen wird im Conto du Graal ***) an Perceval von einer Jungfrau gestellt, in deren Dienst er sich begibt.
*) Torec, Teil des niederländischen Roman van Lancelot, herausgegeben von Dr. W. J. A. Jonckbloet, 'Sgravenhage 1849, III. Buch, Vers 23769-23775 und Vers 26133-26891.
**) Lai de Doon s. Romania Bd.8, S.591T., Vers 136-162.
***) Die Sage vom Gral, ihre Entwicklung und dichterische Ausbildung in Frankreich und Deutschland im 12. und 13. Jahrhundert von Ad. Birch-Hirschfeld, Leipzig 1877, S. 96-98. (Der Inhalt wird nach Potvins Ausgabe angegeben, und das hier interessierende Stück umfasst dort etwa Vers 22400- 30500.)
Sie fordert, er solle ihr den Kopf eines weißen Hirsches bringen, der sich in dem angrenzenden Schlossparke befände. Dieses scheinbar leichte Unternehmen wird dadurch zu einem äußerst schwierigen, dass sich damit eine Reihe gefährlicher Abenteuer verknüpft; wie zu erwarten ist, besteht Perceval sie alle und erhält dann den zugesagten Lohn. — In „Le Bel Inconnu“ hat eine Dame, die „fée de l'ile d'or“ die sonderbare Bestimmung getroffen, ihr Bewerber solle eine Brücke bewachen und jeden, der dieselbe überschreiten wolle, mit Waffengewalt daran hindern. Wenn er in diesen Kämpfen neun Jahre Sieger geblieben, solle er die Hand der Fee erhalten. Als Giglain dorthin kommt, tritt ihm als Wächter ein Ritter entgegen, welcher bereits sieben Jahre seines Amtes gewaltet hatte. Giglain besiegt den Ritter, und die Fee, welche an ihm besonderes Wohlgefallen findet, beschließt dieses Mal eine Ausnahme zu machen, und bietet ihm Hand und Krone auf der Stelle an, was Giglain allerdings nicht annehmen kann, da er sich schon zu einem anderen Abenteuer verpflichtet hat. Aus derartigen Beispielen, wo ein Mädchen den um ihre Liebe werbenden Mann selber den größten Gefahren aussetzt, könnte man schließen, dass die Damen jener Zeit auf diesem — damals in der Tat nicht ungewöhnlichen Wege — sich ungebetene Liebhaber hätten vom Halse schaffen wollen, ja überhaupt von außerordentlicher Sprödigkeit gegen das männliche Geschlecht gewesen seien. Dass aber ungefähr das Gegenteil der Fall ist, beweisen zahlreiche Beispiele in der altfranzösischen Dichtung; und es ist nicht daran zu zweifeln, dass diese Geschichten, mögen sie auch gerade hier oft übertreiben, dennoch sehr viel Wahres enthalten. Sicherlich dachte jene Zeit in dieser Beziehung ganz anders als die unsere. Die Liebe eines ritterlichen Helden gereichte jeder Jungfrau zur Zierde, und viele Beispiele lehren, dass es für ein Mädchen keine Schande war, wenn sie einem solchen Manne ihre Liebe schenkte. Gauvain z. B. der Hauptheld der Artusromane, gewinnt überall wohin er kommt, die Herzen der Damen im Fluge. Aber auch die Liebe eines Mädchens von vornehmem Stande zu einem Manne von niedriger Herkunft und noch nicht erprobter Tüchtigkeit wurde an sich noch nicht als unwürdig angesehen, sie wurde es erst, wenn der Mann durch Feigheit oder Schwäche sich selbst erniedrigte. Aus diesem Gesichtspunkte ist der Vorgang zu erklären, dass eine vornehme Dame sich in einen einfachen Knappen (einen „varlet“) verliebt; da aber an ihre Verbindung so noch nicht zu denken ist, lässt sie selber ihn mit guten Waffen versehen und befiehlt ihm, auf einem gerade stattfindenden Turnier sich ihrer Wert zu zeigen. Der Knappe, schon vorher auf Veranlassung seiner Geliebten zum Ritter geschlagen, verrichtet Wunder der Tapferkeit und wird vom König höchsteigenhändig mit der Hand seiner Dame belohnt.
Dieser Vorgang führt uns auf einen Gebrauch, der sich gleichfalls nicht selten findet, dass der Sieger im Turnier mit der Hand einer vornehmen Frau belohnt wird. Das Turnier, welches von Königen, Fürsten oder anderen hohen Herren ausgeschrieben wurde, war nicht nur der Sammelplatz gewaltiger Helden, sondern auch der schönsten und edelsten Frauen denen allen es natürlich als ein sehr begehrenswertes Ziel erschien, mit einem ruhmgekrönten Sieger vermählt zu werden. So war man um den Siegespreis selten verlegen. In dem Epos Le Bel Inconnu erhält Giglain, nachdem er im Turnier gesiegt, vom König Artus als Preis die Hand einer Königin. Und das Sonderbare hierbei ist, dass der Ritter von dieser königlichen Gnade sehr wenig beglückt ist. Vielmehr liegt er in den Banden einer Anderen und hat die Verbindung mit jener Königin schon einmal von sich gewiesen. Trotzdem entschließt er sich jetzt, das Anerbieten anzunehmen. Besser ergeht es dem Fergus. Dieser siegt in einem Turnier, dessen vorher angekündigter Preis darin bestand, dass der Sieger mit einer Königstochter vermählt werden und zugleich mit ihrer Person auch ihr Reich erhalten sollte. Galiene, gleichfalls eine Königin, bittet Artus, ihr den Fergus, den sie schon lange geliebt hat, zum Gemahl zu geben, um ihn auf diese Weise für seine Heldentaten zu belohnen. Wirklich ist auch Fergus von dem ehrenden Anerbieten höchlich entzückt und der Hochzeit steht nichts im Wege. Nicht immer waren die Bestimmungen des Turniers in dieser Beziehung so allgemein gehalten. Es kommt auch vor, dass Turniere vom Vater der Jungfrau mit der ausgesprochenen Absicht veranstaltet werden, das Mädchen auf ehrenvolle Weise an den Mann zu bringen. Im Escanor veranstaltet der König Canor von Northumberland ein Turnier mit der Bedingung, dass dem Sieger seine Tochter und die Herrschaft seines Landes zufallen solle. Bemerkenswert ist, dass in diesem Fall die Tochter mit der Absicht ihres Vaters nicht einverstanden ist. Sie will unvermählt bleiben und hat bisher alle Bewerbungen zurückgewiesen. Unter ähnlichen Umständen findet ein Turnier im Chevalier à la Manche statt, bei welchem die Hand der Clarette, Prinzessin von Spanien, als Preis ausgesetzt ist. Ähnlich wie im Fergus, gelingt es hier dem Geliebten der Clarette, einem ungenannten Ritter, der als Wahrzeichen seiner Liebe zu der Prinzessin einen von ihr geschenkten Ärmel im Kampfe trägt, den Sieg und die Hand seiner Dame zu erstreiten.Weniger entgegenkommend beweist sich Garlin de Montglane, indem er die Hand der ihm durch den Sieg zugefallenen Florete ausschlägt.
Die Sitte, dass als Siegeslohn eines Turniers der Besitz eines vornehmen Mädchens angeboten wurde, gewinnt ein ganz anderes Aussehen, wenn dies Turnier nicht, wie in den erwähnten Fällen, vom Vater des Mädchens oder an dessen Stelle vom Landesfürsten veranstaltet wurde, sondern wenn die Jungfrau selber das Turnier veranlasste, mit der Absicht, sich mit dem Sieger zu vermählen. Eine alleinstehende Fürstin war in jenen unruhigen Zeiten, in denen der Brautraub durchaus nichts Außergewöhnliches war, den größten Gefahren ausgesetzt, und es war daher für sie von höchst praktischer Wichtigkeit, einen tapferen, starken Gemahl zu haben der imstande war, ihr genügenden Schutz zu gewähren. Andererseits konnte das Turnier zum Notbehelf werden, um das Drängen allzu stürmischer Freier abzulenken. In dem unter solchen Gesichtspunkten veranstalteten Turnier kann man wohl ein Überbleibsel jener uralten Sitte der Gattenwahl erblicken. Im Partonopeus de Blois wird die Kaiserin Melior von Konstantinopel vom Sultan von Persien und hundert benachbarten Königen gedrängt, sich zu vermählen. Die Freier nehmen eine so drohende Haltung an, dass die Kaiserin sich entschließt, ein Turnier zu veranstalten; dem Sieger will sie Hand und Krone schenken. Partonopeus, der die Kaiserin schon lange liebt, hört davon, nimmt an dem Turnier teil und siegt. Er erhält die Hand der Kaiserin und den Thron von Konstantinopel. Weniger glücklich ergeht es im Lai du Chaitivel *) einer Dame, welche, um die Tapferkeit ihrer vier Bewerber zu erproben, ein Turnier veranstalten lässt, auf welchem drei von ihnen getötet werden, der vierte aber zum Krüppel gemacht wird.
Nicht immer war es nötig, dass der Gattenwahl ein Turnier vorausging. Eben sowohl war es auch in diesem Falle möglich, dass die umworbene Dame ihren Freiern irgendeine Aufgabe stellte, die Mut und Tapferkeit erforderte. Wer diese Aufgabe löste, den wählte die Jungfrau zu ihrem Gatten. Wir haben oben schon in anderem Zusammenhange gesehen, zu welcher Höhe sich die Ansprüche der Damen oft verstiegen, selbst dem eigenen Ritter gegenüber, der bereits durch treue Dienste sich ein Anrecht auf entgegenkommende Behandlung erworben hatte.
*) Lai du Chaitivel von Marie de France a. a. O., S. 368 ff. Vers 71-180.
Veranstaltungen eines Turniers zum Zweck der Wahl zwischen den Bewerbern finden sich ferner in La Vengeance de Raguidel, Vers 1221—1226—1438, und im Chevalier du papegaut (perroquet), hist litt., Bd. 30, S. 107.
Kein Wunder, dass diese Ansprüche nicht minder groß waren, wenn es erst galt, die Tüchtigkeit mehrerer Freier zu prüfen. Es wurde schon erwähnt, welch unglaubliche Leistungen auf dem Gebiet des Distanzrittes schon damals vollbracht wurden (vgl. S. 24), wo freilich die Reitübung nicht Selbstzweck war, sondern eine sehr ideale Grundlage hatte — die Liebe. Immerhin war dieser Gedanke selbst für einen Artusroman etwas absonderlich. Nicht selten findet es sich dagegen, dass am Hofe des Königs Artus vor versammelter Ritterschaft eine Dame erklärt, dem Ritter, der ein von ihr angegebenes Unternehmen zu glücklichem Ende führe, ihre Hand zu geben. Es geschieht dies gewöhnlich, ohne dass die betreffende Dame viel umworben ist; oft ist sie sogar gänzlich fremd und stellt sich, ohne dass ihr Erscheinen für den Zusammenhang der Dichtung erforderlich wäre, am Hofe ein. Es ist dies ein beliebtes und von den Trouvères viel gebrauchtes Mittel, um eingeflochtene Abenteuer zu motivieren, die ja gerade einen Hauptbestandteil der Romane der Table ronde bilden. Natürlich finden sich immer galante Helden, die um einer so verlockenden Aussicht willen ihr Leben in die Schanze schlagen, was sie ja doch zu tun gewohnt sind, auch wenn ihnen kein so wertvoller Preis winkt. Hierher gehört z. B. die Handlung des Lai de la Mule sans Frein. Es heißt darin: Als Artus einst mit seinem Hofe das Pfingstfest feierte, stellte sich eine Jungfrau ein, welche auf einem Maultier ohne Zaum ritt. Sie verspricht dem Ritter ihre Liebe, der ihr denselben wieder verschaffe. Der Sénéchal Keux, der fast in allen Artusromanen eine mehr oder weniger lächerliche Rolle spielt, macht sich auf den Weg, kehrt aber, nachdem sich ihm ernstliche Schwierigkeiten in den Weg gestellt, zum Hohn der ganzen Gesellschaft unverrichteter Sache zurück. Nun macht sich Gauvain an die Lösung der Aufgabe, und ihm gelingt es, nach Bestehen der größten Gefahren, den Zaum herbeizuschaffen, worauf ihm der versprochene Lohn zuteilwird. — Ein ähnliches Stück vollbringt Ider. Die Königin Guenloie verspricht ihre Hand dem Ritter, der ihr ein kostbares, von zwei Riesen bewachtes Messer bringen werde. Ider tötet die beiden Riesen und schafft das Messer herbei, worauf die Heirat unverzüglich stattfindet. Eine dem erzählten Anfang des Lai vom Maultier ohne Zaum sehr ähnliche Episode findet sich auch im Tyolet. Tyolet, ein noch junger, unbekannter Ritter, ist gerade an Artus' Hof gekommen, als sich ein Mädchen, die Tochter des Königs von Logres einfindet, welche ihre Hand dem Ritter verheißt, der ihr den weißen Fuß eines von sieben Löwen bewachten Hirsches bringt. Ein weißer Hund, der der Königstochter gefolgt ist, wird den Ritter an die Stätte geleiten. Tyolet unternimmt das Wagestück, tötet die sieben Löwen und haut dem Hirsch den Fuß ab. Nachdem er durch einen Verräter, der ihm den Fuß entwendet und damit sich selbst die Besiegung der Löwen zuschreibt, fast um den Lohn seiner Tat gebracht worden wäre, wird schließlich doch der Verräter überführt, und Tyolet bekommt den ihm zukommenden Preis. Ganz ähnlich findet sich diese Erzählung in dem großen niederländischen Lancelot *), nur dass hier nicht die Königstochter selber, sondern die Abgesandte einer Königin an den Hof kommt, und dass Lancelot die gewonnene Hand der Königin ausschlägt. Bemerkenswert ist ferner eine Stelle in Li Chevaliers as deus espees, wo es sich freilich nur indirekt um die Lösung einer Aufgabe handelt; umso deutlicher tritt jedoch der Gebrauch der Gattenwahl darin hervor: Eine Königin kommt an den Hof des Königs Artus, umgürtet mit einem Schwerte, welches die Eigenschaft hat, dass nur der tapferste Ritter es vom Gehänge zu lösen vermag. Sie bittet den König, ihr den Ritter zum Gemahl zu geben, der ihr das Schwert abnehmen könne. Meriadeus ist der einzige, der dies fertigbringt. Seltsam ist auch ein Vorgang in einem Lai der Marie de France. Ein König, der seine Tochter zu verheiraten wünscht (dass sie selber danach verlangt, wird nicht gesagt), lässt bekannt machen, er werde seine Tochter dem zur Frau geben, der es vermöge, sie auf seinen Armen, ohne auszuruhen, auf einen in der Nähe gelegenen Berg zu tragen.
*) Lancelot et le cerf au pied blanc, Teil des niederländischen Roman van Lancelot a.a.O. Buch III, Vers 22271-23126.
Bei diesen Beispielen des Brautdienstes und der Gattenwahl ist das Auffallendste und unserer heutigen praktischen Anschauungsweise Widersprechendste, dass der Dienst, den die Dame von ihrem Ritter verlangte oder den sie ihren verschiedenen Bewerbern als Probestück aufgab, im Allgemeinen für die Auftraggeberin selber von sehr geringem Vorteil ist. Was konnte es der Dame im Lai de Doon nützen, wenn ihre Liebhaber sich auf ihrem Dauerritt Lunge und Leber ruinierten oder sonst irgendwie an ihrem Körper Schaden nahmen? Was hatte die umworbene Schöne davon, wenn ihre Anbeter im Turnier sich die Knochen im Leibe zerbrachen? Heutzutage würde doch ein Mädchen den Mann, den sie liebt, kaum so unnützer Weise in Lebensgefahr bringen wollen. Der Unterschied zwischen heute und damals liegt nun aber gerade darin, dass in jenen Zeiten die Gefahren, die der Ritter auf sich nahm, doch insofern einen Nutzen hatten, als erst durch sie das Liebesverhältnis vor den Augen der Welt gerechtfertigt erschien. Abgesehen von diesem idealen Vorteil, welchen jede kriegerische Tat des Ritters für die Liebenden mit sich brachte, finden sich nun nahezu in gleicher Fülle Beispiele von wirklich praktischen Diensten, die entweder der Jungfrau selber oder ihrem Vater geleistet werden und die mit der Hand der Jungfrau belohnt werden. Ganz allgemein ist z. B. der Gebrauch, dass ein König, der durch die Tapferkeit eines Ritters aus einer Gefahr befreit ist, diesem seine Tochter vermählt. Hierher gehört z. B. die Episode des Drachenkampfes im Tristan. Tristan kommt nach Irland, um für seinen Oheim, König Marke, um die Hand der Prinzessin Isolde zu werben. Um diese Zeit hauste in Irland ein fürchterlicher Drache, und der König hatte dem Besieger des Ungetüms die Hand seiner Tochter verheißen. *) Tristan unternimmt den Kampf, tötet den Drachen und wird dann, ähnlich wie Tyolet und Lancelot (siehe S. 31 f.), durch einen Verräter, der für sich selber den Sieg in Anspruch nimmt, beinahe um den zugesagten Preis gebracht.
*) In den französischen Bruchstücken (ed. von Fr. Michel, London 1835/39) ist die Episode des Drachenkampfes nicht erhalten. Ich zitiere deswegen nach dem deutschen Tristan Gottfrieds von Strassburg, herausgegeben von Reinh. Bechstein (3. Aufl., Leipzig 1890), Vers 8901-8917.
Schließlich kommt auch hier die Wahrheit ans Licht. Tristan begnügt sich indes damit, seinem Auftrage gemäß im Namen des Königs Marke um die Isolde anzuhalten. — Außerordentlich häufig ist ferner von kriegerischen Einfällen die Rede, welche durch die tatkräftige Hilfe eines Helden glücklich abgewandt werden, wofür dann der Sieger mit dem Besitz der Königstochter belohnt wird. Unter anderem sei das Beispiel des Guy of Warwick erwähnt, welcher den Kaiser von Konstantinopel von einem Einfall des Sultans von Babylon befreit, worauf der erstere ihm seine Tochter anbietet. Guy schlägt das Anerbieten nur in Erinnerung an seine Jugendliebe im fernen Heimatlande, eine englische Prinzessin, aus. Bezeichnend für die Anschauung, dass auch Leute niederen Standes durch Waffentüchtigkeit zum höchsten gelangen konnten, ist auch das Epos Hue Capet. Das Gedicht legt überhaupt beredtes Zeugnis ab für das erwachende Selbstbewusstsein des Bürgerstandes, wie es in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in den Städten, besonders in Paris, sich kundtat. Der Trouvère lässt den späteren König Hugo Capet als Sohn eines „Sire“ de Beaugenci und der Tochter eines reichen Fleischers geboren werden. Nachdem der junge Hue sein väterliches Erbteil verjubelt, bleibt ihm nichts weiter übrig, als bei seinem Oheim, dem reichsten Schlachtermeister von Paris, in die Lehre zu treten. Doch liegt ihm der Hang zu ritterlichen Abenteuern zu sehr im Blute, als dass er mit Befriedigung seinem neuen Geschäft nachgehen könnte. Bald bietet sich ihm auch Gelegenheit, sich seinem eigentlichen Beruf zuzuwenden. Paris wird von feindlichen Heeren belagert, und Hue ist derjenige, durch dessen Tapferkeit die Streitkräfte der Belagerer zerstreut und vernichtet werden. Der verdiente Held erhält zum Lohn die Hand der Erbprinzessin Blancheflor und steigt so vom Fleischergesellen zum König von Frankreich empor. — Nicht immer wurden hierbei zugesagte Bedingungen so getreulich gehalten. So bietet Doon de Mayence dem König l'Aubigan von Vauclere gegen die seine Stadt belagernden Dänen Hilfe an unter der Bedingung, dass der König ihm seine Tochter Flandrine zur Gattin geben solle; l'Aubigan, der sich in großer Bedrängnis befindet, sagt zu mit dem Nebengedanken, dass er nach Besiegung der Dänen wohl auch mit der Handvoll Franken fertig werden würde. Als er aber wirklich seinen Treubruch ins Werk setzen will, entsteht ein wütender Kampf, in dem unter vielen anderen auch der König erschlagen wird. Doon aber erhält die Herrschaft in der Stadt und heiratet die Flandrine. Nicht so glücklich gelingt es dem Aucassin (in der berühmten „chantefable“ Aucassin und Nicolete), sich sein Recht zu verschaffen. Aucassin sagt seinem Vater die Rettung seines von Feinden bedrängten Königreiches nur unter der Bedingung zu, dass er die Nicolete einmal küssen und drei Worte mit ihr wechseln dürfe. Dies Versprechen, welches ihn dem Ziel seiner Wünsche immerhin etwas näherbringen kann, wird ihm auch gemacht. Er schlägt die Feinde, sieht sich aber dann grausam um den Lohn seiner Mühe betrogen.
Größere Treue und Ehrlichkeit pflegen in dieser Beziehung die Damen selber zu zeigen. Wenigstens findet sich kein Beispiel davon, dass ein Mädchen dem Ritter, der sie aus drohender Gefahr befreit, den versprochenen und ihm nach der Sitte der Zeit zukommenden Lohn schuldig bleibt. Besonders ist es ein dem vorher Erörterten ganz analoger Zug, dass ein Ritter eine Königin von ihren Feinden befreit und zum Dank ihre Hand und ihre Krone erhält. Von dem gewöhnlichen Gange etwas abweichend ist eine Episode in Le Bel Inconnu. Giglain, der als junger Ritter eben an Artus' Hof gekommen ist, folgt dem Rufe einer Jungfrau, welche um Befreiung ihrer verzauberten Herrin bittet. Er gelangt in die „Gaste Cité“, tötet zwei ihm entgegentretende Ritter und sieht sich dann einer Schlange gegenüber, die sich ihm aber demütig und zahm nähert und ihn, bevor er es hindern kann, auf den Mund küsst. Damit ist der Zauber gebrochen; die Schlange verwandelt sich in ein schönes Mädchen, eine Königstochter, welche dem Befreier Hand und Krone bietet. Giglain beweist sich diesem freundlichen Entgegenkommen gegenüber sehr zurückhaltend, indem er eine ausweichende Antwort gibt.
Halten wir nun daran fest, dass der Begriff der Tapferkeit die Ursache zu der Entstehung des Brautraubes war, so führt uns derselbe. Begriff zugleich auf ein an sich gänzlich entgegengesetztes Gebiet, dessen Kernpunkt aber gleichfalls der Begriff der Tapferkeit bildet, auf das Erdienen der Braut Dieser im Mittelalter so weit verbreitete Gebrauch ist, genau genommen, eigentlich nichts anderes als ein Brautkauf, bei welchem der Preis nur nicht in Geld oder Gut, sondern eben durch die Dienste des Käufers abgezahlt wurde. Bevor wir indes auf die näheren Umstände eingehen, unter welchen dieser Brautdienst, der in jener Zeit meist ritterlicher Art war, statt hatte, wollen wir die Frage erörtern: Finden sich in altfranzösischen Epen Beispiele von eigentlichem Brautkauf, d. h. dem Abschluss von Ehen in der Weise, dass der Freier die Braut von ihrem Vater oder nächsten Anverwandten durch Geld oder Geschenke erkauft? Von diesem Gebrauch sind nur schwache Andeutungen vorhanden. Im Cléomades findet sich folgender Zug: Drei afrikanische Könige werben um die drei Schwestern des Cléomades, indem jeder ein kostbares Brautgeschenk herbeibringt, darunter auch jenes oben erwähnte wunderbare Pferd, mit dessen Hülfe Cléomades sich nachher der von ihm geliebten Prinzessin bemächtigt. — An einer Stelle des Aubéri le Bourgoing hält der Räuber Lambert d'Oridon um die Hand der Seneheut, Aubéris Stieftochter, an, indem er sich für einen mächtigen Grafen ausgibt und unermessliche Schätze als Brautgeschenke bietet. — Als Gegenstück hierzu ist eine Stelle der schon erwähnten Chanson de Geste „Aye d'Avignon“ von Interesse. Bérenger, der Sohn des Verräters Ganelon, landet mit seiner Gattin Aye, die er seinerseits ihrem rechtmäßigen Gatten entführt hat, an der Küste der Balearen. Der sarazenische König dieser Inseln, Ganor, hält Aye für eine Verwandte („cosine ou parente“) Bérengers und ersucht ihn, sie ihm zu verkaufen. Dieser aber weigert sich mit den Worten, es sei in Frankreich nicht Mode, dass man seine Frauen verkaufe. Es spricht sich hierin eine deutliche Abneigung gegen die bei den Muselmännern übliche Sitte des Brautkaufes aus. Dass diese Abneigung bestanden haben muss bestätigt sich auch durch die außerordentliche Spärlichkeit der Überreste, welche sich vom Brautkauf in der französischen Dichtung des Mittelalters finden, und dass eine auf so wenig ritterlichen Anschauungen beruhende Einrichtung wie der Brautkauf in jener Blütezeit höfischen Wesens nicht zu Ansehen kommen konnte, ist leicht begreiflich.
In einer Zeit, wo ritterliche Taten in so hohem Ansehen standen, war es natürlich, dass bei der Brautwerbung niemand würdiger erschien als wer durch Kühnheit und Tapferkeit hervorragte. Wer also, ohne zum Brautraub oder zur List seine Zuflucht nehmen zu wollen, um die Hand eines Mädchens warb, musste sich zunächst durch irgendwelche ritterlichen Dienste ihrer würdig erweisen.*) So bildete sich der Gebrauch heraus, dass der Ritter hei seiner Dame in ein förmliches Dienstverhältnis trat, welches oft auch äußerlich durch ein dem Ritter von seiner Herrin verliehenes Abzeichen angedeutet wurde. In vielen Fällen stellte diese selber Aufgaben, deren einfachste Form das an den Ritter gerichtete Verlangen der Tapferkeit war. So fordert in dem schon genannten Epos Bueves de Commarchis die Prinzessin Malatrie von ihrem Vorlobten, er solle durch eine ritterliche Tat beweisen, dass er des verheißenen Lohnes würdig sei. Als dann jener in einem unter den Augen seiner Braut stattfindenden Zweikampfe besiegt wird, hat dieser Umschwung seines Kriegsglückes zugleich den Verlust seiner Geliebten zur Folge. **)
*) Manchmal war die Forderung ritterlicher Dienste in einer Klausel verborgen. So bekommt in dem — aus dem Englischen entlehnten (vgl. Körting, Grundriss der Gesch. der engl. Litt. § 88) — Lai de Havelock, H., ein Küchenjunge, die Hand einer Königstochter, infolge einer Bestimmung, welche deren Vater sterbend getroffen hatte, man solle seine Tochter dereinst dem Stärksten im Lande vermählen; und als dieser war H. bekannt.
**) Ähnlich im Méraugis de Portlesguez von Raoul de Houdene, public .... par H. Michelant, Paris 1869, S- 45, Vers 49 f., wo Lidoine von dem ihr durch einen unter Vorsitz der Königin gefällten Urteilsspruch zugesprochenen M. verlangt, er solle zuvor ein Jahr lang seine kriegerische Tüchtigkeit erweisen.
Zuverlässiger erweist sich Guy of Warwiek, der die noch weit anspruchsvolleren Forderungen einer englischen Prinzessin getreulich vollführt. Mehrmals kehrt er nach Vollbringung der unglaublichsten Heldentaten zu seiner Angebeteten zurück, immer hoffend, das ihm gesteckte Ziel des größten Helden der Christenheit erreicht zu haben. Nach langen Jahren und nach Bestehung der härtesten Proben findet er endlich Erhörung. Im direkten Gegensatz zu diesen, den unverkennbaren Stempel ihrer Zeit tragenden Dichtungen steht ein auf germanischer Grundlage beruhendes Gedicht, Horn, welches eine ganz andere Auffassung der Liebe zeigt. Hier ist es nicht der Mann, sondern das Mädchen, welches das erste Liebesgeständnis macht. Die Königstochter Rimel liebt den jungen Horn, der, obwohl Königssohn, dennoch nicht als solcher, sondern als einfacher Knappe an ihres Vaters Hofe lebt, da er in jungen Jahren sein Vaterland hat verlassen müssen. Rimel entbietet Horn zu sich und gesteht ihm ihre Liebe. Er aber erwidert, er sei ihrer noch nicht würdig; wenn er dereinst den Ruf eines tapferen Ritters erlangt habe, dann sei er bereit, mit Genehmigung ihres Vaters, des Königs, ihre Wünsche zu erfüllen. Trotz der sich hier aussprechenden Verschiedenheit der altgermanischen Anschauung von der romanischen, die übrigens in dem altenglischen Gedichte King Horn *) noch deutlicher hervortritt zeigt sich dennoch die Auffassung des Brautdienstes nicht minder klar: Die Liebe der Jungfrau war ein Lohn, der erst durch ritterliche Taten erworben werden musste. Ob diese nun von der Jungfrau selber gefordert werden, oder ob der Ritter der Vernünftige ist und die Liebe des Mädchens erst annehmen will, wenn er ihr einen berühmten Namen zu bieten vermag, bleibt sich für diese Auffassung völlig gleich. Umgekehrt wurde Feigheit des Gatten oder Verlobten als genügender Grund für die Frau angesehen, ihn zu verlassen. So geht es Lanzelet, als er mit seiner Gattin in eine verzauberte Stadt kommt. Jeder Ritter, der sie betrat, wurde in der Art umgewandelt, dass er umso schwächlicher und feiger wurde, je tapferer und kühner er vorher gewesen war. Lanzelet wird von sämtlichen Rittern, die der Herrscher der Stadt dort gefangen hält und nach Belieben beleidigt oder töten lässt, alsbald der jämmerlichste und duldet die gröbsten Schmähungen. Die arme Frau, die sich die Umwandlung ihres Gatten nicht zu erklären weiß, entschließt sich zuletzt schweren Herzens, ihn zu verlassen. Dem Charakter der Ritterromane gemäß, die doch vorzugsweise auf eine Verherrlichung des Ritterstandes hinausliefen, wenigstens wenn man von den Karikaturen der späteren Zeit absieht, sind Beispiele, wie das letzte, natürlich selten.
*) Inh. des französischen Roman de Horn, bist litt., Bd. 22, S. 559 f.
Der englische King Horn, herausgegeben von Dr. Horstmann, Horrigs Archiv, Bd. 50, 1872, S. 39 ff., Vors 250-598.
Auf die Eigentümlichkeit der germanischen Auffassung im Horn hat zuerst Ten Brink aufmerksam gemacht, vgl. Wissmann, Studium zu King Horn, Anglia 4, S. 372 ff.
Umso häufiger findet sich, und zwar namentlich in Romanen bretonischen Ursprungs, die Erscheinung, dass die Geliebte von ihrem Ritter nicht, wie im Bueves de Commarchis, allgemeine Betätigung der Tapferkeit verlangte, sondern dass sie ihm Einzelaufgaben stellte, die oft von der seltsamsten und abenteuerlichsten Art sind. Der Wunsch, welchen im Torec *) die schöne Mirande ausspricht, ihr Verehrer Torec möchte sämtliche Ritter von Artus' Tafelrunde aus dem Sattel heben, was er denn auch glücklich vollbringt, erscheint noch bescheiden im Vergleich zu den ungeheuerlichen Gefahren, welche die Launenhaftigkeit anderer Schönen ihren ebenso todesmutigen als geduldigen Anbetern auferlegt. Im Lai de Doon **) hat Doon sich durch Vollbringung eines Probestücks, eines Dauerrittes von Southampton bis Edinburgh in einem Tage, ein Anrecht auf die Hand einer Königstochter erworben. Diese aber, mit der ersten Leistung nicht zufrieden, verlangt noch obendrein, Doon solle es zu Pferde mit einem im Fluge begriffenen Schwan aufnehmen. Als er auch dies glücklich vollführt, wird das ihm gegebene Versprechen endlich eingelöst. Ein nicht minder anspruchsvolles Ansinnen wird im Conto du Graal ***) an Perceval von einer Jungfrau gestellt, in deren Dienst er sich begibt.
*) Torec, Teil des niederländischen Roman van Lancelot, herausgegeben von Dr. W. J. A. Jonckbloet, 'Sgravenhage 1849, III. Buch, Vers 23769-23775 und Vers 26133-26891.
**) Lai de Doon s. Romania Bd.8, S.591T., Vers 136-162.
***) Die Sage vom Gral, ihre Entwicklung und dichterische Ausbildung in Frankreich und Deutschland im 12. und 13. Jahrhundert von Ad. Birch-Hirschfeld, Leipzig 1877, S. 96-98. (Der Inhalt wird nach Potvins Ausgabe angegeben, und das hier interessierende Stück umfasst dort etwa Vers 22400- 30500.)
Sie fordert, er solle ihr den Kopf eines weißen Hirsches bringen, der sich in dem angrenzenden Schlossparke befände. Dieses scheinbar leichte Unternehmen wird dadurch zu einem äußerst schwierigen, dass sich damit eine Reihe gefährlicher Abenteuer verknüpft; wie zu erwarten ist, besteht Perceval sie alle und erhält dann den zugesagten Lohn. — In „Le Bel Inconnu“ hat eine Dame, die „fée de l'ile d'or“ die sonderbare Bestimmung getroffen, ihr Bewerber solle eine Brücke bewachen und jeden, der dieselbe überschreiten wolle, mit Waffengewalt daran hindern. Wenn er in diesen Kämpfen neun Jahre Sieger geblieben, solle er die Hand der Fee erhalten. Als Giglain dorthin kommt, tritt ihm als Wächter ein Ritter entgegen, welcher bereits sieben Jahre seines Amtes gewaltet hatte. Giglain besiegt den Ritter, und die Fee, welche an ihm besonderes Wohlgefallen findet, beschließt dieses Mal eine Ausnahme zu machen, und bietet ihm Hand und Krone auf der Stelle an, was Giglain allerdings nicht annehmen kann, da er sich schon zu einem anderen Abenteuer verpflichtet hat. Aus derartigen Beispielen, wo ein Mädchen den um ihre Liebe werbenden Mann selber den größten Gefahren aussetzt, könnte man schließen, dass die Damen jener Zeit auf diesem — damals in der Tat nicht ungewöhnlichen Wege — sich ungebetene Liebhaber hätten vom Halse schaffen wollen, ja überhaupt von außerordentlicher Sprödigkeit gegen das männliche Geschlecht gewesen seien. Dass aber ungefähr das Gegenteil der Fall ist, beweisen zahlreiche Beispiele in der altfranzösischen Dichtung; und es ist nicht daran zu zweifeln, dass diese Geschichten, mögen sie auch gerade hier oft übertreiben, dennoch sehr viel Wahres enthalten. Sicherlich dachte jene Zeit in dieser Beziehung ganz anders als die unsere. Die Liebe eines ritterlichen Helden gereichte jeder Jungfrau zur Zierde, und viele Beispiele lehren, dass es für ein Mädchen keine Schande war, wenn sie einem solchen Manne ihre Liebe schenkte. Gauvain z. B. der Hauptheld der Artusromane, gewinnt überall wohin er kommt, die Herzen der Damen im Fluge. Aber auch die Liebe eines Mädchens von vornehmem Stande zu einem Manne von niedriger Herkunft und noch nicht erprobter Tüchtigkeit wurde an sich noch nicht als unwürdig angesehen, sie wurde es erst, wenn der Mann durch Feigheit oder Schwäche sich selbst erniedrigte. Aus diesem Gesichtspunkte ist der Vorgang zu erklären, dass eine vornehme Dame sich in einen einfachen Knappen (einen „varlet“) verliebt; da aber an ihre Verbindung so noch nicht zu denken ist, lässt sie selber ihn mit guten Waffen versehen und befiehlt ihm, auf einem gerade stattfindenden Turnier sich ihrer Wert zu zeigen. Der Knappe, schon vorher auf Veranlassung seiner Geliebten zum Ritter geschlagen, verrichtet Wunder der Tapferkeit und wird vom König höchsteigenhändig mit der Hand seiner Dame belohnt.
Dieser Vorgang führt uns auf einen Gebrauch, der sich gleichfalls nicht selten findet, dass der Sieger im Turnier mit der Hand einer vornehmen Frau belohnt wird. Das Turnier, welches von Königen, Fürsten oder anderen hohen Herren ausgeschrieben wurde, war nicht nur der Sammelplatz gewaltiger Helden, sondern auch der schönsten und edelsten Frauen denen allen es natürlich als ein sehr begehrenswertes Ziel erschien, mit einem ruhmgekrönten Sieger vermählt zu werden. So war man um den Siegespreis selten verlegen. In dem Epos Le Bel Inconnu erhält Giglain, nachdem er im Turnier gesiegt, vom König Artus als Preis die Hand einer Königin. Und das Sonderbare hierbei ist, dass der Ritter von dieser königlichen Gnade sehr wenig beglückt ist. Vielmehr liegt er in den Banden einer Anderen und hat die Verbindung mit jener Königin schon einmal von sich gewiesen. Trotzdem entschließt er sich jetzt, das Anerbieten anzunehmen. Besser ergeht es dem Fergus. Dieser siegt in einem Turnier, dessen vorher angekündigter Preis darin bestand, dass der Sieger mit einer Königstochter vermählt werden und zugleich mit ihrer Person auch ihr Reich erhalten sollte. Galiene, gleichfalls eine Königin, bittet Artus, ihr den Fergus, den sie schon lange geliebt hat, zum Gemahl zu geben, um ihn auf diese Weise für seine Heldentaten zu belohnen. Wirklich ist auch Fergus von dem ehrenden Anerbieten höchlich entzückt und der Hochzeit steht nichts im Wege. Nicht immer waren die Bestimmungen des Turniers in dieser Beziehung so allgemein gehalten. Es kommt auch vor, dass Turniere vom Vater der Jungfrau mit der ausgesprochenen Absicht veranstaltet werden, das Mädchen auf ehrenvolle Weise an den Mann zu bringen. Im Escanor veranstaltet der König Canor von Northumberland ein Turnier mit der Bedingung, dass dem Sieger seine Tochter und die Herrschaft seines Landes zufallen solle. Bemerkenswert ist, dass in diesem Fall die Tochter mit der Absicht ihres Vaters nicht einverstanden ist. Sie will unvermählt bleiben und hat bisher alle Bewerbungen zurückgewiesen. Unter ähnlichen Umständen findet ein Turnier im Chevalier à la Manche statt, bei welchem die Hand der Clarette, Prinzessin von Spanien, als Preis ausgesetzt ist. Ähnlich wie im Fergus, gelingt es hier dem Geliebten der Clarette, einem ungenannten Ritter, der als Wahrzeichen seiner Liebe zu der Prinzessin einen von ihr geschenkten Ärmel im Kampfe trägt, den Sieg und die Hand seiner Dame zu erstreiten.Weniger entgegenkommend beweist sich Garlin de Montglane, indem er die Hand der ihm durch den Sieg zugefallenen Florete ausschlägt.
Die Sitte, dass als Siegeslohn eines Turniers der Besitz eines vornehmen Mädchens angeboten wurde, gewinnt ein ganz anderes Aussehen, wenn dies Turnier nicht, wie in den erwähnten Fällen, vom Vater des Mädchens oder an dessen Stelle vom Landesfürsten veranstaltet wurde, sondern wenn die Jungfrau selber das Turnier veranlasste, mit der Absicht, sich mit dem Sieger zu vermählen. Eine alleinstehende Fürstin war in jenen unruhigen Zeiten, in denen der Brautraub durchaus nichts Außergewöhnliches war, den größten Gefahren ausgesetzt, und es war daher für sie von höchst praktischer Wichtigkeit, einen tapferen, starken Gemahl zu haben der imstande war, ihr genügenden Schutz zu gewähren. Andererseits konnte das Turnier zum Notbehelf werden, um das Drängen allzu stürmischer Freier abzulenken. In dem unter solchen Gesichtspunkten veranstalteten Turnier kann man wohl ein Überbleibsel jener uralten Sitte der Gattenwahl erblicken. Im Partonopeus de Blois wird die Kaiserin Melior von Konstantinopel vom Sultan von Persien und hundert benachbarten Königen gedrängt, sich zu vermählen. Die Freier nehmen eine so drohende Haltung an, dass die Kaiserin sich entschließt, ein Turnier zu veranstalten; dem Sieger will sie Hand und Krone schenken. Partonopeus, der die Kaiserin schon lange liebt, hört davon, nimmt an dem Turnier teil und siegt. Er erhält die Hand der Kaiserin und den Thron von Konstantinopel. Weniger glücklich ergeht es im Lai du Chaitivel *) einer Dame, welche, um die Tapferkeit ihrer vier Bewerber zu erproben, ein Turnier veranstalten lässt, auf welchem drei von ihnen getötet werden, der vierte aber zum Krüppel gemacht wird.
Nicht immer war es nötig, dass der Gattenwahl ein Turnier vorausging. Eben sowohl war es auch in diesem Falle möglich, dass die umworbene Dame ihren Freiern irgendeine Aufgabe stellte, die Mut und Tapferkeit erforderte. Wer diese Aufgabe löste, den wählte die Jungfrau zu ihrem Gatten. Wir haben oben schon in anderem Zusammenhange gesehen, zu welcher Höhe sich die Ansprüche der Damen oft verstiegen, selbst dem eigenen Ritter gegenüber, der bereits durch treue Dienste sich ein Anrecht auf entgegenkommende Behandlung erworben hatte.
*) Lai du Chaitivel von Marie de France a. a. O., S. 368 ff. Vers 71-180.
Veranstaltungen eines Turniers zum Zweck der Wahl zwischen den Bewerbern finden sich ferner in La Vengeance de Raguidel, Vers 1221—1226—1438, und im Chevalier du papegaut (perroquet), hist litt., Bd. 30, S. 107.
Kein Wunder, dass diese Ansprüche nicht minder groß waren, wenn es erst galt, die Tüchtigkeit mehrerer Freier zu prüfen. Es wurde schon erwähnt, welch unglaubliche Leistungen auf dem Gebiet des Distanzrittes schon damals vollbracht wurden (vgl. S. 24), wo freilich die Reitübung nicht Selbstzweck war, sondern eine sehr ideale Grundlage hatte — die Liebe. Immerhin war dieser Gedanke selbst für einen Artusroman etwas absonderlich. Nicht selten findet es sich dagegen, dass am Hofe des Königs Artus vor versammelter Ritterschaft eine Dame erklärt, dem Ritter, der ein von ihr angegebenes Unternehmen zu glücklichem Ende führe, ihre Hand zu geben. Es geschieht dies gewöhnlich, ohne dass die betreffende Dame viel umworben ist; oft ist sie sogar gänzlich fremd und stellt sich, ohne dass ihr Erscheinen für den Zusammenhang der Dichtung erforderlich wäre, am Hofe ein. Es ist dies ein beliebtes und von den Trouvères viel gebrauchtes Mittel, um eingeflochtene Abenteuer zu motivieren, die ja gerade einen Hauptbestandteil der Romane der Table ronde bilden. Natürlich finden sich immer galante Helden, die um einer so verlockenden Aussicht willen ihr Leben in die Schanze schlagen, was sie ja doch zu tun gewohnt sind, auch wenn ihnen kein so wertvoller Preis winkt. Hierher gehört z. B. die Handlung des Lai de la Mule sans Frein. Es heißt darin: Als Artus einst mit seinem Hofe das Pfingstfest feierte, stellte sich eine Jungfrau ein, welche auf einem Maultier ohne Zaum ritt. Sie verspricht dem Ritter ihre Liebe, der ihr denselben wieder verschaffe. Der Sénéchal Keux, der fast in allen Artusromanen eine mehr oder weniger lächerliche Rolle spielt, macht sich auf den Weg, kehrt aber, nachdem sich ihm ernstliche Schwierigkeiten in den Weg gestellt, zum Hohn der ganzen Gesellschaft unverrichteter Sache zurück. Nun macht sich Gauvain an die Lösung der Aufgabe, und ihm gelingt es, nach Bestehen der größten Gefahren, den Zaum herbeizuschaffen, worauf ihm der versprochene Lohn zuteilwird. — Ein ähnliches Stück vollbringt Ider. Die Königin Guenloie verspricht ihre Hand dem Ritter, der ihr ein kostbares, von zwei Riesen bewachtes Messer bringen werde. Ider tötet die beiden Riesen und schafft das Messer herbei, worauf die Heirat unverzüglich stattfindet. Eine dem erzählten Anfang des Lai vom Maultier ohne Zaum sehr ähnliche Episode findet sich auch im Tyolet. Tyolet, ein noch junger, unbekannter Ritter, ist gerade an Artus' Hof gekommen, als sich ein Mädchen, die Tochter des Königs von Logres einfindet, welche ihre Hand dem Ritter verheißt, der ihr den weißen Fuß eines von sieben Löwen bewachten Hirsches bringt. Ein weißer Hund, der der Königstochter gefolgt ist, wird den Ritter an die Stätte geleiten. Tyolet unternimmt das Wagestück, tötet die sieben Löwen und haut dem Hirsch den Fuß ab. Nachdem er durch einen Verräter, der ihm den Fuß entwendet und damit sich selbst die Besiegung der Löwen zuschreibt, fast um den Lohn seiner Tat gebracht worden wäre, wird schließlich doch der Verräter überführt, und Tyolet bekommt den ihm zukommenden Preis. Ganz ähnlich findet sich diese Erzählung in dem großen niederländischen Lancelot *), nur dass hier nicht die Königstochter selber, sondern die Abgesandte einer Königin an den Hof kommt, und dass Lancelot die gewonnene Hand der Königin ausschlägt. Bemerkenswert ist ferner eine Stelle in Li Chevaliers as deus espees, wo es sich freilich nur indirekt um die Lösung einer Aufgabe handelt; umso deutlicher tritt jedoch der Gebrauch der Gattenwahl darin hervor: Eine Königin kommt an den Hof des Königs Artus, umgürtet mit einem Schwerte, welches die Eigenschaft hat, dass nur der tapferste Ritter es vom Gehänge zu lösen vermag. Sie bittet den König, ihr den Ritter zum Gemahl zu geben, der ihr das Schwert abnehmen könne. Meriadeus ist der einzige, der dies fertigbringt. Seltsam ist auch ein Vorgang in einem Lai der Marie de France. Ein König, der seine Tochter zu verheiraten wünscht (dass sie selber danach verlangt, wird nicht gesagt), lässt bekannt machen, er werde seine Tochter dem zur Frau geben, der es vermöge, sie auf seinen Armen, ohne auszuruhen, auf einen in der Nähe gelegenen Berg zu tragen.
*) Lancelot et le cerf au pied blanc, Teil des niederländischen Roman van Lancelot a.a.O. Buch III, Vers 22271-23126.
Bei diesen Beispielen des Brautdienstes und der Gattenwahl ist das Auffallendste und unserer heutigen praktischen Anschauungsweise Widersprechendste, dass der Dienst, den die Dame von ihrem Ritter verlangte oder den sie ihren verschiedenen Bewerbern als Probestück aufgab, im Allgemeinen für die Auftraggeberin selber von sehr geringem Vorteil ist. Was konnte es der Dame im Lai de Doon nützen, wenn ihre Liebhaber sich auf ihrem Dauerritt Lunge und Leber ruinierten oder sonst irgendwie an ihrem Körper Schaden nahmen? Was hatte die umworbene Schöne davon, wenn ihre Anbeter im Turnier sich die Knochen im Leibe zerbrachen? Heutzutage würde doch ein Mädchen den Mann, den sie liebt, kaum so unnützer Weise in Lebensgefahr bringen wollen. Der Unterschied zwischen heute und damals liegt nun aber gerade darin, dass in jenen Zeiten die Gefahren, die der Ritter auf sich nahm, doch insofern einen Nutzen hatten, als erst durch sie das Liebesverhältnis vor den Augen der Welt gerechtfertigt erschien. Abgesehen von diesem idealen Vorteil, welchen jede kriegerische Tat des Ritters für die Liebenden mit sich brachte, finden sich nun nahezu in gleicher Fülle Beispiele von wirklich praktischen Diensten, die entweder der Jungfrau selber oder ihrem Vater geleistet werden und die mit der Hand der Jungfrau belohnt werden. Ganz allgemein ist z. B. der Gebrauch, dass ein König, der durch die Tapferkeit eines Ritters aus einer Gefahr befreit ist, diesem seine Tochter vermählt. Hierher gehört z. B. die Episode des Drachenkampfes im Tristan. Tristan kommt nach Irland, um für seinen Oheim, König Marke, um die Hand der Prinzessin Isolde zu werben. Um diese Zeit hauste in Irland ein fürchterlicher Drache, und der König hatte dem Besieger des Ungetüms die Hand seiner Tochter verheißen. *) Tristan unternimmt den Kampf, tötet den Drachen und wird dann, ähnlich wie Tyolet und Lancelot (siehe S. 31 f.), durch einen Verräter, der für sich selber den Sieg in Anspruch nimmt, beinahe um den zugesagten Preis gebracht.
*) In den französischen Bruchstücken (ed. von Fr. Michel, London 1835/39) ist die Episode des Drachenkampfes nicht erhalten. Ich zitiere deswegen nach dem deutschen Tristan Gottfrieds von Strassburg, herausgegeben von Reinh. Bechstein (3. Aufl., Leipzig 1890), Vers 8901-8917.
Schließlich kommt auch hier die Wahrheit ans Licht. Tristan begnügt sich indes damit, seinem Auftrage gemäß im Namen des Königs Marke um die Isolde anzuhalten. — Außerordentlich häufig ist ferner von kriegerischen Einfällen die Rede, welche durch die tatkräftige Hilfe eines Helden glücklich abgewandt werden, wofür dann der Sieger mit dem Besitz der Königstochter belohnt wird. Unter anderem sei das Beispiel des Guy of Warwick erwähnt, welcher den Kaiser von Konstantinopel von einem Einfall des Sultans von Babylon befreit, worauf der erstere ihm seine Tochter anbietet. Guy schlägt das Anerbieten nur in Erinnerung an seine Jugendliebe im fernen Heimatlande, eine englische Prinzessin, aus. Bezeichnend für die Anschauung, dass auch Leute niederen Standes durch Waffentüchtigkeit zum höchsten gelangen konnten, ist auch das Epos Hue Capet. Das Gedicht legt überhaupt beredtes Zeugnis ab für das erwachende Selbstbewusstsein des Bürgerstandes, wie es in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in den Städten, besonders in Paris, sich kundtat. Der Trouvère lässt den späteren König Hugo Capet als Sohn eines „Sire“ de Beaugenci und der Tochter eines reichen Fleischers geboren werden. Nachdem der junge Hue sein väterliches Erbteil verjubelt, bleibt ihm nichts weiter übrig, als bei seinem Oheim, dem reichsten Schlachtermeister von Paris, in die Lehre zu treten. Doch liegt ihm der Hang zu ritterlichen Abenteuern zu sehr im Blute, als dass er mit Befriedigung seinem neuen Geschäft nachgehen könnte. Bald bietet sich ihm auch Gelegenheit, sich seinem eigentlichen Beruf zuzuwenden. Paris wird von feindlichen Heeren belagert, und Hue ist derjenige, durch dessen Tapferkeit die Streitkräfte der Belagerer zerstreut und vernichtet werden. Der verdiente Held erhält zum Lohn die Hand der Erbprinzessin Blancheflor und steigt so vom Fleischergesellen zum König von Frankreich empor. — Nicht immer wurden hierbei zugesagte Bedingungen so getreulich gehalten. So bietet Doon de Mayence dem König l'Aubigan von Vauclere gegen die seine Stadt belagernden Dänen Hilfe an unter der Bedingung, dass der König ihm seine Tochter Flandrine zur Gattin geben solle; l'Aubigan, der sich in großer Bedrängnis befindet, sagt zu mit dem Nebengedanken, dass er nach Besiegung der Dänen wohl auch mit der Handvoll Franken fertig werden würde. Als er aber wirklich seinen Treubruch ins Werk setzen will, entsteht ein wütender Kampf, in dem unter vielen anderen auch der König erschlagen wird. Doon aber erhält die Herrschaft in der Stadt und heiratet die Flandrine. Nicht so glücklich gelingt es dem Aucassin (in der berühmten „chantefable“ Aucassin und Nicolete), sich sein Recht zu verschaffen. Aucassin sagt seinem Vater die Rettung seines von Feinden bedrängten Königreiches nur unter der Bedingung zu, dass er die Nicolete einmal küssen und drei Worte mit ihr wechseln dürfe. Dies Versprechen, welches ihn dem Ziel seiner Wünsche immerhin etwas näherbringen kann, wird ihm auch gemacht. Er schlägt die Feinde, sieht sich aber dann grausam um den Lohn seiner Mühe betrogen.
Größere Treue und Ehrlichkeit pflegen in dieser Beziehung die Damen selber zu zeigen. Wenigstens findet sich kein Beispiel davon, dass ein Mädchen dem Ritter, der sie aus drohender Gefahr befreit, den versprochenen und ihm nach der Sitte der Zeit zukommenden Lohn schuldig bleibt. Besonders ist es ein dem vorher Erörterten ganz analoger Zug, dass ein Ritter eine Königin von ihren Feinden befreit und zum Dank ihre Hand und ihre Krone erhält. Von dem gewöhnlichen Gange etwas abweichend ist eine Episode in Le Bel Inconnu. Giglain, der als junger Ritter eben an Artus' Hof gekommen ist, folgt dem Rufe einer Jungfrau, welche um Befreiung ihrer verzauberten Herrin bittet. Er gelangt in die „Gaste Cité“, tötet zwei ihm entgegentretende Ritter und sieht sich dann einer Schlange gegenüber, die sich ihm aber demütig und zahm nähert und ihn, bevor er es hindern kann, auf den Mund küsst. Damit ist der Zauber gebrochen; die Schlange verwandelt sich in ein schönes Mädchen, eine Königstochter, welche dem Befreier Hand und Krone bietet. Giglain beweist sich diesem freundlichen Entgegenkommen gegenüber sehr zurückhaltend, indem er eine ausweichende Antwort gibt.
Dieses Kapitel ist Teil des Buches Die Spuren des Brautraubes, Brautkaufes und ähnlicher Verhältnisse in den französischen Epen des Mittelalters.

022 Zweikampf im Ring
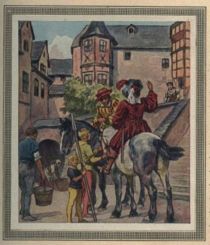
023 Burginneres
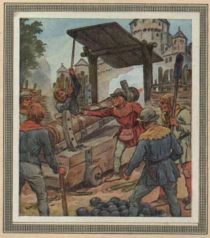
024 Belagerung einer Burg
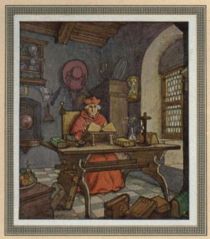
025 Gelehrtenstube
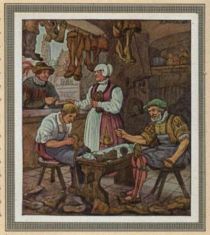
026 Schuhmacherwerkstatt

027 Zahnbrecher

028 Alchimist
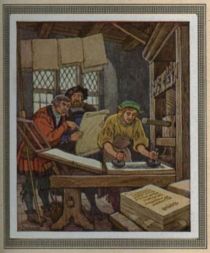
029 Buchdruckerwerkstatt

030 Waffenschmiede
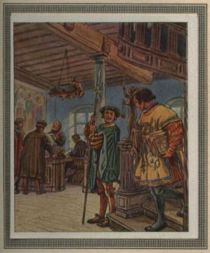
031 Rathausdiele
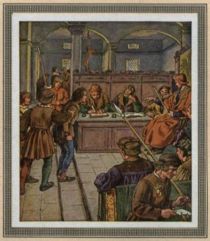
032 Gerichtssitzung

033 Schulstube

034 Hafen mit Hanseschiff

035 Hirtenleben

036 Kirchgang

037 Bergwerk

038 Küchen-Inneres
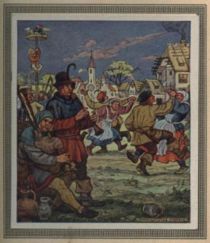
039 Bauernkirmes

040 Postreiter

041 Straßenszene

042 Kinderstube
alle Kapitel sehen