Berthold Auerbach
Berthold Auerbach
Hielte ich diesen Vortrag in einem rein literarischen Verein, so würde ich das Phänomen zu untersuchen haben, wodurch es kam, daß ein Schriftsteller, der von 1840—80 ein Lieblingsautor der deutschen Nation war, nicht etwa bloß der Juden, dessen gesammelte Werke in mehreren Ausgaben, dessen Einzelschriften in vielen Editionen, zum Teil in sehr kostbaren, verbreitet waren, bald nach seinem Tode ein vergessener wurde. Selbst die köstliche Briefsammlung, die der Adressat Jakob Auerbach mit einer vortrefflichen Vorrede von Friedrich Spielhagen herausgab (2 Bände 1884), konnte den Verstorbenen nicht wieder lebendig machen, sie wurde von dem Verleger verschleudert und ist seitdem in allen Antiquariatshandlungen für wenige Mark zu erhalten.
Da ich indessen in einem jüdischen Kreise über einen deutschen Schriftsteller jüdischen Glaubensrede, so stelle ich das Jüdische in den Vordergrund und wende dem Allgemeinen nur im geringen Maße meine Aufmerksamkeit zu.
Ganz kurz soll von dem Leben gesprochen werden. Berthold Auerbach ist am 28. Februar 1812 in Nordstetten im Schwarzwald geboren, am 8. Februar 1882 in Cannes gestorben und in seiner Heimat begraben. Er war zuerst in seinem Heimatdorf unterrichtet worden, genoss dann seine Ausbildung in verschiedenen Städten, zunächst in der Absicht Rabbiner zu werden, wandte sich jedoch bald von dem Studium der Theologie zu dem der Jurisprudenz, ohne freilich auch bei diesem Studium auszuharren und seine Universitätsjahre zu einein bestimmten Abschluß zu bringen. Er beteiligte sich an den freiheitlichen Bewegungen, mußte diese Beteiligung durch eine Gefängnisstrafe büßen, und wurde freier Schriftsteller, der lange genug um seine Anerkennung zu kämpfen hatte. Er lebte abwechselnd am Rhein, in Süd-, später in Norddeutschland, heiratete in Breslau siedelte sich dann in Heidelberg an, ging nach Wien, wo er seine zweite Gattin sich holte, lebte längere Zeit in Dresden und seit 1859, freilich mit vielen mehrmonatigen Unterbrechungen, in Berlin.
In der deutschen Literatur hat er sich einen festen Platz erobert durch drei größere Romane, vor allem durch seine Dorfgeschichten.
Sprechen wir von diesen Romanen zuerst. „Auf der Höhe“, 3 Bände 1865; „Ein Landhaus am Rhein“, 5 Bände 1869; „Waldfried“, 3 Bände 1874. Der Roman „Auf der Höhe“ ist ein gutes Buch. Die einzelnen Personen, die Amme Walpurga, die Gräfin Jrma, ihr Vetter Eberhardt, die alte Beate, die Mutter der Walpurga sind trefflich geschildert. Weniger gelungen die Personen aus der Hofsphäre, die zwar dem Dichter keineswegs unbekannt, aber doch nicht so vertraut war, daß er imstande gewesen wäre, sie vollkommen künstlerisch darzustellen. Denn der König leidet an einem gewissen hohlen Pathos, die Königin an einer wenig natürlichen Schwärmerei. Die Intrige ist durchsichtig, die Vorgänge werden geschickt erzählt. Gerade diese Mischung von Dorf- und Hofgeschichten, von Erzählungen aus der kleinen und der großen Welt, wirkt durchaus nicht zerstreuend, sondern belebt und erhöht das Interesse. Gewiß ist es ein Tendenzroman: die Erziehung der Menschen zur Entsagung. Denn die Gräfin Jrma, die eine zeitlang sich einbildete, von dem Könige zur höchsten Stellung erhoben zu werden, flieht, nachdem sie die ehrgeizigen Pläne unterdrückt hat, die eine zeitlang ihr Hirn und ihr Herz beschäftigt hatten. Gerade das, was viele hochgebildete Menschen getadelt haben, daß Jrma nicht in ein Kloster geht, sondern in der Welt ausharrt, um zu büßen und zu bereuen, erscheint wir als ein besonders großartiger Zug. Und auch der Umstand, daß die Königin in ihrem tiefen Schmerz keine geistliche Zusprache wünscht, sondern durch einen spinozistischen Arzt sich und dem Leben wiedergegeben wird, will ich keineswegs als tadelnswert gelten lassen.
So viel Lob man dem ersten Roman auch zollen mag, dem zweiten gegenüber bleibt man recht kühl. Es ist ein buntes Durcheinander, der außerordentlich viele und lange Unterhaltungen über die Neger- und Kirchenfrage, über die Bedeutung und das Wesen der Erziehung, über Menschenwürde, über segensreiche und philanthropische Behandlung der Missetäter, Bürgerstolz, Verachtung des Adels, schädliche Herrschaft des Kapitals usw. enthält. Einen ähnlichen Reichtum wie an Stoffen der Unterhaltung zeigt der Roman auch an Personen, die dazu bestimmt sind, die Reden zu führen: Industrielle, Fürsten, Bauern, Geistliche. Es fehlt dem Dichter doch völlig an der Fähigkeit, die zahllosen Fäden zusammenzuhalten und zu entwirren; auch eine Kenntnis der technischen Berufe, der ökonomischen Grundsätze geht ihm ab. Wir erhalten daher ein außerordentlich langes, aber wenig befriedigendes Gerede über die mannigfachsten Gegenstände, denen man heute nur wenig Interesse mehr abgewinnen kann. Selbst zu der Schilderung des eigentlichen Helden, des Fabrikanten Sonnenkamp, der als eine dämonische Verbrechernatur, als eine titanische Persönlichkeit dargestellt werden sollte, versagt des Dichters Kraft. Ebensowenig ist es ihm gelungen, die Gesellschaft wahrhaft anschaulich darzustellen oder die Landschaft poetisch zu gestalten.
Wie in dem eben erwähnten Roman die mangelhafte Kenntnis der verschiedenen Wissenschaftsgebiete, so tritt im „Waldfried“ die geringe Kenntnis der Geschichte störend hervor. Das Werk sollte in der Art, wie einzelne Romane der zeitgenössischen Autorin Fanny Lewald, die Geschichte eines Geschlechtes von 1817—1870 geben, eine Familie vom Urgroßvater bis zum Urenkel verfolgen: einen altliberalen, nach dem die Geschichte ihren Namen hat, der Burschenschaftler gewesen, 1848 als Mitglied des Parlaments gewirkt, ein guter freisinniger Bürger; neben ihm den älteren Sohn, der 1849 sich an der Revolution beteiligt und nach Amerika geflohen war, und den jüngeren Sohn, der kleinstaatlichen politischen Richtung ergeben, der infolgedessen 1866 sich dem Militärdienst entzogen hatte und später in die algerische Fremdenlegion eingetreten war. Als Mitglieder der Familie sind auch die Schwiegersöhne aufgenommen und ein Offizier und Pfarrer. Es fehlt also nicht an Personen, an Verschiedenheiten oder Abstufung der Gesinnung. Und doch ist das Ganze nicht zu rechter Einheit zusammengeschmolzen. Nicht nur der Umstand, daß der Autor so wenig wie in der Geschichte in dem Getriebe der Politik zu Hause ist, hindert den Genuß, sondern der Mangel einer wirklich plastischen Schilderung, einer lebendigen Vorführung interessanter Begebenheiten. Trotz aller löblichen Tendenz und trotz vieler trefflicher Einzelheiten, die in diesem Buche ebensowenig mangeln wie in den beiden früheren Romanen, kann man es keineswegs als Meisterwerk bezeichnen.
Ganz anders muß das Urteil über die Werke lauten, durch die Berthold Auerbach sich einen großen Ruhm zu seiner Zeit und, wie man hoffen muß, eine dauernde Bedeutung für die Literaturgeschichte erworben hat. Das sind seine Dorfgeschichten. Er hat lange suchen müssen, bis er für diese poetischen Darstellungen einen Verleger fand, und auch nachdem die ersten Geschichten gedruckt worden waren, zeigte sich nicht alsobald der Erfolg; aber nachdem diese Dorfgeschichten in den Verlag des damals ersten deutschen Buchhändlers J. G. Cotta übergegangen waren, wurden sie ein Lieblingsbuch der deutschen Nation und blieben es lange Zeit. Sie wurden viel gelobt, eifrig nachgeahmt, so daß sie eine ganze Richtung begründeten, allerdings auch häufig getadelt. unter den Lobrednern soll nur einer angeführt werden, Ferdinand Freiligrath, aus dessen poetischem Zuruf eine Stelle mitgeteilt werden soll. Der Dichter preist den Freund, daß er es verstanden habe, Erregung, Mitgefühl Lachen hervorzurufen, und fährt fort:
Das aber ist dir alles nur gelungen,
Weil du dem Werk am Leben ließest reifen.
Was aus dem Leben frisch hervorgesprungen,
Wird, wie das Leben selber, auch ergreifen.
Und rechts und links mit Wonne und mit Schmerzen
Sturmschritts erobern warme Menschenherzen.
Daneben hat es freilich auch nicht an Gegnern gefehlt, die modernen Realisten haben den Schweizer Jeremias Gotthelf gegen unsern Schwarzwalderzähler ausgespielt, und dessen naturalistische Darstellung gegenüber den sogenannten Schönfärbereien Auerbachs erhoben.
Solche Vorwürfe sind nur zum geringen Teile begründet. Von einer wirklichen Schönmalerei kann schon aus dem Grunde gar nicht die Rede sein, weil Auerbach die Fehler der Bauern: Eigensinn, Hartköpfigkeit, Kleben am Alten, Roheit, Kleinlichkeit, geistigen Stumpfsinn, blöde Frömmelei, Begehrlichkeit in Liebesdingen, Hinneigung zu verbrecherischen Taten (Brandstiftung) tadelt und auf sie aufmerksam macht. Und ebensowenig kann man es Schönfärbung nennen, sondern eben nur ein Zeugnis dafür, daß der Autor die verschiedenen Seiten betrachtet, wenn er auch herzerhebende Frömmigkeit, treue Liebe zu schildern weiß, die freilich weit entfernt ist von städtischer Courmacherei und nichts von sentimentalem Liebesgeplauder enthält. Er weiß von tüchtigen Arbeitern zu berichten und von der Empfänglichkeit mancher für Neuerungen des Lebens. Oft wird der Streit zwischen Sitte und Sittlichkeit vorgeführt. Es ist bemerkenswert, daß bei ihm ähnlich wie bei Goethe harte Frauen schwächeren Männern gegenüberstehen; wohl möglich, daß er hier gar manchmal sich selbst im Widerstreit mit seiner zweiten Gattin hat vorführen wollen. Gewiß macht sich manchmal ein bißchen Sentimentalität breit, wie in der Schilderung der Frau Professorin oder Barfüßele. Manchmal tritt auch das Symbolische etwas zu stark hervor. Man könnte auch die Lösungen als ungeschickt tadeln, und sie häufig als solche bezeichnen, die mehr von außen hinein, als von innen heraus die Entscheidung bringen. Wenn z. B. Luzian nach dem Kampf mit dem Pfarrer, wofür er von der Obrigkeit mit Gefängnis bestraft wird, in Begleitung der Seinigen nach Amerika auswandert, statt den Kamps wirklich auszufechten, oder wenn im „Lehnhold“ beide Söhne durch Zufälle sterben, so daß schließlich der Knecht Dominik die Erbtochter heiratet und dadurch den Hof erbt, so sind das äußere Lösungen, die keineswegs die höchste Kunst beweisen. Aber wie viele treffliche Charaktere, wie viele bedeutsame kultur-geschichtliche Gedanken! Mit welchem Eifer wird von der Unteilbarkeit der großen Bauerngüter, von Recht und Gerechtigkeit, von Freiheit und Duldung, von wahrer Unmenschlichkeit und echter Liebe gesprochen! Für eine der Prachtgeschichten, die wenig beachtet ist, halte ich die Erzählung „Ein eigen Haus“: ein Maurer heiratet nach langem Brautstande eine Stickerin. Er baut ihr ein Hans auf einsamer Höhe, das aber, da es aus leichtem Grunde erbaut ist, auseinander platzt, zwar gestickt werden kann, aber dem Handwerker in der Heimat seine Existenz ruiniert. Er geht nach Amerika, läßt von dort nichts von sich hören und wird, da er nach Jahren als reicher Mann zurückkehrt, von Frau und Sohn, die sich während seiner Abwesenheit aufs elendeste hatten durchkämpfen müssen, zurückgestoßen. Allmählich erobert er sich die Liebe der Frau wieder zurück. Die Zeichnung der Charaktere, namentlich der der Frau, zuerst in ihrem Stolz, dann in ihrer Verhärtung, endlich in ihrer allmählichen Erweichung, ist ganz vorzüglich gelungen. Aber auch die Helden der übrigen Geschichten sind den älteren unter uns sehr vertraute Wesen, wie liebe Bekannte aus einer frohen Jugendzeit: der Geigerlex, Brosi und Moni, des Schlossbauern Vefele, der Tollpatsch, Befehlerles, Tonerle mit der gebissenen Wange, die Sträflinge, Florian und Kreszenz, das sind alles Gestalten, die dem, der sie einmal wirklich kennen gelernt hat, tief in Sinn und Herz geprägt sind. Es war für Auerbachs Ruhm nicht gut, daß er nach 30 Jahren manche Persönlichkeiten aus diesen Dorfgeschichten wieder aufnahm, neues über sie fabulierte und auch in der Art seiner früheren Dorfgeschichten nochmals zu dichten begann. Zu den Werken letzterer Art reichte seine Kraft nicht mehr aus; außerdem vertragen einmal festbestimmte Persönlichkeiten keine Neugestaltung, aber die Dorfgeschichten der älteren Zeit, der vierziger und fünfziger Jahre, sind Werke ersten Ranges. Rechte Worte zur rechten Zeit, die wirklich verdienen, nicht etwa bloß als bedeutsame Erscheinungen einer vergangenen Epoche geehrt zu werden, sondern als wahrhaft lebendige Schöpfungen in jedem Geschlechte wieder neu zu erstehen.
Derselbe Mann, der als deutscher Schriftsteller die größten Erfolge errang, in mannigfachen Kreisen der besten Gesellschaft verkehrte, in den Fragen allgemeiner Bildung und Politik mehrfach das Wort ergriff, über Goethes Erzählungskunst ernste Worte zu sagen wußte, über allgemeine Fragen, über Erziehung und über Politik sich gern vernehmen ließ, hat nun aber auch eine große Bedeutung als Jude und jüdischer Schriftsteller.
Nicht etwa, daß er im eminenten Sinne des Wortes ein jüdischer Gelehrter gewesen wäre. Gewisse Reminiszenzen von seinem rabbinischen Studium behielt er bei, aber seine talmudische Vorbildung hatte viel zu kurz gedauert, um ihm einen reichen Schatz von Kenntnissen zu gewähren; das forschen, das gründliche und vertiefte ernste Arbeiten war seine Sache nicht. Aber es bleibt höchst anmutig, was er in seinen höheren Jahren, da er dem oft ergriffenen und wieder fallen gelassenen Plan einer Selbstbiographie näher trat, über die Talmudschulen, die er besuchte, und seine Vorbereitung zum Lehrberuf niederschrieb.
Wenn er nun auch kein Forscher wurde, so blieb er infolge dieser Studien anfänglich in seiner ganzen schriftstellerischen Art mit jüdischen Dingen eng verknüpft. Ja, seine ersten Schriften gingen von jüdischen Überzeugungen aus, hatten es durchaus mit jüdischen Gegenständen zu tun.
Von geringer Bedeutung sind die biographischen Skizzen, die Auerbach seinem schon früher existierenden Sammelwerke „Galerie der ausgezeichnetsten Israeliten“ beigab. Es sind ziemlich unbedeutende Zusammenstellungen über Rothschild, Michael Beer und Salomon, und nur der Artikel Rießer ist mit größerer Liebe und reiferem Verständnis gearbeitet.
Von bedeutend größerem Interesse war eine Streitschrift, „Das Judentum und die neuste Literatur“. Stuttgart 1836. Er führte in dieser Schrift zunächst aus, wie töricht der Vorwurf der Gegner sei, daß das „junge Deutschland“ nur aus Juden bestände, mit dem Hinweis darauf, daß die vier Schriftsteller, denen die Versehmung seitens der Regierung galt: Gutzkow, Wienbarg, Laube, Mundt nicht das geringste mit Juden zu tun hätten. Er bekämpfte ferner die Meinung, daß die Anschauungen des jungen Deutschlands durchaus die jüdischen seien, nämlich nur die Herrschaft des bloßen Verstandes bekundeten, und wehrte endlich mit Entschiedenheit den Vorwurf ab, daß die geistigen Eigentümlichkeiten Börnes und Heines, die manchem Deutschfühlenden widerwärtig seien, als jüdische in Anspruch genommen werden könnten und müßten.
„Der moderne Judenfeind predigte den Judenhass nicht wegen der alten Vorwürfe, auch nicht weil Börne und Heine Juden seien und weil überhaupt alle Juden junge Deutschländer sind. Es spricht sich bei ihm ein tiefer Unmut aus, der sich gern Luft machen möchte, und in knabenhaftem Grimme wirft er sich über das vermeintlich Widerstandslose und zerrt es nach Herzenslust in den stagnierenden Pfützen herum, bis endlich sein Mütchen sich gekühlt und er verschämt über seine unverständigen Ausbrüche verendet. Auf die oben hingeworfene Äußerung Menzels hin wird Heine, der ehemals Jude, und Gutzkow, der niemals Jude war, zum Prototyp des Juden gestempelt. Aber wo ist ein Federzug Heines, der dem Judentum an sich angehört, wo ein einziges Wort, das er nicht auch als Christgeborener hätte aussprechen können. Wenn er die Kränze deutscher Bildung der Jetztwelt in sich ausgenommen und sie nach eigener Bildung ausgenommen, soll etwa das Judentum dafür solidarisch haften? Selbst die erbittertsten Feinde der Juden anerkannten ihre Zucht und Sitte und ihre Glaubenstreue. Wenn dies leider nicht mehr so allgemein ist, so haben wir auch über die Verschlimmerungen und Verirrungen der Zeit zu klagen; gleiches Unrecht würde man aber begehen, wenn man dies dem Judentum, wie wenn man es dem Christentum an sich zuschreiben wollte. Gestützt aus das unveränderliche Palladium unseres Glaubens und aus die in der Nation lebende Sitte, streben und hoffen wir, die Verirrungen der Zeit nach Kräften zu heilen. Wir stützen uns auf die in der Nation lebende Sitte, ja, wir achten in dieser deutsche Sitte und deutsches Herz. Denn es ist auch unsere Sitte, unser Herz. Ich lebe der frohen zuversichtlichen Überzeugung, die Gesinnungen der ganzen jungen Generation der Juden auszusprechen, wenn ich hinzufüge, erprobt uns in der Feuertaufe der Gefahr und ihr werdet uns rein finden von allen Schlacken des Egoismus und raffinierter Unsitte. Gebt uns das Vaterland, dem wir durch Geburt, Sitte und Liebe angehören, und treulich legen wir Gut und Blut auf seinen Altar. Vergesset und lehret uns vergessen der finsteren Scheidewand, die uns trennte, und ersparet uns die schmerzliche Mühe, gegen euch in die Schranken zu treten, weil ihr so oft eure vaterländischen Bestrebungen dem Dämon des Judenhasses beigesellt.“
Während die eben besprochene Broschüre, seit ihrem ersten Erscheinen nie wieder aufgelegt, heute ziemlich verschollen ist, wurden zwei große Romane, von dem Dichter frühzeitig bearbeitet, in mehrere Ausgaben seiner Werke aufgenommen, und doch möchte man meinen, daß jene Flugschrift gehaltvoller sei als die beiden großen Werke. Denn der gerechte Beurteiler unseres Dichters wird nicht leugnen können, daß die Romane „Spinoza“ und „Dichter und Kaufmann“ im großen und ganzen verfehlt sind. Sie leiden an gleichen Mängeln: zunächst daran, daß sie nicht imstande sind, eine vergangene Zeit in voller Treue vorzuführen, sodann daran, daß sie die Persönlichkeiten, denen sie gewidmet sind, nicht charakteristisch zu gestalten wissen. Es ist bedauerlich, daß Auerbach, der ein vortrefflicher Spinozakenner war und später eine sehr brauchbare Übersetzung nebst einer unterrichtenden Biographie des Philosophen herausgab, auch nicht den leisesten Versuch machte, den Philosophen in seinem Tempel, in seiner gewaltigen Gedankenwelt, den Späteren darzustellen, sondern sich begnügte, Liebesepisoden der frühesten Zeit und Anekdotisches im bunten Wechsel vorzuführen. Das, was uns hier erscheint, ist nicht das alte Amsterdam, ist nicht das lebendige, vielleicht keineswegs immer erfreuliche Treiben der Juden. Das ist auch nicht der Philosoph, der durch seine Gedankenarbeit Europa erschütterte, sondern ein Gelehrter, der durch seine Geistes-, Glaubens- und Liebeskämpfe herzlich wenig Interesse erregt. Und auch im Ephraim Kuh hören wir mehr von dem alten Breslau und dem damaligen Berlin, als daß wir beide Städte wirklich vor uns sehen. Wie unplastisch sind die Schilderungen der schlesischen Hauptstadt! Wie wenig greifbar tritt hier 8b]der Mendelssohnsche Kreis[/b], in den Ephraim Kuh geführt wurde, vor unsere Blicke, soviel Personen auch genannt und in Gesprächen uns vorgewiesen werden! So wenig das holländische Geistesleben des 17. Jahrhunderts in seiner vielgestaltigen Mannigfaltigkeit vor uns tritt, so wenig lebendig wird uns auch die Aufklärungsepoche mit ihren Mängeln und ihren so großen Vorzügen. Weder der Gegensatz, von dem im Titel des Buches gesprochen wird, der des Idealisten und des Praktikers, noch die widerstreitenden Mächte des Deutschtums und Judentums, die sich damals zu vereinigen trachteten, werden uns in ihrer feindlichen Berührung und in dem Versuche ihrer freundlichen Verbindung irgendwie vertraut. Der neueste Biograph hat streng, aber gerecht geurteilt, wenn er sagt, „die schwächsten Gedichte Kuhs sind ein wahrhaftigerer Ausdruckseiner Persönlichkeit als Auerbachs Gedankensprünge“.
Jene Epoche, in der die beiden jüdischen Romane Auerbachs entstanden, war für ihn eine Zeit des Tastens. Er hatte seine Reise noch nicht erlangt, die Kunstform, die seinem Genius entsprach, noch nicht gesunden, und deshalb wird man es nicht mit übermäßiger Trauer empfinden, daß er den Plan einer größeren Romanfolge, die er unter dem Titel „Das Ghetto“ schreiben wollte, damals nicht aufführen konnte.
Wohl aber wird man innigst bedauern, daß der große deutsche Dichter, zu dem sich Auerbach von den vierziger Jahren entwickelte, seine Pläne nicht vollendete, die sich immer wieder und wieder jüdischen Stoffen zuwandten. Denn hier blieb es nur bei Andeutungen. Man kann gewisserweise in diesem Zusammenhang eine Rede über die Genesis des Nathans, Berlin 1880, aufnehmen, weil hier die Freundschaft zwischen Moses Mendelssohn und Lessing gestreift und die Frage aufgeworfen, wenn auch nicht ganz sachgemäß entschieden wird, inwieweit Mendelssohn das Urbild Nathans ist. Recht hübsch sind die auf Lessing bezüglichen Worte, die man als ein Selbstporträt unseres Dichters auffassen möchte, „stramm aufrichtend wirkt Erinnerung und Anblick eines Mannes von fester Haltung und entschlossenem Ausdruck“, und herrlich sind die Worte, die nach seiner Meinung Nathan, wenn er wieder aufstände, zu den Juden sprechen würde: „Seid zu stolz, euch unglücklich zu denken!“
In der letzten Zeit seines Lebens, in der Auerbach infolge antisemitischer Bestrebungen tiefsten Herzenskummer empfand, erwog er ernstlich jüdische Romanpläne. Er schwankte höchstens über den Titel: Helmut Levy, Baruch Staudegg, Ben Zion; aber schon diese Wahl des Titels hat etwas ungemein Erfreuliches, wie ein deutscher Schriftsteller von seinem Range sich nicht scheute, einem Roman einen durchaus jüdischen Namen vorzusetzen. Der Plan selbst dagegen scheint ihm, wie aus vertraulichen Briefen und Äußerungen in Gesprächen hervorgeht, ganz klar gewesen zu sein. Ähnlich wie er im „Waldfried“ die Entwicklung eines deutschen Geschlechts, so wollte er in diesem jüdischen Roman, durch den er sein Lebenswerk zu krönen gedachte, die Geschichte einer jüdischen Familie in den ereignisschweren Zeiten von 1815—70 darstellen, drei Generationen vorführen: den Helden als Träger jenes Judentums, das sich in Deutschland nicht nur seine leibliche, sondern auch geistige Heimat erkämpft hat, seinen Vater als Vertreter des nationalen, orthodoxen Judentums, seinen Sohn als Vertreter der neuen Zeit, in der ein Gegensatz zwischen deutschem und jüdischem Wesen kaum fühlbar sei. Ob dem greisen Dichter wirklich die Kraft innegewohnt hätte, ein derartiges Werk zu vollenden, wer will es wissen. Aber schon der Gedanke ist schön und die Art, wie die Ausführung des Gedankens ihm vorschwebte, erfüllt unser Herz mit Freude. Und das ist bei Auerbach das Erfreulichste für uns Deutsche jüdischen Glaubens, daß er bei dem vollen Aufgehen in deutsches Leben und deutsches Geistesleben nicht vergaß, daß er ein Jude war. Diese Mischung zwischen Deutschtum und Judentum, dieses pietätvolle Gedenken der Vergangenheit, dieses nichtaufdringliche, sondern mutvolle Bekenntnis der Zugehörigkeit zu der Religionsgemeinschaft, von deren Gebräuchen er sich vollkommen entfernt, deren weltbewegende Gedanken in ihrer Hoheit er aber immer mehr schätzen gelernt hatte, tritt in wundervoller Weise in den schon einmal kurz erwähnten Briefen an seinen Vetter Jakob Auerbach hervor. Diese Briefe sollten wirklich das Hausbuch jüdischer Kreise sein und bleiben. Sie sind nicht bloß eine reiche Quelle für das Anekdotische, für die kleinen und großen Ereignisse aus dem Leben des Dichters, sondern sie sind — und das ist ihr schönster Ruhmestitel — das ehrliche Bekenntnis eines deutschen Juden. Es ist rührend, wie hier der gefeierte Dichter, wenn er von dem Herzog von Koburg als gleichgestellter Gastfreund aufgenommen wird, oder wenn er in den Prunkgemächern der Deutschen Kaiserin als gern gesehener Erzähler und Vorleser weilt, sich mit freudigem Stolze daran erinnert, daß ihm, dem ehemaligen Judenknaben, ein solches Glück zuteil werde. Es ist dieselbe Empfindung, die er im Jahre 1843 seinem Freunde Freiligrath als Dank für sein schönes Gedicht aussprach, daß er jene Wirkung aus die Deutschen gerade deshalb so stolz empfand, weil sie ihm, dem Juden gelungen sei.
Auerbach war ein tiefreligiöser Mensch, er hatte für „Das Landhaus am Rhein“ folgenden Satz niedergeschrieben, strich ihn aber wieder fort: „Die alten Vorstellungen der Religion sind nur zu besiegen durch mehr Religion, nicht durch Unreligion.“ Eine derartige religiöse Überzeugung machte ihn indessen nicht zu einem gläubigen Juden im landläufigen Sinne des Wortes. Er war viel zu viel Spinozist, um sich einem dogmatisch fixierten Glauben hinzugeben. Demgemäss rechnete er es seinem Freunde David Friedrich Strauß, dessen Buch „Der alte und neue Glaube“ er ursprünglich sehr bewunderte, wenn er auch allmählich von dieser Bewunderung zurückkam, sehr hoch an, 8i]„daß die christgeborenen Freigewordenen keine Christen mehr sind und das frei bekennen“[/i]. Im Gegensatze dazu sprach er es aus: „Wir Juden wollen uns aber immer noch als Juden akzentuieren. Ich weiß wohl, man sagt: der Christ hat eine Dogmatik und muß etwas bekennen, wir sind Juden durch die Geschichte und durch die Geburt“.
Seine Anhänglichkeit an das Judentum entstammte also der Pietät und der historischen Erkenntnis, nicht der Gläubigkeit. Damit vertrug sich ganz wohl, daß er für die, denen er durch Geburt und Geschichte angehörte, männlich eintrat, aber er wünschte dieses Eintreten mehr zu einem allgemein menschheitlichen zu machen, als zu einem speziell jüdischen. Daher schlug er z. B. bei der ersten rumänischen Verfolgung nicht ein jüdisches, sondern ein interkonfessionelles Komitee vor, eben weil seiner Meinung nach diese Sache zu einer der Menschheit gemacht werden, nicht eine jüdische bleiben solle. Mit einem solchen Standpunkt vertrug sich ganz wohl, daß er, wie er es einmal bei Jakob Bernays in Bonn tat, mit kindlicher Lust an der Feier des Sederabends teilnahm, oder daß er einmal in Berlin ein Symposion mit jüdischen Gelehrten veranstaltete, die alle aus dem Talmudstudium hervorgegangen waren. Die Vorschriften der Religion beachtete er nicht, die Synagoge betrat er selten, fast nie. Er wurde nur bei besonderen Veranlassungen dort gesehen, z. B. bei der Antrittspredigt meines Vaters in Berlin, wovon er später eine enthusiastische Schilderung gab, oder bei der Konfirmation seiner Kinder und ähnlichen Veranlassungen. Als er einmal den Gottesdienst der Reformgemeinde in Berlin besuchte, schrieb er seinem Vertrauten folgendes: „Eigentlich machte nur das stille Gebet auf mich einen Eindruck, wie da alles lautlos für sich dieselben Worte spricht, das ist eine stille Bindung der Geister, aus der ein tiefer Schauer aufsteigt.“
Aus diesem Grunde beteiligte er sich grundsätzlich nicht an den Angelegenheiten der jüdischen Gemeinde und mischte sich nicht in die lebhaft geführten Streitigkeiten zwischen der liberalen und konservativen Richtung. Seine Sympathie galt der Gesamtheit der Juden, er trat für sie ein, wenn ihre Rechte bekämpft wurden. Er betrachtete sich völlig als Deutscher und empfand es überaus schmerzlich, als im Jahre 1870 ein elsässischer Jude ihm das traurige aber wahre Bekenntnis machte: „Bisher waren wir Franzosen, und jetzt werden wir deutsche Juden.“
Lange Jahre wähnte er, er und seine Glaubensgenossen seien vollkommene Deutsche, die von ihren christlichen Brüdern eben nur durch den Glauben getrennt seien. Er hatte kaum Angriffe und fast niemals Zurücksetzungen zu erleiden. Nur im Jahre 1865 meinte er die Nichtberufung in das Komitee der Schillerstiftung seinem Judentum zuschreiben zu müssen. Sollst war gerade in den Zeiten der nationalen Erhebung, sowohl 1848, als er in der Freiheitserhebung einen vorderen Platz einnahm, als 1859 ff., da er ein Wortführer der deutschnationalen und freiheitlichen Sache war, sein Platz stets unter den Vordersten der Deutschen. Und die hohe Stellung, die ihm in politischen und literarischen Kreisen bereitet wurde, das Lob, das ihm durch die besten deutschen Männer wie Jakob Grimm erteilt ward, die Ehren, die ihm an Fürstenhöfen zuteil wurden, wiegten ihn in den Traum, daß die Juden als vollberechtigte Deutsche gelten, und daß die goldene Zeit der völligen Gleichheit für die Bekenner des Judentums angebrochen sei.
Im Jahre 1868 änderte sich die Sachlage: blutige Verfolgungen gegen die Juden in den östlichen Ländern traten ein; durch diese und durch die übertriebene nationale Empfindlichkeit, eine Wirkung der Kämpfe des Jahres 1870, wurde ein Rückschlag auf Deutschland vorbereitet. Und nun zeigte sich bei Auerbach die innige Empfindung für die Kränkung, die seinen Glaubensgenossen zuteil wurde, regte sich der Mut, für sie aufzutreten. Vielleicht vergriff er sich manchmal in den Mitteln; sein Streben aber war ehrlich und aufrichtig.
Es war nicht wohlgetan, daß er den Privatbrief des Fürsten von Hohenzollern der Öffentlichkeit übergab (April 1868), weil er damit einen groben Vertrauensbruch beging. Aber es war ein Zeugnis seiner redlichen Gesinnung für die Angelegenheit der Verfolgten und Bedrückten.
Und die Sache dieser wußte er auch in der Folge stets zu der seinigen zu machen. Er duldete es nicht, daß Theodor Billroth, der große Mediziner, die Schrift, in der er gegen die jüdischen Ärzte auftrat, ihm, dem deutschen Dichter Berthold Auerbach, zuschickte, um dadurch einen Gegensatz zwischen jenem und seinen Genossen zu statuieren, sondern wendete sich in einem offenen Schreiben an den Verfasser, in dem er das mit Tapferkeit getragene Martyrium der Juden rühmend hervorhob und sich energisch dagegen wehrte, daß der große Mediziner die Juden ins Exil der Fremdheit verbannen, daß er leugnen wollte, daß das Judentum in Deutschland alle Phasen der deutschen Kulturentwicklung mit durchgemacht hätte.
Er wollte es unternehmen, gegen Richard Wagner wegen seiner Broschüre „Das Judentum und die Musik“ polemisch aufzutreten. Er empfand die Schriften Treitschkes als „ein völkerwidriges Explosivgeschoss“, das „ihm das Herz zermarterte“. Mit dem tiefsten Schmerze schrieb er die Worte nieder: „darum also arbeiten wir so lang, um eine solche Barbarei von einem gebildeten ernsthaften Deutschen zu erringen“.
Selbst kleinere Vorgänge ließ er nicht durchgehen. Als in Amerika einmal 1877 ein Gastwirt einen jüdischen Bankier nicht hatte aufnehmen wollen, nahm er diesen kleinen Vorfall als Anlaß zu einer ernstlichen Predigt, die sich freilich auch gegen gewisse Unarten der Juden, hauptsächlich aber gegen die Unduldsamkeit der Christen richtete. Im Jahre 1879 richtete er gegen einen russischen Ritualprozess ein Mahnwort unter dem Titel „Kannibalische Ostern“. 1880 brachte ihm die Judendebatte im deutschen Reichstag den Weheruf auf die Lippen: „Vergebens gelebt und gearbeitet.“
Doch gab es auch Lichtmomente. Ein solcher war der, als er Döllingers Vortrag über die Geschichte der Juden im August 1881 las, das letzte, was er drucken ließ, ist der folgende schöne Dank an den kühnen Katholiken, der für die Juden eingetreten war:
„Sie haben denen, die das Wort von der Religion der Liebe zu lügnerischen Phrasen missbrauchten, Sie haben denen, die den Schaden, welche die deutsche Volksseele erleidet, nicht beachtend in leichtfertiger Frivolität den Fanatismus gewähren ließen und die Judenhetze als einen belebenden Sport betrachteten, Sie haben ihnen allen den Frevelmut ihres Tuns vor Augen gestellt. Sie vollzogen dies entscheidend. Wir deutschen Juden, die wir mit aller Kraft unser deutsches Vaterland lieben und die Mängel und Fehler unserer Angehörigen zu heilen suchen — wir atmen auf. Das danken wir Ihnen. Eine unabsehbare Schar von Christen und Juden reiht sich unter die Fahne, der Sie den Wahlspruch der sophokleischen Antigone gegeben haben: ,Nicht mitzuhassen, mitzulieben bin ich da‘.“
Man kann die letzteren Worte auf Auerbach selbst in höchstem Maße anwenden. Wohl verstand er auch zu hassen, aber der Grundzug seines Wesens war die freudige Empfindung für die Menschen; seine Lust, das Gute in ihnen auszusuchen, war viel größer als das Streben, das Schlechte in ihnen zu bemerken und zu zeigen. Er war neidlos und gut. Er vermied es, wie ich selbst in den vielen Gesprächen bemerkte, die ich mit ihm führen konnte, übel von Jemandem zu reden. Er hatte eine innige Freude daran, andere zu fördern, nicht etwa bloß Arme zu unterstützen, oder die Reichen zur Hilfe für die Dürftigen anzusuchen, sondern jüngere Schriftsteller zu empfehlen, die Nation zur allgemeinen Anerkennung Würdiger zu zwingen, die in ihrer rechten Bedeutung nicht erkannt waren. Die Art, wie er Otto Ludwig verherrlichte, und wie er Gottfried Keller als einer der ersten anerkannte, soll ihm unvergessen bleiben.
Gewiß war er auch nicht frei von menschlichen Schwächen. Seine Sucht Lob zu erhalten, seine Eitelkeit sind sprichwörtlich geworden. Und doch verdienen sie nicht jenen harten Tadel, den sie häufig gefunden haben. Es war etwas Menschliches, man könnte sagen etwas Rührendes dabei. Es war jene herzinnige Freude, daß der arme verachtete Judenknabe zu einem gefeierten, allverehrten Manne sich emporgerungen hatte. Gewiß entlockt es noch heute manchem ein Lächeln, wenn man hört, wie er jüngeren Schriftstellern irgendein gutes Wörtchen mitgab und dabei mit stolzer Gebermiene ausrief: Den Gedanken schenke ich Ihnen. Oder wenn man erfährt, wie er Kinder auf der Straße anredete und sie mit den Worten entließ: „Präge dir ins Gedächtnis, daß Berthold Auerbach mit dir sprach“. Aber in allen solchen und vielen ähnlichen Äußerungen seiner Eitelkeit liegt trotz aller scheinbaren Selbstüberhebung doch etwas Kindliches und Rührendes, das mehr zur menschlichen Teilnahme als zum Spotte zwingt. Er war, wie alle, die ihm nahe standen, freudig bekennen, ein „Herzensmensch“, dem der Mund manchmal überging, dessen Herz aber rein und kindlich war.
Wir scheiden von ihm mit dem Bewußtsein, daß er der unsere ist und bleibt. Er war ein gläubiger Jude, ein überzeugter Deutscher, ein trotz vieler Missgriffe trefflicher Erzähler, ein ausgezeichneter Mensch.
Aber das ist es nicht allein, was ihn uns so lieb und so vertraut macht, noch ein anderes Moment bringt ihn unserem Herzen näher. Viele andere Erzähler aus dem jüdischen Leben sind Pessimisten: sie flüchten sich aus der traurigen Wirklichkeit in die heitere Dichtung. Sie haben trotz des Humors, den sie manchmal beweisen, etwas Griesgrämiges an sich, trotz ihrer Jugend tragen sie eine Altersphysiognomie. Berthold Auerbach dagegen besitzt eine Eigenschaft, die nur wenige seiner Genossen im gleichen Maße an sich haben: er lebt in der Gewißheit vom Siege seiner Überzeugung.
Die Jüngeren, die Auerbach nicht mehr kennen und nicht mehr lesen, erinnern sich bei der Nennung seines Namens vielleicht ausschließlich der Satire, die Fritz Mauthner gegen den Roman „Auf der Höhe“ gerichtet hat. Der Satiriker, der mit ebensoviel Geist wie Bosheit die Schriftsteller vergangener Epochen und seiner eigenen Zeit nachzuahmen verstand, glaubte eine der Hauptfiguren jenes Romans am besten zu zeichnen mit dem Worte: „die taufrische Amme“. Er hat damit ein Schlagwort geprägt, über das der Betroffene sehr erzürnt war, ein Wort, das zur näheren Charakterisierung seines Schaffens später oft genug gebraucht worden ist. Wir wollen das Schmähwort annehmen als Lobeswort, als Ehrentitel. Ja, er war taufrisch wie der junge Morgen mit seiner Herbheit und seiner Kühle, der einen unumwölkten sonnenreichen Tag verkündet.
In grauen Wintertagen, die uns so oft den Sonnenglanz verdunkeln, möge er als der Morgenstern erscheinen, der unserm Wege leuchtet.
Große Künstler lieben es, ihr eigenes Porträt in einem Eckchen figurenreicher Gemälde zu verstecken. Von Goethe sagte Schiller einmal, daß er ihn in einer Nebenperson des Romans Wilhelm Meister, in dem Souffleur wiedererkannt habe. So hat sich auch Auerbach gelegentlich in der Nebenfigur des „Kollaborateurs“ gezeichnet. Die „Tausend Gedanken eines Kollaborators“, ein gedankentiefes Werk, das man rühmen darf, trotz des vielen Gleichgültigen und Abgebrauchten, das darin vorkommt, geben seine Gedankenwelt wieder: sein sinnieren, sein Grübeln, seinen Geistesreichtum, seine Absonderlichkeit. Und so ist auch der Kollaborator, der Begleiter und Freund des Malers (in „Die Frau Professorin“), er selbst mit seinen Schrullen, aber auch mit seiner tiefgründigen Weisheit. Wie er sprach der Dichter: „Es wird mir auch mit der Zeitgeschichte so ergehen, ich winde meine Kränze zu früh für den Einzug des neuen Lebens, die harrenden Blumen verdorren, und am Ende zieht die neue Welt durch ungeschmückte Tore. Sei’s, wenn sie nur kommt.“ Und sein Motto ist der Zuruf, mit dem der Kollaborator den schlafenden Maler aufrüttelt: „Die Sonn' erwacht.“
Hielte ich diesen Vortrag in einem rein literarischen Verein, so würde ich das Phänomen zu untersuchen haben, wodurch es kam, daß ein Schriftsteller, der von 1840—80 ein Lieblingsautor der deutschen Nation war, nicht etwa bloß der Juden, dessen gesammelte Werke in mehreren Ausgaben, dessen Einzelschriften in vielen Editionen, zum Teil in sehr kostbaren, verbreitet waren, bald nach seinem Tode ein vergessener wurde. Selbst die köstliche Briefsammlung, die der Adressat Jakob Auerbach mit einer vortrefflichen Vorrede von Friedrich Spielhagen herausgab (2 Bände 1884), konnte den Verstorbenen nicht wieder lebendig machen, sie wurde von dem Verleger verschleudert und ist seitdem in allen Antiquariatshandlungen für wenige Mark zu erhalten.
Da ich indessen in einem jüdischen Kreise über einen deutschen Schriftsteller jüdischen Glaubensrede, so stelle ich das Jüdische in den Vordergrund und wende dem Allgemeinen nur im geringen Maße meine Aufmerksamkeit zu.
Ganz kurz soll von dem Leben gesprochen werden. Berthold Auerbach ist am 28. Februar 1812 in Nordstetten im Schwarzwald geboren, am 8. Februar 1882 in Cannes gestorben und in seiner Heimat begraben. Er war zuerst in seinem Heimatdorf unterrichtet worden, genoss dann seine Ausbildung in verschiedenen Städten, zunächst in der Absicht Rabbiner zu werden, wandte sich jedoch bald von dem Studium der Theologie zu dem der Jurisprudenz, ohne freilich auch bei diesem Studium auszuharren und seine Universitätsjahre zu einein bestimmten Abschluß zu bringen. Er beteiligte sich an den freiheitlichen Bewegungen, mußte diese Beteiligung durch eine Gefängnisstrafe büßen, und wurde freier Schriftsteller, der lange genug um seine Anerkennung zu kämpfen hatte. Er lebte abwechselnd am Rhein, in Süd-, später in Norddeutschland, heiratete in Breslau siedelte sich dann in Heidelberg an, ging nach Wien, wo er seine zweite Gattin sich holte, lebte längere Zeit in Dresden und seit 1859, freilich mit vielen mehrmonatigen Unterbrechungen, in Berlin.
In der deutschen Literatur hat er sich einen festen Platz erobert durch drei größere Romane, vor allem durch seine Dorfgeschichten.
Sprechen wir von diesen Romanen zuerst. „Auf der Höhe“, 3 Bände 1865; „Ein Landhaus am Rhein“, 5 Bände 1869; „Waldfried“, 3 Bände 1874. Der Roman „Auf der Höhe“ ist ein gutes Buch. Die einzelnen Personen, die Amme Walpurga, die Gräfin Jrma, ihr Vetter Eberhardt, die alte Beate, die Mutter der Walpurga sind trefflich geschildert. Weniger gelungen die Personen aus der Hofsphäre, die zwar dem Dichter keineswegs unbekannt, aber doch nicht so vertraut war, daß er imstande gewesen wäre, sie vollkommen künstlerisch darzustellen. Denn der König leidet an einem gewissen hohlen Pathos, die Königin an einer wenig natürlichen Schwärmerei. Die Intrige ist durchsichtig, die Vorgänge werden geschickt erzählt. Gerade diese Mischung von Dorf- und Hofgeschichten, von Erzählungen aus der kleinen und der großen Welt, wirkt durchaus nicht zerstreuend, sondern belebt und erhöht das Interesse. Gewiß ist es ein Tendenzroman: die Erziehung der Menschen zur Entsagung. Denn die Gräfin Jrma, die eine zeitlang sich einbildete, von dem Könige zur höchsten Stellung erhoben zu werden, flieht, nachdem sie die ehrgeizigen Pläne unterdrückt hat, die eine zeitlang ihr Hirn und ihr Herz beschäftigt hatten. Gerade das, was viele hochgebildete Menschen getadelt haben, daß Jrma nicht in ein Kloster geht, sondern in der Welt ausharrt, um zu büßen und zu bereuen, erscheint wir als ein besonders großartiger Zug. Und auch der Umstand, daß die Königin in ihrem tiefen Schmerz keine geistliche Zusprache wünscht, sondern durch einen spinozistischen Arzt sich und dem Leben wiedergegeben wird, will ich keineswegs als tadelnswert gelten lassen.
So viel Lob man dem ersten Roman auch zollen mag, dem zweiten gegenüber bleibt man recht kühl. Es ist ein buntes Durcheinander, der außerordentlich viele und lange Unterhaltungen über die Neger- und Kirchenfrage, über die Bedeutung und das Wesen der Erziehung, über Menschenwürde, über segensreiche und philanthropische Behandlung der Missetäter, Bürgerstolz, Verachtung des Adels, schädliche Herrschaft des Kapitals usw. enthält. Einen ähnlichen Reichtum wie an Stoffen der Unterhaltung zeigt der Roman auch an Personen, die dazu bestimmt sind, die Reden zu führen: Industrielle, Fürsten, Bauern, Geistliche. Es fehlt dem Dichter doch völlig an der Fähigkeit, die zahllosen Fäden zusammenzuhalten und zu entwirren; auch eine Kenntnis der technischen Berufe, der ökonomischen Grundsätze geht ihm ab. Wir erhalten daher ein außerordentlich langes, aber wenig befriedigendes Gerede über die mannigfachsten Gegenstände, denen man heute nur wenig Interesse mehr abgewinnen kann. Selbst zu der Schilderung des eigentlichen Helden, des Fabrikanten Sonnenkamp, der als eine dämonische Verbrechernatur, als eine titanische Persönlichkeit dargestellt werden sollte, versagt des Dichters Kraft. Ebensowenig ist es ihm gelungen, die Gesellschaft wahrhaft anschaulich darzustellen oder die Landschaft poetisch zu gestalten.
Wie in dem eben erwähnten Roman die mangelhafte Kenntnis der verschiedenen Wissenschaftsgebiete, so tritt im „Waldfried“ die geringe Kenntnis der Geschichte störend hervor. Das Werk sollte in der Art, wie einzelne Romane der zeitgenössischen Autorin Fanny Lewald, die Geschichte eines Geschlechtes von 1817—1870 geben, eine Familie vom Urgroßvater bis zum Urenkel verfolgen: einen altliberalen, nach dem die Geschichte ihren Namen hat, der Burschenschaftler gewesen, 1848 als Mitglied des Parlaments gewirkt, ein guter freisinniger Bürger; neben ihm den älteren Sohn, der 1849 sich an der Revolution beteiligt und nach Amerika geflohen war, und den jüngeren Sohn, der kleinstaatlichen politischen Richtung ergeben, der infolgedessen 1866 sich dem Militärdienst entzogen hatte und später in die algerische Fremdenlegion eingetreten war. Als Mitglieder der Familie sind auch die Schwiegersöhne aufgenommen und ein Offizier und Pfarrer. Es fehlt also nicht an Personen, an Verschiedenheiten oder Abstufung der Gesinnung. Und doch ist das Ganze nicht zu rechter Einheit zusammengeschmolzen. Nicht nur der Umstand, daß der Autor so wenig wie in der Geschichte in dem Getriebe der Politik zu Hause ist, hindert den Genuß, sondern der Mangel einer wirklich plastischen Schilderung, einer lebendigen Vorführung interessanter Begebenheiten. Trotz aller löblichen Tendenz und trotz vieler trefflicher Einzelheiten, die in diesem Buche ebensowenig mangeln wie in den beiden früheren Romanen, kann man es keineswegs als Meisterwerk bezeichnen.
Ganz anders muß das Urteil über die Werke lauten, durch die Berthold Auerbach sich einen großen Ruhm zu seiner Zeit und, wie man hoffen muß, eine dauernde Bedeutung für die Literaturgeschichte erworben hat. Das sind seine Dorfgeschichten. Er hat lange suchen müssen, bis er für diese poetischen Darstellungen einen Verleger fand, und auch nachdem die ersten Geschichten gedruckt worden waren, zeigte sich nicht alsobald der Erfolg; aber nachdem diese Dorfgeschichten in den Verlag des damals ersten deutschen Buchhändlers J. G. Cotta übergegangen waren, wurden sie ein Lieblingsbuch der deutschen Nation und blieben es lange Zeit. Sie wurden viel gelobt, eifrig nachgeahmt, so daß sie eine ganze Richtung begründeten, allerdings auch häufig getadelt. unter den Lobrednern soll nur einer angeführt werden, Ferdinand Freiligrath, aus dessen poetischem Zuruf eine Stelle mitgeteilt werden soll. Der Dichter preist den Freund, daß er es verstanden habe, Erregung, Mitgefühl Lachen hervorzurufen, und fährt fort:
Das aber ist dir alles nur gelungen,
Weil du dem Werk am Leben ließest reifen.
Was aus dem Leben frisch hervorgesprungen,
Wird, wie das Leben selber, auch ergreifen.
Und rechts und links mit Wonne und mit Schmerzen
Sturmschritts erobern warme Menschenherzen.
Daneben hat es freilich auch nicht an Gegnern gefehlt, die modernen Realisten haben den Schweizer Jeremias Gotthelf gegen unsern Schwarzwalderzähler ausgespielt, und dessen naturalistische Darstellung gegenüber den sogenannten Schönfärbereien Auerbachs erhoben.
Solche Vorwürfe sind nur zum geringen Teile begründet. Von einer wirklichen Schönmalerei kann schon aus dem Grunde gar nicht die Rede sein, weil Auerbach die Fehler der Bauern: Eigensinn, Hartköpfigkeit, Kleben am Alten, Roheit, Kleinlichkeit, geistigen Stumpfsinn, blöde Frömmelei, Begehrlichkeit in Liebesdingen, Hinneigung zu verbrecherischen Taten (Brandstiftung) tadelt und auf sie aufmerksam macht. Und ebensowenig kann man es Schönfärbung nennen, sondern eben nur ein Zeugnis dafür, daß der Autor die verschiedenen Seiten betrachtet, wenn er auch herzerhebende Frömmigkeit, treue Liebe zu schildern weiß, die freilich weit entfernt ist von städtischer Courmacherei und nichts von sentimentalem Liebesgeplauder enthält. Er weiß von tüchtigen Arbeitern zu berichten und von der Empfänglichkeit mancher für Neuerungen des Lebens. Oft wird der Streit zwischen Sitte und Sittlichkeit vorgeführt. Es ist bemerkenswert, daß bei ihm ähnlich wie bei Goethe harte Frauen schwächeren Männern gegenüberstehen; wohl möglich, daß er hier gar manchmal sich selbst im Widerstreit mit seiner zweiten Gattin hat vorführen wollen. Gewiß macht sich manchmal ein bißchen Sentimentalität breit, wie in der Schilderung der Frau Professorin oder Barfüßele. Manchmal tritt auch das Symbolische etwas zu stark hervor. Man könnte auch die Lösungen als ungeschickt tadeln, und sie häufig als solche bezeichnen, die mehr von außen hinein, als von innen heraus die Entscheidung bringen. Wenn z. B. Luzian nach dem Kampf mit dem Pfarrer, wofür er von der Obrigkeit mit Gefängnis bestraft wird, in Begleitung der Seinigen nach Amerika auswandert, statt den Kamps wirklich auszufechten, oder wenn im „Lehnhold“ beide Söhne durch Zufälle sterben, so daß schließlich der Knecht Dominik die Erbtochter heiratet und dadurch den Hof erbt, so sind das äußere Lösungen, die keineswegs die höchste Kunst beweisen. Aber wie viele treffliche Charaktere, wie viele bedeutsame kultur-geschichtliche Gedanken! Mit welchem Eifer wird von der Unteilbarkeit der großen Bauerngüter, von Recht und Gerechtigkeit, von Freiheit und Duldung, von wahrer Unmenschlichkeit und echter Liebe gesprochen! Für eine der Prachtgeschichten, die wenig beachtet ist, halte ich die Erzählung „Ein eigen Haus“: ein Maurer heiratet nach langem Brautstande eine Stickerin. Er baut ihr ein Hans auf einsamer Höhe, das aber, da es aus leichtem Grunde erbaut ist, auseinander platzt, zwar gestickt werden kann, aber dem Handwerker in der Heimat seine Existenz ruiniert. Er geht nach Amerika, läßt von dort nichts von sich hören und wird, da er nach Jahren als reicher Mann zurückkehrt, von Frau und Sohn, die sich während seiner Abwesenheit aufs elendeste hatten durchkämpfen müssen, zurückgestoßen. Allmählich erobert er sich die Liebe der Frau wieder zurück. Die Zeichnung der Charaktere, namentlich der der Frau, zuerst in ihrem Stolz, dann in ihrer Verhärtung, endlich in ihrer allmählichen Erweichung, ist ganz vorzüglich gelungen. Aber auch die Helden der übrigen Geschichten sind den älteren unter uns sehr vertraute Wesen, wie liebe Bekannte aus einer frohen Jugendzeit: der Geigerlex, Brosi und Moni, des Schlossbauern Vefele, der Tollpatsch, Befehlerles, Tonerle mit der gebissenen Wange, die Sträflinge, Florian und Kreszenz, das sind alles Gestalten, die dem, der sie einmal wirklich kennen gelernt hat, tief in Sinn und Herz geprägt sind. Es war für Auerbachs Ruhm nicht gut, daß er nach 30 Jahren manche Persönlichkeiten aus diesen Dorfgeschichten wieder aufnahm, neues über sie fabulierte und auch in der Art seiner früheren Dorfgeschichten nochmals zu dichten begann. Zu den Werken letzterer Art reichte seine Kraft nicht mehr aus; außerdem vertragen einmal festbestimmte Persönlichkeiten keine Neugestaltung, aber die Dorfgeschichten der älteren Zeit, der vierziger und fünfziger Jahre, sind Werke ersten Ranges. Rechte Worte zur rechten Zeit, die wirklich verdienen, nicht etwa bloß als bedeutsame Erscheinungen einer vergangenen Epoche geehrt zu werden, sondern als wahrhaft lebendige Schöpfungen in jedem Geschlechte wieder neu zu erstehen.
Derselbe Mann, der als deutscher Schriftsteller die größten Erfolge errang, in mannigfachen Kreisen der besten Gesellschaft verkehrte, in den Fragen allgemeiner Bildung und Politik mehrfach das Wort ergriff, über Goethes Erzählungskunst ernste Worte zu sagen wußte, über allgemeine Fragen, über Erziehung und über Politik sich gern vernehmen ließ, hat nun aber auch eine große Bedeutung als Jude und jüdischer Schriftsteller.
Nicht etwa, daß er im eminenten Sinne des Wortes ein jüdischer Gelehrter gewesen wäre. Gewisse Reminiszenzen von seinem rabbinischen Studium behielt er bei, aber seine talmudische Vorbildung hatte viel zu kurz gedauert, um ihm einen reichen Schatz von Kenntnissen zu gewähren; das forschen, das gründliche und vertiefte ernste Arbeiten war seine Sache nicht. Aber es bleibt höchst anmutig, was er in seinen höheren Jahren, da er dem oft ergriffenen und wieder fallen gelassenen Plan einer Selbstbiographie näher trat, über die Talmudschulen, die er besuchte, und seine Vorbereitung zum Lehrberuf niederschrieb.
Wenn er nun auch kein Forscher wurde, so blieb er infolge dieser Studien anfänglich in seiner ganzen schriftstellerischen Art mit jüdischen Dingen eng verknüpft. Ja, seine ersten Schriften gingen von jüdischen Überzeugungen aus, hatten es durchaus mit jüdischen Gegenständen zu tun.
Von geringer Bedeutung sind die biographischen Skizzen, die Auerbach seinem schon früher existierenden Sammelwerke „Galerie der ausgezeichnetsten Israeliten“ beigab. Es sind ziemlich unbedeutende Zusammenstellungen über Rothschild, Michael Beer und Salomon, und nur der Artikel Rießer ist mit größerer Liebe und reiferem Verständnis gearbeitet.
Von bedeutend größerem Interesse war eine Streitschrift, „Das Judentum und die neuste Literatur“. Stuttgart 1836. Er führte in dieser Schrift zunächst aus, wie töricht der Vorwurf der Gegner sei, daß das „junge Deutschland“ nur aus Juden bestände, mit dem Hinweis darauf, daß die vier Schriftsteller, denen die Versehmung seitens der Regierung galt: Gutzkow, Wienbarg, Laube, Mundt nicht das geringste mit Juden zu tun hätten. Er bekämpfte ferner die Meinung, daß die Anschauungen des jungen Deutschlands durchaus die jüdischen seien, nämlich nur die Herrschaft des bloßen Verstandes bekundeten, und wehrte endlich mit Entschiedenheit den Vorwurf ab, daß die geistigen Eigentümlichkeiten Börnes und Heines, die manchem Deutschfühlenden widerwärtig seien, als jüdische in Anspruch genommen werden könnten und müßten.
„Der moderne Judenfeind predigte den Judenhass nicht wegen der alten Vorwürfe, auch nicht weil Börne und Heine Juden seien und weil überhaupt alle Juden junge Deutschländer sind. Es spricht sich bei ihm ein tiefer Unmut aus, der sich gern Luft machen möchte, und in knabenhaftem Grimme wirft er sich über das vermeintlich Widerstandslose und zerrt es nach Herzenslust in den stagnierenden Pfützen herum, bis endlich sein Mütchen sich gekühlt und er verschämt über seine unverständigen Ausbrüche verendet. Auf die oben hingeworfene Äußerung Menzels hin wird Heine, der ehemals Jude, und Gutzkow, der niemals Jude war, zum Prototyp des Juden gestempelt. Aber wo ist ein Federzug Heines, der dem Judentum an sich angehört, wo ein einziges Wort, das er nicht auch als Christgeborener hätte aussprechen können. Wenn er die Kränze deutscher Bildung der Jetztwelt in sich ausgenommen und sie nach eigener Bildung ausgenommen, soll etwa das Judentum dafür solidarisch haften? Selbst die erbittertsten Feinde der Juden anerkannten ihre Zucht und Sitte und ihre Glaubenstreue. Wenn dies leider nicht mehr so allgemein ist, so haben wir auch über die Verschlimmerungen und Verirrungen der Zeit zu klagen; gleiches Unrecht würde man aber begehen, wenn man dies dem Judentum, wie wenn man es dem Christentum an sich zuschreiben wollte. Gestützt aus das unveränderliche Palladium unseres Glaubens und aus die in der Nation lebende Sitte, streben und hoffen wir, die Verirrungen der Zeit nach Kräften zu heilen. Wir stützen uns auf die in der Nation lebende Sitte, ja, wir achten in dieser deutsche Sitte und deutsches Herz. Denn es ist auch unsere Sitte, unser Herz. Ich lebe der frohen zuversichtlichen Überzeugung, die Gesinnungen der ganzen jungen Generation der Juden auszusprechen, wenn ich hinzufüge, erprobt uns in der Feuertaufe der Gefahr und ihr werdet uns rein finden von allen Schlacken des Egoismus und raffinierter Unsitte. Gebt uns das Vaterland, dem wir durch Geburt, Sitte und Liebe angehören, und treulich legen wir Gut und Blut auf seinen Altar. Vergesset und lehret uns vergessen der finsteren Scheidewand, die uns trennte, und ersparet uns die schmerzliche Mühe, gegen euch in die Schranken zu treten, weil ihr so oft eure vaterländischen Bestrebungen dem Dämon des Judenhasses beigesellt.“
Während die eben besprochene Broschüre, seit ihrem ersten Erscheinen nie wieder aufgelegt, heute ziemlich verschollen ist, wurden zwei große Romane, von dem Dichter frühzeitig bearbeitet, in mehrere Ausgaben seiner Werke aufgenommen, und doch möchte man meinen, daß jene Flugschrift gehaltvoller sei als die beiden großen Werke. Denn der gerechte Beurteiler unseres Dichters wird nicht leugnen können, daß die Romane „Spinoza“ und „Dichter und Kaufmann“ im großen und ganzen verfehlt sind. Sie leiden an gleichen Mängeln: zunächst daran, daß sie nicht imstande sind, eine vergangene Zeit in voller Treue vorzuführen, sodann daran, daß sie die Persönlichkeiten, denen sie gewidmet sind, nicht charakteristisch zu gestalten wissen. Es ist bedauerlich, daß Auerbach, der ein vortrefflicher Spinozakenner war und später eine sehr brauchbare Übersetzung nebst einer unterrichtenden Biographie des Philosophen herausgab, auch nicht den leisesten Versuch machte, den Philosophen in seinem Tempel, in seiner gewaltigen Gedankenwelt, den Späteren darzustellen, sondern sich begnügte, Liebesepisoden der frühesten Zeit und Anekdotisches im bunten Wechsel vorzuführen. Das, was uns hier erscheint, ist nicht das alte Amsterdam, ist nicht das lebendige, vielleicht keineswegs immer erfreuliche Treiben der Juden. Das ist auch nicht der Philosoph, der durch seine Gedankenarbeit Europa erschütterte, sondern ein Gelehrter, der durch seine Geistes-, Glaubens- und Liebeskämpfe herzlich wenig Interesse erregt. Und auch im Ephraim Kuh hören wir mehr von dem alten Breslau und dem damaligen Berlin, als daß wir beide Städte wirklich vor uns sehen. Wie unplastisch sind die Schilderungen der schlesischen Hauptstadt! Wie wenig greifbar tritt hier 8b]der Mendelssohnsche Kreis[/b], in den Ephraim Kuh geführt wurde, vor unsere Blicke, soviel Personen auch genannt und in Gesprächen uns vorgewiesen werden! So wenig das holländische Geistesleben des 17. Jahrhunderts in seiner vielgestaltigen Mannigfaltigkeit vor uns tritt, so wenig lebendig wird uns auch die Aufklärungsepoche mit ihren Mängeln und ihren so großen Vorzügen. Weder der Gegensatz, von dem im Titel des Buches gesprochen wird, der des Idealisten und des Praktikers, noch die widerstreitenden Mächte des Deutschtums und Judentums, die sich damals zu vereinigen trachteten, werden uns in ihrer feindlichen Berührung und in dem Versuche ihrer freundlichen Verbindung irgendwie vertraut. Der neueste Biograph hat streng, aber gerecht geurteilt, wenn er sagt, „die schwächsten Gedichte Kuhs sind ein wahrhaftigerer Ausdruckseiner Persönlichkeit als Auerbachs Gedankensprünge“.
Jene Epoche, in der die beiden jüdischen Romane Auerbachs entstanden, war für ihn eine Zeit des Tastens. Er hatte seine Reise noch nicht erlangt, die Kunstform, die seinem Genius entsprach, noch nicht gesunden, und deshalb wird man es nicht mit übermäßiger Trauer empfinden, daß er den Plan einer größeren Romanfolge, die er unter dem Titel „Das Ghetto“ schreiben wollte, damals nicht aufführen konnte.
Wohl aber wird man innigst bedauern, daß der große deutsche Dichter, zu dem sich Auerbach von den vierziger Jahren entwickelte, seine Pläne nicht vollendete, die sich immer wieder und wieder jüdischen Stoffen zuwandten. Denn hier blieb es nur bei Andeutungen. Man kann gewisserweise in diesem Zusammenhang eine Rede über die Genesis des Nathans, Berlin 1880, aufnehmen, weil hier die Freundschaft zwischen Moses Mendelssohn und Lessing gestreift und die Frage aufgeworfen, wenn auch nicht ganz sachgemäß entschieden wird, inwieweit Mendelssohn das Urbild Nathans ist. Recht hübsch sind die auf Lessing bezüglichen Worte, die man als ein Selbstporträt unseres Dichters auffassen möchte, „stramm aufrichtend wirkt Erinnerung und Anblick eines Mannes von fester Haltung und entschlossenem Ausdruck“, und herrlich sind die Worte, die nach seiner Meinung Nathan, wenn er wieder aufstände, zu den Juden sprechen würde: „Seid zu stolz, euch unglücklich zu denken!“
In der letzten Zeit seines Lebens, in der Auerbach infolge antisemitischer Bestrebungen tiefsten Herzenskummer empfand, erwog er ernstlich jüdische Romanpläne. Er schwankte höchstens über den Titel: Helmut Levy, Baruch Staudegg, Ben Zion; aber schon diese Wahl des Titels hat etwas ungemein Erfreuliches, wie ein deutscher Schriftsteller von seinem Range sich nicht scheute, einem Roman einen durchaus jüdischen Namen vorzusetzen. Der Plan selbst dagegen scheint ihm, wie aus vertraulichen Briefen und Äußerungen in Gesprächen hervorgeht, ganz klar gewesen zu sein. Ähnlich wie er im „Waldfried“ die Entwicklung eines deutschen Geschlechts, so wollte er in diesem jüdischen Roman, durch den er sein Lebenswerk zu krönen gedachte, die Geschichte einer jüdischen Familie in den ereignisschweren Zeiten von 1815—70 darstellen, drei Generationen vorführen: den Helden als Träger jenes Judentums, das sich in Deutschland nicht nur seine leibliche, sondern auch geistige Heimat erkämpft hat, seinen Vater als Vertreter des nationalen, orthodoxen Judentums, seinen Sohn als Vertreter der neuen Zeit, in der ein Gegensatz zwischen deutschem und jüdischem Wesen kaum fühlbar sei. Ob dem greisen Dichter wirklich die Kraft innegewohnt hätte, ein derartiges Werk zu vollenden, wer will es wissen. Aber schon der Gedanke ist schön und die Art, wie die Ausführung des Gedankens ihm vorschwebte, erfüllt unser Herz mit Freude. Und das ist bei Auerbach das Erfreulichste für uns Deutsche jüdischen Glaubens, daß er bei dem vollen Aufgehen in deutsches Leben und deutsches Geistesleben nicht vergaß, daß er ein Jude war. Diese Mischung zwischen Deutschtum und Judentum, dieses pietätvolle Gedenken der Vergangenheit, dieses nichtaufdringliche, sondern mutvolle Bekenntnis der Zugehörigkeit zu der Religionsgemeinschaft, von deren Gebräuchen er sich vollkommen entfernt, deren weltbewegende Gedanken in ihrer Hoheit er aber immer mehr schätzen gelernt hatte, tritt in wundervoller Weise in den schon einmal kurz erwähnten Briefen an seinen Vetter Jakob Auerbach hervor. Diese Briefe sollten wirklich das Hausbuch jüdischer Kreise sein und bleiben. Sie sind nicht bloß eine reiche Quelle für das Anekdotische, für die kleinen und großen Ereignisse aus dem Leben des Dichters, sondern sie sind — und das ist ihr schönster Ruhmestitel — das ehrliche Bekenntnis eines deutschen Juden. Es ist rührend, wie hier der gefeierte Dichter, wenn er von dem Herzog von Koburg als gleichgestellter Gastfreund aufgenommen wird, oder wenn er in den Prunkgemächern der Deutschen Kaiserin als gern gesehener Erzähler und Vorleser weilt, sich mit freudigem Stolze daran erinnert, daß ihm, dem ehemaligen Judenknaben, ein solches Glück zuteil werde. Es ist dieselbe Empfindung, die er im Jahre 1843 seinem Freunde Freiligrath als Dank für sein schönes Gedicht aussprach, daß er jene Wirkung aus die Deutschen gerade deshalb so stolz empfand, weil sie ihm, dem Juden gelungen sei.
Auerbach war ein tiefreligiöser Mensch, er hatte für „Das Landhaus am Rhein“ folgenden Satz niedergeschrieben, strich ihn aber wieder fort: „Die alten Vorstellungen der Religion sind nur zu besiegen durch mehr Religion, nicht durch Unreligion.“ Eine derartige religiöse Überzeugung machte ihn indessen nicht zu einem gläubigen Juden im landläufigen Sinne des Wortes. Er war viel zu viel Spinozist, um sich einem dogmatisch fixierten Glauben hinzugeben. Demgemäss rechnete er es seinem Freunde David Friedrich Strauß, dessen Buch „Der alte und neue Glaube“ er ursprünglich sehr bewunderte, wenn er auch allmählich von dieser Bewunderung zurückkam, sehr hoch an, 8i]„daß die christgeborenen Freigewordenen keine Christen mehr sind und das frei bekennen“[/i]. Im Gegensatze dazu sprach er es aus: „Wir Juden wollen uns aber immer noch als Juden akzentuieren. Ich weiß wohl, man sagt: der Christ hat eine Dogmatik und muß etwas bekennen, wir sind Juden durch die Geschichte und durch die Geburt“.
Seine Anhänglichkeit an das Judentum entstammte also der Pietät und der historischen Erkenntnis, nicht der Gläubigkeit. Damit vertrug sich ganz wohl, daß er für die, denen er durch Geburt und Geschichte angehörte, männlich eintrat, aber er wünschte dieses Eintreten mehr zu einem allgemein menschheitlichen zu machen, als zu einem speziell jüdischen. Daher schlug er z. B. bei der ersten rumänischen Verfolgung nicht ein jüdisches, sondern ein interkonfessionelles Komitee vor, eben weil seiner Meinung nach diese Sache zu einer der Menschheit gemacht werden, nicht eine jüdische bleiben solle. Mit einem solchen Standpunkt vertrug sich ganz wohl, daß er, wie er es einmal bei Jakob Bernays in Bonn tat, mit kindlicher Lust an der Feier des Sederabends teilnahm, oder daß er einmal in Berlin ein Symposion mit jüdischen Gelehrten veranstaltete, die alle aus dem Talmudstudium hervorgegangen waren. Die Vorschriften der Religion beachtete er nicht, die Synagoge betrat er selten, fast nie. Er wurde nur bei besonderen Veranlassungen dort gesehen, z. B. bei der Antrittspredigt meines Vaters in Berlin, wovon er später eine enthusiastische Schilderung gab, oder bei der Konfirmation seiner Kinder und ähnlichen Veranlassungen. Als er einmal den Gottesdienst der Reformgemeinde in Berlin besuchte, schrieb er seinem Vertrauten folgendes: „Eigentlich machte nur das stille Gebet auf mich einen Eindruck, wie da alles lautlos für sich dieselben Worte spricht, das ist eine stille Bindung der Geister, aus der ein tiefer Schauer aufsteigt.“
Aus diesem Grunde beteiligte er sich grundsätzlich nicht an den Angelegenheiten der jüdischen Gemeinde und mischte sich nicht in die lebhaft geführten Streitigkeiten zwischen der liberalen und konservativen Richtung. Seine Sympathie galt der Gesamtheit der Juden, er trat für sie ein, wenn ihre Rechte bekämpft wurden. Er betrachtete sich völlig als Deutscher und empfand es überaus schmerzlich, als im Jahre 1870 ein elsässischer Jude ihm das traurige aber wahre Bekenntnis machte: „Bisher waren wir Franzosen, und jetzt werden wir deutsche Juden.“
Lange Jahre wähnte er, er und seine Glaubensgenossen seien vollkommene Deutsche, die von ihren christlichen Brüdern eben nur durch den Glauben getrennt seien. Er hatte kaum Angriffe und fast niemals Zurücksetzungen zu erleiden. Nur im Jahre 1865 meinte er die Nichtberufung in das Komitee der Schillerstiftung seinem Judentum zuschreiben zu müssen. Sollst war gerade in den Zeiten der nationalen Erhebung, sowohl 1848, als er in der Freiheitserhebung einen vorderen Platz einnahm, als 1859 ff., da er ein Wortführer der deutschnationalen und freiheitlichen Sache war, sein Platz stets unter den Vordersten der Deutschen. Und die hohe Stellung, die ihm in politischen und literarischen Kreisen bereitet wurde, das Lob, das ihm durch die besten deutschen Männer wie Jakob Grimm erteilt ward, die Ehren, die ihm an Fürstenhöfen zuteil wurden, wiegten ihn in den Traum, daß die Juden als vollberechtigte Deutsche gelten, und daß die goldene Zeit der völligen Gleichheit für die Bekenner des Judentums angebrochen sei.
Im Jahre 1868 änderte sich die Sachlage: blutige Verfolgungen gegen die Juden in den östlichen Ländern traten ein; durch diese und durch die übertriebene nationale Empfindlichkeit, eine Wirkung der Kämpfe des Jahres 1870, wurde ein Rückschlag auf Deutschland vorbereitet. Und nun zeigte sich bei Auerbach die innige Empfindung für die Kränkung, die seinen Glaubensgenossen zuteil wurde, regte sich der Mut, für sie aufzutreten. Vielleicht vergriff er sich manchmal in den Mitteln; sein Streben aber war ehrlich und aufrichtig.
Es war nicht wohlgetan, daß er den Privatbrief des Fürsten von Hohenzollern der Öffentlichkeit übergab (April 1868), weil er damit einen groben Vertrauensbruch beging. Aber es war ein Zeugnis seiner redlichen Gesinnung für die Angelegenheit der Verfolgten und Bedrückten.
Und die Sache dieser wußte er auch in der Folge stets zu der seinigen zu machen. Er duldete es nicht, daß Theodor Billroth, der große Mediziner, die Schrift, in der er gegen die jüdischen Ärzte auftrat, ihm, dem deutschen Dichter Berthold Auerbach, zuschickte, um dadurch einen Gegensatz zwischen jenem und seinen Genossen zu statuieren, sondern wendete sich in einem offenen Schreiben an den Verfasser, in dem er das mit Tapferkeit getragene Martyrium der Juden rühmend hervorhob und sich energisch dagegen wehrte, daß der große Mediziner die Juden ins Exil der Fremdheit verbannen, daß er leugnen wollte, daß das Judentum in Deutschland alle Phasen der deutschen Kulturentwicklung mit durchgemacht hätte.
Er wollte es unternehmen, gegen Richard Wagner wegen seiner Broschüre „Das Judentum und die Musik“ polemisch aufzutreten. Er empfand die Schriften Treitschkes als „ein völkerwidriges Explosivgeschoss“, das „ihm das Herz zermarterte“. Mit dem tiefsten Schmerze schrieb er die Worte nieder: „darum also arbeiten wir so lang, um eine solche Barbarei von einem gebildeten ernsthaften Deutschen zu erringen“.
Selbst kleinere Vorgänge ließ er nicht durchgehen. Als in Amerika einmal 1877 ein Gastwirt einen jüdischen Bankier nicht hatte aufnehmen wollen, nahm er diesen kleinen Vorfall als Anlaß zu einer ernstlichen Predigt, die sich freilich auch gegen gewisse Unarten der Juden, hauptsächlich aber gegen die Unduldsamkeit der Christen richtete. Im Jahre 1879 richtete er gegen einen russischen Ritualprozess ein Mahnwort unter dem Titel „Kannibalische Ostern“. 1880 brachte ihm die Judendebatte im deutschen Reichstag den Weheruf auf die Lippen: „Vergebens gelebt und gearbeitet.“
Doch gab es auch Lichtmomente. Ein solcher war der, als er Döllingers Vortrag über die Geschichte der Juden im August 1881 las, das letzte, was er drucken ließ, ist der folgende schöne Dank an den kühnen Katholiken, der für die Juden eingetreten war:
„Sie haben denen, die das Wort von der Religion der Liebe zu lügnerischen Phrasen missbrauchten, Sie haben denen, die den Schaden, welche die deutsche Volksseele erleidet, nicht beachtend in leichtfertiger Frivolität den Fanatismus gewähren ließen und die Judenhetze als einen belebenden Sport betrachteten, Sie haben ihnen allen den Frevelmut ihres Tuns vor Augen gestellt. Sie vollzogen dies entscheidend. Wir deutschen Juden, die wir mit aller Kraft unser deutsches Vaterland lieben und die Mängel und Fehler unserer Angehörigen zu heilen suchen — wir atmen auf. Das danken wir Ihnen. Eine unabsehbare Schar von Christen und Juden reiht sich unter die Fahne, der Sie den Wahlspruch der sophokleischen Antigone gegeben haben: ,Nicht mitzuhassen, mitzulieben bin ich da‘.“
Man kann die letzteren Worte auf Auerbach selbst in höchstem Maße anwenden. Wohl verstand er auch zu hassen, aber der Grundzug seines Wesens war die freudige Empfindung für die Menschen; seine Lust, das Gute in ihnen auszusuchen, war viel größer als das Streben, das Schlechte in ihnen zu bemerken und zu zeigen. Er war neidlos und gut. Er vermied es, wie ich selbst in den vielen Gesprächen bemerkte, die ich mit ihm führen konnte, übel von Jemandem zu reden. Er hatte eine innige Freude daran, andere zu fördern, nicht etwa bloß Arme zu unterstützen, oder die Reichen zur Hilfe für die Dürftigen anzusuchen, sondern jüngere Schriftsteller zu empfehlen, die Nation zur allgemeinen Anerkennung Würdiger zu zwingen, die in ihrer rechten Bedeutung nicht erkannt waren. Die Art, wie er Otto Ludwig verherrlichte, und wie er Gottfried Keller als einer der ersten anerkannte, soll ihm unvergessen bleiben.
Gewiß war er auch nicht frei von menschlichen Schwächen. Seine Sucht Lob zu erhalten, seine Eitelkeit sind sprichwörtlich geworden. Und doch verdienen sie nicht jenen harten Tadel, den sie häufig gefunden haben. Es war etwas Menschliches, man könnte sagen etwas Rührendes dabei. Es war jene herzinnige Freude, daß der arme verachtete Judenknabe zu einem gefeierten, allverehrten Manne sich emporgerungen hatte. Gewiß entlockt es noch heute manchem ein Lächeln, wenn man hört, wie er jüngeren Schriftstellern irgendein gutes Wörtchen mitgab und dabei mit stolzer Gebermiene ausrief: Den Gedanken schenke ich Ihnen. Oder wenn man erfährt, wie er Kinder auf der Straße anredete und sie mit den Worten entließ: „Präge dir ins Gedächtnis, daß Berthold Auerbach mit dir sprach“. Aber in allen solchen und vielen ähnlichen Äußerungen seiner Eitelkeit liegt trotz aller scheinbaren Selbstüberhebung doch etwas Kindliches und Rührendes, das mehr zur menschlichen Teilnahme als zum Spotte zwingt. Er war, wie alle, die ihm nahe standen, freudig bekennen, ein „Herzensmensch“, dem der Mund manchmal überging, dessen Herz aber rein und kindlich war.
Wir scheiden von ihm mit dem Bewußtsein, daß er der unsere ist und bleibt. Er war ein gläubiger Jude, ein überzeugter Deutscher, ein trotz vieler Missgriffe trefflicher Erzähler, ein ausgezeichneter Mensch.
Aber das ist es nicht allein, was ihn uns so lieb und so vertraut macht, noch ein anderes Moment bringt ihn unserem Herzen näher. Viele andere Erzähler aus dem jüdischen Leben sind Pessimisten: sie flüchten sich aus der traurigen Wirklichkeit in die heitere Dichtung. Sie haben trotz des Humors, den sie manchmal beweisen, etwas Griesgrämiges an sich, trotz ihrer Jugend tragen sie eine Altersphysiognomie. Berthold Auerbach dagegen besitzt eine Eigenschaft, die nur wenige seiner Genossen im gleichen Maße an sich haben: er lebt in der Gewißheit vom Siege seiner Überzeugung.
Die Jüngeren, die Auerbach nicht mehr kennen und nicht mehr lesen, erinnern sich bei der Nennung seines Namens vielleicht ausschließlich der Satire, die Fritz Mauthner gegen den Roman „Auf der Höhe“ gerichtet hat. Der Satiriker, der mit ebensoviel Geist wie Bosheit die Schriftsteller vergangener Epochen und seiner eigenen Zeit nachzuahmen verstand, glaubte eine der Hauptfiguren jenes Romans am besten zu zeichnen mit dem Worte: „die taufrische Amme“. Er hat damit ein Schlagwort geprägt, über das der Betroffene sehr erzürnt war, ein Wort, das zur näheren Charakterisierung seines Schaffens später oft genug gebraucht worden ist. Wir wollen das Schmähwort annehmen als Lobeswort, als Ehrentitel. Ja, er war taufrisch wie der junge Morgen mit seiner Herbheit und seiner Kühle, der einen unumwölkten sonnenreichen Tag verkündet.
In grauen Wintertagen, die uns so oft den Sonnenglanz verdunkeln, möge er als der Morgenstern erscheinen, der unserm Wege leuchtet.
Große Künstler lieben es, ihr eigenes Porträt in einem Eckchen figurenreicher Gemälde zu verstecken. Von Goethe sagte Schiller einmal, daß er ihn in einer Nebenperson des Romans Wilhelm Meister, in dem Souffleur wiedererkannt habe. So hat sich auch Auerbach gelegentlich in der Nebenfigur des „Kollaborateurs“ gezeichnet. Die „Tausend Gedanken eines Kollaborators“, ein gedankentiefes Werk, das man rühmen darf, trotz des vielen Gleichgültigen und Abgebrauchten, das darin vorkommt, geben seine Gedankenwelt wieder: sein sinnieren, sein Grübeln, seinen Geistesreichtum, seine Absonderlichkeit. Und so ist auch der Kollaborator, der Begleiter und Freund des Malers (in „Die Frau Professorin“), er selbst mit seinen Schrullen, aber auch mit seiner tiefgründigen Weisheit. Wie er sprach der Dichter: „Es wird mir auch mit der Zeitgeschichte so ergehen, ich winde meine Kränze zu früh für den Einzug des neuen Lebens, die harrenden Blumen verdorren, und am Ende zieht die neue Welt durch ungeschmückte Tore. Sei’s, wenn sie nur kommt.“ Und sein Motto ist der Zuruf, mit dem der Kollaborator den schlafenden Maler aufrüttelt: „Die Sonn' erwacht.“
Dieses Kapitel ist Teil des Buches Die Deutsche Literatur und die Juden

Bertold Auerbach lebte längere Zeit in Wien


Gebrüder Jacob (1785-1863) und Wilhelm Karl Grimm (1786-1859)

Dresden war einer der Lieblingsstädte von Auerbach

Johann Friedrich von Cotta (1764-1832), deutscher Verleger und Poliker

Auerbach heiratete in Breslau

Ludwig Börne (1786-1837), deutscher Journalist und Literaturkritiker
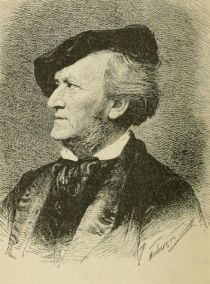
Richard Wagner (1813-1883), deutscher Komponist, Dramatiker und Schriftsteller

Die Karlskirche in Wien
alle Kapitel sehen