Der Roman des Entwurzelten (Georg Hermann) von Hans Kohn
Der Roman des Entwurzelten (Georg Hermann)
Die Nacht des Dr. Herzfeld
von Hans Kohn
„Man denkt, wenn man glaubt, ohne Glauben ist kein Denken: nur, wer Glauben hat, hat Denken. Den Glauben muß man also suchen zu erkennen!“
„Den Glauben, o Herr, möchte ich erkennen!“
„Man glaubt, wenn man in etwas gewurzelt ist: ohne Gewurzeltsein ist kein Glaube: wer in etwas gewurzelt, der glaubt daran. Wurzelung also muß man suchen zu erkennen!“ „Die Wurzelung o Herr, möchte ich erkennen!“ „Man ist in etwas gewurzelt, wenn man schafft: ohne Schaffen ist kein Gewurzeltsein; nur wer etwas schafft, ist darin gewurzelt. Das Schaffen also muß man suchen zu erkennen.“
Chândogya-Upanischad 719 — 21.
(Paul Deussen: Sechzig-Upanischads. Brockhaus, Leipzig 1905, 2. A. S. 184.)
Die Nacht hat seit alters her etwas Beunruhigendes in sich. Da erwachen Stimmen, die man bei Tage nie gehört hat, der Blick verliert sich in undurchdringlicher Ferne, in die er auch das Gemüt lockt, die Grenzen verwischen sich, und der chaotische Urstrom der Dinge gleitet wieder über die Welt. Und auch den Menschen lockt es in der Nacht über sich hinaus und in sich hinein. Man hält Zwiesprache mit sich und schlichtet und sichtet; lange Gelebtes steht wieder auf, die Stunde der Abrechnung bricht an, und aus der Einsamkeit der Kreatur und den Verschlingungen der Großstadt reift das Erlebnis.
Georg Hermann hat in seinem Jettchen Gebert ein Kunstwerk gegeben, das wie Thomas Manns Buddenbrocks einen Ausschnitt der Welt in seiner Breite, in der vielfältigen Hingesponnenheit der bunten Schicksale gestaltet hat. Die Nacht des Dr. Herzfeld ist mehr eine Novelle, denn ein Roman; in die Kürze einer einzigen Nacht, in wenige Gestalten wird hier eine Fülle Lebens gepresst, daß es fast unheimlich ist, und daß einem der Rahmen zu schwach dünkt, diesen Druck auszuhalten. Man wünschte oft mehr Raum, vor allem mehr Zeit. Man bewundert diese atemlose Kunst des Dichtens, des Verdichtens, und wird doch des bangen Gefühls nicht frei, daß diese „Nacht der Nächte“ über das ganze Lehen so mancher Menschen entscheidet, uns die sonst verschlossenen Pforten zu ihrem ängstlich gehüteten innersten Leben wie mit einem Zauberschlüssel aufschließt und uns in der Fülle des Erschlossenen der bleiche dämmernde Tag etwas hilflos antrifft. Man hatte in Jettchen Gebert mehr Boden unter den Füßen, weitere Horizonte, festere Linien. Aber diesmal geht die Reise tiefer, als in dem Roman der Berlinerin des Biedermeiers, geht die Reise in unbekanntere Fernen, in verborgenere Tiefen, und da ist es verständlich, wenn uns manchmal die Bangigkeit anfällt, die an allem Fremden, Ungewöhnlichen haftet, und die doch, wie alle Fernen, lockt und anzieht.
Jahrelang gehen die Menschen umher, nebeneinander, sprechen und handeln, und bleiben einander doch fremd und kennen sich selbst nicht. Und wenn sie klug sind, durchschauen sie die Vergänglichkeit und Flüchtigkeit alles Tuns und alles Geschehens, wie alles fließt und doch in all dem Flusse sich nichts ändert, und wie bei all dem der Mensch einsam dabei steht, unverstanden von allen und kaum das Wesen des anderen verstehend. Und es fröstelt dem Menschen bei dieser Einsamkeit, und er schreit nach dem Gefährten. Und doch hütet der Mensch ängstlich diese Einsamkeit, denn sie ist zugleich eine Schutzwehr, eine schützende Mauer um ihn, die ihm Ruhe gibt und die Trägheit seines Herzens nicht gefährdet; denn schlüge er Bresche in diese Mauer, so wagte er sich auf wilde, stürmische See, voll unbekannter Gefahren und tückischer Abgründe, voll neuen, scharfen Lichtes, daß all die Bauten und Schranken, die er zu seiner Sicherung in sich aufgeführt hatte, brechen, voll Verantwortung und Mühsal, die alle Ruhe für immer verscheuchen würde. Und so bleibt der Mensch in seiner Einsamkeit, aus der er doch hinaus will, an der er leidet: und das macht die Welt für ihn so wehmütig, und er wird ein Wissender, der sein Wissen in Schwermut und Weltschmerz trägt, und dessen Erhebung über sich nur darin besteht, daß er mit seinem Weltschmerz und seiner Schwermut spielt. Die Schranke, die er anderen gegenüber wahrt, die wahrt er auch sich selbst gegenüber; es fehlt ihm auch der Mut, sich selbst zu erforschen, sein eigenes Innere voll Vertrauen, voll tätiger Liebe und freudiger Verantwortung hervorquillen zu lassen. Er analysiert sich viel, grübelt über sich in den langen Stunden seiner durch keine Tätigkeit von außen her oder für das Außen abgelenkten Muße, aber es ist nur die Oberfläche, in die er sich wagt, Stimmungen der Stunde, Trübungen des Tages, Freudigkeiten des Zufalls, es ist nur das Fleisch, das sich um seine Seele schließt und sie schützt, das er durchforscht (man hat richtig von Selbstzerfleischung gesprochen), die Seele aber bleibt ihm unbetretbar, sein Geist, wie er aus der Fülle des Geschichtlichen hervorgewachsen zu seiner Eigenart, bleibt ihm fremd. So scheut der Mensch die Reise. Bis einmal Stunden kommen, wo gleichsam ein Sturmwind die Fluten hochpeitscht und sie anstürmen läßt gegen die sorgsam gehüteten Dämme, bis sie nachgeben und brechen. Und ungehütet steht der Mensch da, schutzlos preisgegeben dem Wüten urelementarer Kräfte, und er hört die Stimmen seines Lebens und vergleicht die Taten seines Wandelns und findet sie leer und nichtig. Und er besinnt sich auf die Stimme, die einst auch sein Leben berufen hat zu seiner Aufgabe. Es geht ihm gleich dem greisen Peer Gynt, dem im Herbstwinde wirbelnde welke Blätter Worte werden, die er hätte künden sollen, und das Rauschen in der Luft Lieder, die seiner Verkündigung geharrt, Tautropfen an den Zweigen Tränen und Erschütterungen, denen er ausgewichen ist, und die geknickten Halme auf dem Wege ungeschehene Werke, die er versäumt hat. Nur daß er weiser ist und nicht erst des Knopfgießers bedarf, der es ihn lehre, was des Menschen Leben ausmacht: „des Meisters Willen als wie ein Schild, an seines Lebensschwerts Griff sich löten“, der Berufung zu folgen, die an jeden Menschen ertönt. Aber dazu traute er sich nie weit genug zu reisen, um die Bestimmung der Ferne zu ahnen, und jetzt ist es zu spät. Der Berufung und ihrer unerbittlichen Strenge kann er nicht mehr folgen; die Ruhe und Trägheit der Sicherheit ist ihm zu teuer, seine Lebenslügen zu sehr Lebensbedürfnis, das neue Licht zu grell, als daß er es vertragen könnte: darum gibt es für ihn nur einen Weg: die ewige Ruhe aufzusuchen, den Schlummer des Todes der Mahnung der harten und unerfüllbaren Forderung vorzuziehen. Oder: diese Schicksalsstunde muß ja vorübergehen, und wenn man sie überlebt, wenn weder Tod noch Wahnsinn ihr Ende ist, dann beginnt ja wieder der Alltag, das friedliche Eingehegtsein, das Herrschen der Lebenslüge, die schattige Dämmerung; dann ist es ja weiter erträglich, wenn man weise ist und Weltschmerz liebt, und das Gedenken der furchtbaren Stunde der weiten Reise ist nur ein Zusammentreffen mit einem Gespenst gewesen, wobei man noch jetzt ein kaltes Grausen fühlt und den Wunsch „nie wieder!“, was aber im Laufe der Zeit die Schrecken der Deutlichkeit verliert und beinahe eine angenehme Erhöhung durch Kontrast der ruhigen Gegenwart wird.
Eine solche Reise durch gefährliche Stunden führt uns Georg Hermann in seiner Nacht des Dr. Herzfeld. Kein großes Kunstwerk, das durch die Jahrhunderte bleibt und Zeugnis ablegt von dem Form gewinnenden Geist eines Volkes. Die Nöte des einzelnen sind hier nicht gehoben in die reine Luft idealer Menschlichkeit, der Dämon der Leidenschaft nicht eingetaucht in die alles sühnende Harmonie des Ganzen. Es fehlt die letzte Gestaltung, die den Stoff völlig bewältigt, völlig in der spielenden Meisterschaft der Form aufhebt, und so das Trübe des zufälligen Erlebnisses im Spiegel des allgemein Gültigen zum Leuchten bringt. Aber es ist ein Buch, das so klar und deutlich wie selten ein zweites uns die Seelenfäden eines Menschentypus entwirrt, der eine häufige Erscheinung des eben modern gewesenen Romans gewesen ist. Denn schon hat sich eine Abkehr geltend gemacht. Man sehnt sich nach kräftigerem Leben, nach neuen, gewaltigeren Rhythmen, und an die Stelle des relativen und müden Pessimismus treten wieder die Tafeln überindividueller, allgemeingültiger Werte. Hier aber ist es, als sei in einem letzten, gedrängten Bild noch der Held eben vergangener Zeit zusammengefasst in seiner vollendeten, endgültigsten Ausprägung: im entwurzelten Juden. Wie eine späte Frucht an einem üppigen Baum ist dieses Buch, und es ist auch voll der Süße und Reife später Früchte. Fast spürt man seinen Herkunftsort in seinem Stil: er ist reich und weich an Stimmungen und hat doch jenes Saloppe, das dem Berliner eigen ist, und die Zartheit der Perioden zerreißt oft ein Zwischensatz zwischen Gedankenstrichen, nüchtern, witzig, fast schnodderig, vielleicht ein Erbteil Heinrich Heines. Aber es gibt Stellen, wo sich das stimmungsvolle Feuilleton steigert zu lyrischem Empfinden, wo das Bild der Großstadtnacht mit einem Zauber uns umfängt, dem wir Großstädter uns so gerne hingeben, und wo wie von ferne die Schwermut des märkischen Sandes, seiner Kiefern und Seen, Sonnenuntergänge und Menschen uns grüßt wie auf Bildern Walter Leistikows. Was uns das Buch aber wert macht, was es über alle müde Dekadenz und pessimistisches Ästhetentum erhebt, ist seine tiefe Kenntnis des Lebens, sein stilles und weites Verstehen und sein herzliches Mitleben mit Menschen und Dingen und ihren Nöten, das Verständnis der sozialen Fragen unserer Zeit. Man merkt es dem Buche an, daß sein Dichter liebt, daß er helfen möchte; und fast ist es, als ob in seinem gütigen Wissen die Schuld dieser Menschen aufgehoben wäre. Viel kluge Dinge stehen in dem Buche über alles Mögliche: über japanische Kunst und über Syphilis, über Eduard VII. und über Raabe, dessen Pessimismus dem Buche verwandt, aber bodenständiger ist, über Frauen und über Goethe, über die Ehe und über Liebe. Aber das Wesentliche in dem Buche bildet doch nicht das Naturleben oder die Gestaltungen des objektiven Geistes, sondern die Menschen, ihre Seelen und Beziehungen, ihr Ethos und ihr Pathos. Es ist, als ob alle Dinge nicht in ihrer Wesenheit lebten, sondern in Relationen zu diesen Menschen, vor allem zu dem, der der einsamste und weiseste ist, Dr. Herzfeld.
Es sind zwei, deren Schicksal diese Nacht miteinander verbindet, ohne sie doch einander näherzubringen: Dr. Alwin Herzfeld und Hermann Gutzeit; beide Literaten, beide Männer, die intim zu leben, zu erleben verstehen und die dieses Erlebnis umsetzen in die Rhythmen des Wortes, beide Männer, in deren Leben beherrschend und entscheidend eine Frau eingegriffen hat, und beide Menschen, die große Versprechungen nicht gehalten, berechtigte Erwartungen nicht erfüllt haben, die nicht das geworden sind, was sie hätten werden müssen, werden können und wovon sie einst in ihren besten Stunden geträumt haben. Beide Kinder des Großstadtpflasters, auf dem sie bei der atemlosen Hast des Vorwärtsdrängens zurückgeblieben sind, unscheinbar, abgeflogen, ziemlich ramponiert und des Schmelzes entkleidet wie leicht lädierte Schmetterlinge, die eben noch für eine Sammlung angehen, „ditto passabel“ sind, und auf beide passt das Wort des ihnen verwandten Peter Altenberg: „Ich bin fünfzig Jahre, glatzköpfig und ziemlich verkommen und habe es zu nichts gebracht trotz herrlicher Anlagen.“ Und doch welcher Unterschied zwischen ihnen, trotz des gleichen Milieus, des gleichen Berufs, des gleichen Lebens. Es ist, als repräsentierte jeder seine Rasse, als stünden zwei Welten einander gegenüber“ nicht in ihren besten Vertretern, sondern in Menschen eines müden, entwurzelten, dekadenten, trüben Typus. Beide sind Entwurzelte: der eine weg vom Lande, das ihn hat aufwachsen seinen, in die Großstadt und in ihrem Trubel untergetaucht, nachdem er kurze Zeit sich an der Oberfläche zu halten gewußt hatte. Und er sehnt sich nach dem Lande, sehnt sich in einer Weise, wie er selbst ist, halb verlogen-träumerisch sentimental, und ist doch für das Land bereits völlig verdorben, kann nur noch in der Großstadt leben, würde es auf dem Lande kaum drei Tage aushalten. Der andere ist in noch tieferem Sinne entwurzelt; aber sein Entwurzeltsein ist weiter, wissender, größer: ihn hat die Großstadt nicht verderbt, er war kein Kind des Landes, er weiß wohl, daß er nirgendwo ein Daheim hat, er ist sich jede Minute bewußt, „daß ihm von der ganzen Gotteswelt auch nicht ein Fußbreit gehört“. Wohin sollte er sich auch sehnen? Hier in Berlin, da hat er wenigstens immer mitgespielt, da ist er dabei gewesen, mit der Großstadt ist er selbst gewachsen, ihre Atemzüge hat er belauscht und verstanden und zu singen gewußt, er ist so entwurzelt, daß ihm die Negation aller Heimat, die Großstadt, zur Heimat wird und die Sehnsucht in ihm nicht mehr rege ist. So gehen sie nebeneinander durch die abendlichen Straßen Berlins: der Deutsche groß, ein wenig aufgeschwemmt, schwer und graublond, ein großer Kopf mit übermäßig hoher Stirne und graublaue, kurzsichtige gewölbte Augen hinter scharfen Kneifergläsern, .,Augen, die immer gleich ernst und grübelnd, gleichsam erstaunt blieben darüber, daß alles so gekommen, das heißt ganz anders als Hermann Gutzeit und die Welt es vermutet hatten“. So geht er, den Schlapphut auf dem Kopfe, einen alten, braunen, flatternden Mantel um sich, alt und abgenutzt, das blonde Haupthaar stark gelichtet und tiefe Furchen im Gesichte. Und neben ihm geht der andere, klein, vornübergebeugt, in kurzen Schritten, wortlos, die Hände auf dem Rücken, kränklich, trübsinnig und müde. Aber wie es bei häßlichen, kleinen Juden immer ist, wenn sie zu reden beginnen von dem, was ihnen nahe geht, wenn die Müdigkeit des Tages Raum macht der Begeisterung ihrer Stunde, da sind sie das, was sie seit alters gewesen: Künder des Pathos, Meister des Wortes. „Sowie er aber zu reden anhub und die dunklen Augen in dem blassen Gesicht die Herrschaft bekamen, dann war dieser Mensch da nicht mehr ein ziemlich mitgenommener Fünfziger, verbraucht über seine Jahre hinaus, sondern kaum erst ein Vierziger. Man sah dann ordentlich, wie ihm seine Gedanken aufstiegen, gleich schimmernden Blasen, die zur Oberfläche wollen. Er sprach gut, gern, sicher, liebte seine Worte, bog und feilte mitten im Satz, um eine andere Wendung zu geben, um etwas zu vertiefen, ein Plumpes zu verfeinern, ein Rohes zu umschreiben.“
Beide Entwurzelte: der Deutsche und der Jude. Und doch so verschieden: Gutzeit, der am Rande der Erschöpfung arbeitet, ein mühseliges Dasein, eine niedere Stufe jener erhabenen modernen Askese des Künstlers und Wissenschaftlers, von der Friedrich Nietzsche spricht (Zur Genealogie der Moral: Was bedeuten asketische Ideale?) und die Thomas Mann in Aschenbach (Der Tod in Venedig) gestaltet hat, bleibt doch hei aller Kränklichkeil und allem frühen vorschnellen Abgenutztsein zu einfach, zu gesund, zu undifferenziert: sein Leben kennt keine große Schuld, sondern nur kleine, in ihrer Wichtigkeit übertriebene und nur in ihrer Gesamtheit nieder drückende, alltägliche Verfehlungen, und so wird die tragische Nacht für ihn im Grunde zu einer Tragikomödie mit heiterem Ausgang, an deren Ende er etwas großsprecherisch und mit unnötiger Wichtigkeit sich selbst mehr bedauert als er zu bedauern ist. Und im Grunde siegt über all sein Gespiel und Getue doch seine lustige, laute und breite Art. Der andere ist ihm unverständlich; er hört ihm erstaunt zu, dem anderen, „der darin ganz Orientale war, daß man ihn selbst nie kennen lernte, ihn nie halten konnte, daß er immer hinter seinen eigenen Worten zurückwich.“ Denn Herzfeld ist der Tiefere von beiden; es ist, als käme er aus ganz anderen Weiten, als wäre er Jahrhunderte älter, als lebten in seinem Blute ungeheure Schicksale, Abgrundtiefen und Bergeshöhen.
Beide haben schon lange aufgehört aus dem Vollen zu leben; beider Leben ist mühsam zusammengeleimt aus ein paar Illusionen, nur damit man der Wahrheit nicht ins Gesicht zu sehen brauchte. Aber der Einsamere ist Herzfeld; er ist so namenlos einsam, daß er das Aussprechen fast verlernt hat; und nur diese Nacht öffnet ihm seine Seele, und dieser sonst stille Mensch, der ruhig, vornehm und unscheinbar in seiner zurückgezogenen Wohlhabenheit lebt und alles eher will als Aufsehen, bricht aus sich heraus und stellt uns vor sein Leben hin, in einem scharfen, hellen Blitzlicht, daß uns vor all dem inneren Jammer dieser Existenz schauert und wir doch Achtung haben vor dieser Selbstbeherrschung, diesem trotzigen Alleinsein. Aber wie arm ist dieses Leben! Dieser Mensch mit all seinem Wissen, seinem Takt, seiner geistigen Regsamkeit, alleinstehend, reich und unabhängig, voll tiefsten Verständnisses des Lebens und der Kunst, der sein Leben mit kostbaren Dingen umgeben hat, die er liebt, mit Büchern und Stichen, alten goldbraunen Möbeln und einfarbigen Porzellanen Chinas, die köstlicher waren als schöne Verse, mit den Holzschnitten Japans, die wie Blumen bunt, seltsam und von exotischem Duft, und mit Lackdosen von dem Glanz geschnittener Steine und Juwelen — dieser Mensch mit all seinem inneren und äußeren Reichtum, mit dieser seiner ganzen, kostbaren, künstlichen Welt, hatte das Leben sich entgleiten sehen müssen, war machtlos und hilflos dem Leben gegenüber, ärmer als der letzte Arme, der noch ein schlagendes Herz, ein wirkliches Stück Erde, etwas Lebendiges und Vertrautes sein eigen nennt. Er selbst aber hat sich zu weit entfernt von allem wirklichen Leben, von dem, was im Leben Halt und Sicherheit gibt, von Land und Familie, Freund und Volk. Wie die Nürnberger und Beermann in Schnitzlers „Der Weg ins Freie“ haben ihn die Schicksale seines Volkes weit fortgetrieben von Gemeinsamkeit und Leben und haben ihn zu dem gemacht, unter dessen Druck er fast zusammenbricht, zum heimatlosen Literaten. Wie dieser lebt er nicht mehr in Realitäten, sondern in Surrogaten, aus Fiktionen ist sein künstliches Dasein aufgebaut, nichts bietet seiner Seele festen Halt, und so ist sie veränderlich und schwankend; sie kennt die Wandlung, aber nicht jene große Wandlung des Orientalen, die uns in unseren Grundfesten erschüttert und zu einem völlig neuen Menschen macht — denn dazu hat er sich von diesem Urlebenskreis zu weit entfernt — , aber die stete Verwandlungsfähigkeit der Oberfläche, die nur Oberfläche ist, die nur den Stimmungen des Augenblicks horcht und der die Konstanz der Kontinuität fremd ist. „Wer kann für sich gutstehen, daß er nicht schon morgen anderer Meinung ist? Ich beneide alle, die glauben, irgend etwas verantworten zu können!“ Doch wozu mehr? Wir kennen alle diesen Typus des entwurzelten, seiner Familie und seinem Volke fremden jüdischen Literaten, wie er durch unsere Tage geht, die letzte Verkleidung, in der Ahasveros auf seiner endlosen Wanderung vor uns erscheint. Und Alwin Herzfeld ist vielleicht die beste Gestalt dieses Typus, der freudlos und einsam ist und aus dem der Schmerzensschrei bricht. „Und wenn sie weiter sagen, daß ich doch nur Verantwortung für mich trage — hier — meine rechte Hand gäbe ich dafür, wenn ich es damit erkaufen könnte, daß es noch anders wäre.“ So schreit er aus seiner Not nach Gefährten, nach Verantwortung, nach Volk, nach Aufgabe. Und ist doch zu schwach und kann nicht anders. Kann aus seinen Lebenslügen nicht hinaus zur Wirklichkeit, und weiß, daß er sterben wird, niemandem etwas, fremd und allein, und nach drei Tagen schon hat ihn der Kellner in seinem Stammcafe vergessen. Und in dieser Nacht, wo das, was er so lange zurückgehalten hat, zutage tritt, wo ihm auf Schritt und Tritt Erinnerungen begegnen, wo er sein Leben wiederlebt mit all seinen Versäumnissen und seiner vermeintlichen Schuld, wo er im Kreise von Männern, gleich ihm und Gutzeit ramponiert und nur noch „ditto passabel“, sein letztes Liebeserlebnis wiedersieht, die letzte Vortäuschung von wahrem Leben — und unter diesen Männern des Kreises der „Dittopassabeln“ sind einige, die entwurzelt sind gleich ihm: Goldschmidt, der seichte Verstandesmensch, der viel zu flach ist, um an seiner Entwurzelung zu leiden, der gar nicht die Fähigkeit besitzt, in sich zu seiner Wurzel hinabzusteigen, für den das Leben keine Tiefen hat und für den es aus Begriffsschemen und Büchertiteln — was kümmert ihn der Inhalt! — besteht, und ein zweiter, bei dem die Entwurzelung akut ist, bei dem nicht eine historische Tragödie, ein Volksschicksal von Jahrhunderten dahinter steht, ein alter englischer Sprachlehrer, der schlecht deutsch sprach, weil er mit seinen Schülern nur englisch sprach, und schlecht englisch, weil er immer nur Fehler hörte, und so zu dem stillen, gleichmäßigen Stumpfsinn einer Schildkröte gekommen war. — „Er führte aber auch das traurigste Dasein, das ersonnen werden kann: Sprachlehrer in einem fremden Land sein, nie Wurzel fassen können, abhängig sein von Menschen, denen man gleichgültig ist und für die man trotzdem Interesse heucheln muß, wenn man sie auch verachtet, da man meint, sie ständen tief unter einem, eben, weil jedes beiderseitige Verstehen ausgeschlossen ist.“ — „Aber Mr. Young ertrug die Kümmerlichkeit seiner Heimatlosigkeit mit dem müden Lächeln eines Gentleman, wie ein alter zerfledderter Raubvogel, der mit beschnittenen Flügeln im Käfig auf seiner Stange hockt, mit dem allerletzten, geheimen Glühen einer jähzornigen Sehnsucht in den Augen“ — und wo in gleicher Nacht ein Weib ihm begegnet, das er seit Jahren nicht mehr gesehen hat und mit dem sein erstes himmelhoch jauchzendes Glück verknüpft war wie seine tiefsten, von Schuld zernagten Stunden; in dieser Nacht, wo er über sein Leben richtet, wird er sich dessen ganzer Schalheit und Leere bewußt, ist er der ewigen Surrogate überdrüssig, die das Leben ihm bietet, und will nach der einzigen Realität greifen, die ihm zugänglich ist: dem Tode. Seiner komplizierten, verwirrten, zerrissenen Seele ist das Leben in seiner Einfachheit und Größe nur fassbar in seiner Negation, im Tode. Und er überschaut, was er sein Leben genannt hat, und die Erinnerungen kommen und steigen auf vom Grunde seiner Seele, und mit der Feinheit des Literaten weiß ei sie zu genießen, aus ihnen ihren letzten, heimlichsten Duft hervorzuholen und aus Dämmerung und Halbbewusstsein sie gleich goldenen Spielkugeln in die Luft zu schleudern, zum Genussspiel seiner Nerven und Sinne. Und ganz aus dem geheimsten Fach seines Herzens kamen die verblassenden Erinnerungen an Jugend, Familie und väterliche Riten, und er sah sie vor sich mit jener letzten, ironischen Liebe, „die selbst der freie Jude noch heute für seine Riten hegt“, die kleine Betschule in einem unerhört schmierigen Hof, wo Männer mit wirren Bärten und mit Käppchen stehen in gelbweißen Seidenmänteln. Und im bräunlichen Dunkel des überfüllten Raumes schwammen mit rötlichen Höfen Kerzen, deren Lichter von dem unausgesetzten und doch so melodiösen Singsang der Litaneien ganz leise zitterten, in denen so eine wilde, fanatische Bitterkeit lag, zornig, freudlos und hingebend. Ja, das Haus möchte er noch einmal gerne sehen. Aber über all die Erinnerungen hinaus jagt ihn eines: der Tod, die Sehnsucht nach Ruhe, nach Endgültigem, nach Wahrheit.
Und doch ... er überlebt. In einer Krise seiner Nerven endet diese Nacht für ihn. Und draußen ist wieder der geschäftige, helle Tag, der ihm Schutz gibt, wo die Mühle der Lebenslügen lustig klappert, und bei diesem altgewohnten Klang kommt ihm die alte, müde, wissende Ruhe wieder. Was war das für eine Nacht gewesen! Ohne daß er es wollte, hatte er alle Labyrinthe des Menschlichen durchirrt, hatte weite Reisen gemacht — fast bis zur letzten verschlossenen Kammer. War überhaupt er der Reisende gewesen, er, Dr. Alwin Herzfeld, der ruhige Bewohner seiner stillen Zimmer mit ihren alten Möbeln und japanischen Bildern, oder ein anderer, den er vorher nie gekannt und den er auch nie wiedersehen wird? Und so geht er hin und ist etwas beschämt ob all des Gespensterspuks dieser Nacht. Es ist ihm, als hätte er auch die allerletzte Probe auf sein Menschentum nicht bestanden, als sei er nicht einmal zu dem geeignet gewesen, was jeder einfache Mensch, ohne viel nachzudenken, zu tun fähig ist. Aber die Monotonie seines trägen Lebens hat wieder Gewalt über ihn, all die kleinen Freuden, die er sich mühsam aus aller Kümmerlichkeit eines entgleisten Lebens zusammengelesen hat. Und Dr. Herzfelds Ahne Heinrich Heine lächelt ihm zu, ironisch, klug und müde, mit der gleichen unheimlichen Krankheit behaftet, unjung und nicht mehr ganz gesund, und doch voll glühender Sehnsucht nach dem Leben.
Es ist in vielem der Geist Heinrich Heines, der über dem Buche liegt, seine Sehnsucht nach alten griechischen Tempeln, nach ihrer unter tiefblauem Himmel emporblühenden strahlenden Heiterkeit, und seine Freude am Frühling und an den Mädchen, kurzrockig, schlank und hellblau. Und dabei die leise Ironie, daß das alles doch nur Spiel sei, die Erbschaft der Romantik, die Illusion haut und Illusion zerstört. Nur ist hier alles weiter und bunter, feiner und vielgestaltiger als bei Heine, das alte Lied erklingt in neuen, volleren Harmonien, über all dem liegt eine Heine fremde Art gütigen und doch überlegenen Verständnisses, und die Sprache hat einen weiten Weg gemacht in ihrer Geschmeidigkeit, ihrem Glänze und ihrer Treffsicherheit von Heine bis Dr. Herzfeld.
Und doch leiden beide an einem gleichen Übel, nur daß Herzfeld hier der Jüngere ist und damit der Spätere, der Vollendetere. In seinem Roman der beginnenden Entwurzelung des Berliner Juden, in seinem Jettchen Gebert, da stehen die einzelnen Menschen noch nicht einsam und allein da. In ihnen allen sind die Züge ein und derselben Familie unverkennbar, Familiengeist und -tracht, die sie alle an sich haben, unauslöschlich, vom uralten Eli Gebert bis zu Jettchen. Und in diesen Familienzügen sind mit gleicher meisterhafter Sicherheit die Rassenzüge eingeprägt, und so sind es nicht einzelne, einsame Menschen, deren Schicksal uns der Dichter malt, es ist das Leben und die Geschichte eines verbundenen Ganzen, einer Familie, eines Volkes, einer Rasse, das hinter dem Schicksal jedes einzelnen steht und von dem sich sein Lebensbild abhebt, sicher, ruhend und fest, getragen von Banden des Blutes, vom Boden der Tradition. Und es ist fast am Ende des Werkes, daß einer den Sinn des ganzen Buches zusammenfasst und ihn vor uns hinstellt, einer, der still und weise, ironisch und schmerzbeladen ist, Jason Gebert, der Philosoph und Liebhaber schöner Kunstgegenstände, vielleicht ein Großvater Dr. Alwin Herzfelds. Und, in der Art, wie er es sagt, da klingt es wieder wie von der Art seines Zeitgenossen Heinrich Heine: „Weißt du, man mag reden, was man will, Jettchen — eigentlich ist die Familie doch das Einzige, was uns Halt gibt im Leben. Es ist mit der Familie wie mit dem Ofen: solange es Sommer ist, wollen wir nichts von ihm wissen, und jedesmal, wenn wir durchs Zimmer gehen, stoßen wir uns daran, und wenn wir ihn anfassen, ist er hundekalt. Aber sowie es Winter ist, da merken wir erst, was er uns bedeutet, und was wir ohne ihn überhaupt wären.“ Und grimmiger, verzweifelter sagt es Dr. Herzfeld: „Wir leben unser Lebtag mit anderen Menschen, aber wir sterben mit der Familie.“
So endet die weite Reise des Dr. Herzfeld. Und mag sie ihn noch so weit geführt haben: die letzte verschlossene Kammer hat er nicht aufzusperren vermocht, zu den Wurzeln der Dinge konnte der Entwurzelte nicht steigen. Und so lebt er weiter und träumt vom Leben, das stark und berauschend ihn tragen würde wie jagende Pferde. Und hockt in dem Käfig seiner Surrogate, unjung und nicht mehr ganz gesund, mit beschnittenen Flügeln, ramponiert und glanzlos, und in den müden, trüben Augen ein allerletztes geheimes Glühen der Sehnsucht.
Die Nacht des Dr. Herzfeld
von Hans Kohn
„Man denkt, wenn man glaubt, ohne Glauben ist kein Denken: nur, wer Glauben hat, hat Denken. Den Glauben muß man also suchen zu erkennen!“
„Den Glauben, o Herr, möchte ich erkennen!“
„Man glaubt, wenn man in etwas gewurzelt ist: ohne Gewurzeltsein ist kein Glaube: wer in etwas gewurzelt, der glaubt daran. Wurzelung also muß man suchen zu erkennen!“ „Die Wurzelung o Herr, möchte ich erkennen!“ „Man ist in etwas gewurzelt, wenn man schafft: ohne Schaffen ist kein Gewurzeltsein; nur wer etwas schafft, ist darin gewurzelt. Das Schaffen also muß man suchen zu erkennen.“
Chândogya-Upanischad 719 — 21.
(Paul Deussen: Sechzig-Upanischads. Brockhaus, Leipzig 1905, 2. A. S. 184.)
Die Nacht hat seit alters her etwas Beunruhigendes in sich. Da erwachen Stimmen, die man bei Tage nie gehört hat, der Blick verliert sich in undurchdringlicher Ferne, in die er auch das Gemüt lockt, die Grenzen verwischen sich, und der chaotische Urstrom der Dinge gleitet wieder über die Welt. Und auch den Menschen lockt es in der Nacht über sich hinaus und in sich hinein. Man hält Zwiesprache mit sich und schlichtet und sichtet; lange Gelebtes steht wieder auf, die Stunde der Abrechnung bricht an, und aus der Einsamkeit der Kreatur und den Verschlingungen der Großstadt reift das Erlebnis.
Georg Hermann hat in seinem Jettchen Gebert ein Kunstwerk gegeben, das wie Thomas Manns Buddenbrocks einen Ausschnitt der Welt in seiner Breite, in der vielfältigen Hingesponnenheit der bunten Schicksale gestaltet hat. Die Nacht des Dr. Herzfeld ist mehr eine Novelle, denn ein Roman; in die Kürze einer einzigen Nacht, in wenige Gestalten wird hier eine Fülle Lebens gepresst, daß es fast unheimlich ist, und daß einem der Rahmen zu schwach dünkt, diesen Druck auszuhalten. Man wünschte oft mehr Raum, vor allem mehr Zeit. Man bewundert diese atemlose Kunst des Dichtens, des Verdichtens, und wird doch des bangen Gefühls nicht frei, daß diese „Nacht der Nächte“ über das ganze Lehen so mancher Menschen entscheidet, uns die sonst verschlossenen Pforten zu ihrem ängstlich gehüteten innersten Leben wie mit einem Zauberschlüssel aufschließt und uns in der Fülle des Erschlossenen der bleiche dämmernde Tag etwas hilflos antrifft. Man hatte in Jettchen Gebert mehr Boden unter den Füßen, weitere Horizonte, festere Linien. Aber diesmal geht die Reise tiefer, als in dem Roman der Berlinerin des Biedermeiers, geht die Reise in unbekanntere Fernen, in verborgenere Tiefen, und da ist es verständlich, wenn uns manchmal die Bangigkeit anfällt, die an allem Fremden, Ungewöhnlichen haftet, und die doch, wie alle Fernen, lockt und anzieht.
Jahrelang gehen die Menschen umher, nebeneinander, sprechen und handeln, und bleiben einander doch fremd und kennen sich selbst nicht. Und wenn sie klug sind, durchschauen sie die Vergänglichkeit und Flüchtigkeit alles Tuns und alles Geschehens, wie alles fließt und doch in all dem Flusse sich nichts ändert, und wie bei all dem der Mensch einsam dabei steht, unverstanden von allen und kaum das Wesen des anderen verstehend. Und es fröstelt dem Menschen bei dieser Einsamkeit, und er schreit nach dem Gefährten. Und doch hütet der Mensch ängstlich diese Einsamkeit, denn sie ist zugleich eine Schutzwehr, eine schützende Mauer um ihn, die ihm Ruhe gibt und die Trägheit seines Herzens nicht gefährdet; denn schlüge er Bresche in diese Mauer, so wagte er sich auf wilde, stürmische See, voll unbekannter Gefahren und tückischer Abgründe, voll neuen, scharfen Lichtes, daß all die Bauten und Schranken, die er zu seiner Sicherung in sich aufgeführt hatte, brechen, voll Verantwortung und Mühsal, die alle Ruhe für immer verscheuchen würde. Und so bleibt der Mensch in seiner Einsamkeit, aus der er doch hinaus will, an der er leidet: und das macht die Welt für ihn so wehmütig, und er wird ein Wissender, der sein Wissen in Schwermut und Weltschmerz trägt, und dessen Erhebung über sich nur darin besteht, daß er mit seinem Weltschmerz und seiner Schwermut spielt. Die Schranke, die er anderen gegenüber wahrt, die wahrt er auch sich selbst gegenüber; es fehlt ihm auch der Mut, sich selbst zu erforschen, sein eigenes Innere voll Vertrauen, voll tätiger Liebe und freudiger Verantwortung hervorquillen zu lassen. Er analysiert sich viel, grübelt über sich in den langen Stunden seiner durch keine Tätigkeit von außen her oder für das Außen abgelenkten Muße, aber es ist nur die Oberfläche, in die er sich wagt, Stimmungen der Stunde, Trübungen des Tages, Freudigkeiten des Zufalls, es ist nur das Fleisch, das sich um seine Seele schließt und sie schützt, das er durchforscht (man hat richtig von Selbstzerfleischung gesprochen), die Seele aber bleibt ihm unbetretbar, sein Geist, wie er aus der Fülle des Geschichtlichen hervorgewachsen zu seiner Eigenart, bleibt ihm fremd. So scheut der Mensch die Reise. Bis einmal Stunden kommen, wo gleichsam ein Sturmwind die Fluten hochpeitscht und sie anstürmen läßt gegen die sorgsam gehüteten Dämme, bis sie nachgeben und brechen. Und ungehütet steht der Mensch da, schutzlos preisgegeben dem Wüten urelementarer Kräfte, und er hört die Stimmen seines Lebens und vergleicht die Taten seines Wandelns und findet sie leer und nichtig. Und er besinnt sich auf die Stimme, die einst auch sein Leben berufen hat zu seiner Aufgabe. Es geht ihm gleich dem greisen Peer Gynt, dem im Herbstwinde wirbelnde welke Blätter Worte werden, die er hätte künden sollen, und das Rauschen in der Luft Lieder, die seiner Verkündigung geharrt, Tautropfen an den Zweigen Tränen und Erschütterungen, denen er ausgewichen ist, und die geknickten Halme auf dem Wege ungeschehene Werke, die er versäumt hat. Nur daß er weiser ist und nicht erst des Knopfgießers bedarf, der es ihn lehre, was des Menschen Leben ausmacht: „des Meisters Willen als wie ein Schild, an seines Lebensschwerts Griff sich löten“, der Berufung zu folgen, die an jeden Menschen ertönt. Aber dazu traute er sich nie weit genug zu reisen, um die Bestimmung der Ferne zu ahnen, und jetzt ist es zu spät. Der Berufung und ihrer unerbittlichen Strenge kann er nicht mehr folgen; die Ruhe und Trägheit der Sicherheit ist ihm zu teuer, seine Lebenslügen zu sehr Lebensbedürfnis, das neue Licht zu grell, als daß er es vertragen könnte: darum gibt es für ihn nur einen Weg: die ewige Ruhe aufzusuchen, den Schlummer des Todes der Mahnung der harten und unerfüllbaren Forderung vorzuziehen. Oder: diese Schicksalsstunde muß ja vorübergehen, und wenn man sie überlebt, wenn weder Tod noch Wahnsinn ihr Ende ist, dann beginnt ja wieder der Alltag, das friedliche Eingehegtsein, das Herrschen der Lebenslüge, die schattige Dämmerung; dann ist es ja weiter erträglich, wenn man weise ist und Weltschmerz liebt, und das Gedenken der furchtbaren Stunde der weiten Reise ist nur ein Zusammentreffen mit einem Gespenst gewesen, wobei man noch jetzt ein kaltes Grausen fühlt und den Wunsch „nie wieder!“, was aber im Laufe der Zeit die Schrecken der Deutlichkeit verliert und beinahe eine angenehme Erhöhung durch Kontrast der ruhigen Gegenwart wird.
Eine solche Reise durch gefährliche Stunden führt uns Georg Hermann in seiner Nacht des Dr. Herzfeld. Kein großes Kunstwerk, das durch die Jahrhunderte bleibt und Zeugnis ablegt von dem Form gewinnenden Geist eines Volkes. Die Nöte des einzelnen sind hier nicht gehoben in die reine Luft idealer Menschlichkeit, der Dämon der Leidenschaft nicht eingetaucht in die alles sühnende Harmonie des Ganzen. Es fehlt die letzte Gestaltung, die den Stoff völlig bewältigt, völlig in der spielenden Meisterschaft der Form aufhebt, und so das Trübe des zufälligen Erlebnisses im Spiegel des allgemein Gültigen zum Leuchten bringt. Aber es ist ein Buch, das so klar und deutlich wie selten ein zweites uns die Seelenfäden eines Menschentypus entwirrt, der eine häufige Erscheinung des eben modern gewesenen Romans gewesen ist. Denn schon hat sich eine Abkehr geltend gemacht. Man sehnt sich nach kräftigerem Leben, nach neuen, gewaltigeren Rhythmen, und an die Stelle des relativen und müden Pessimismus treten wieder die Tafeln überindividueller, allgemeingültiger Werte. Hier aber ist es, als sei in einem letzten, gedrängten Bild noch der Held eben vergangener Zeit zusammengefasst in seiner vollendeten, endgültigsten Ausprägung: im entwurzelten Juden. Wie eine späte Frucht an einem üppigen Baum ist dieses Buch, und es ist auch voll der Süße und Reife später Früchte. Fast spürt man seinen Herkunftsort in seinem Stil: er ist reich und weich an Stimmungen und hat doch jenes Saloppe, das dem Berliner eigen ist, und die Zartheit der Perioden zerreißt oft ein Zwischensatz zwischen Gedankenstrichen, nüchtern, witzig, fast schnodderig, vielleicht ein Erbteil Heinrich Heines. Aber es gibt Stellen, wo sich das stimmungsvolle Feuilleton steigert zu lyrischem Empfinden, wo das Bild der Großstadtnacht mit einem Zauber uns umfängt, dem wir Großstädter uns so gerne hingeben, und wo wie von ferne die Schwermut des märkischen Sandes, seiner Kiefern und Seen, Sonnenuntergänge und Menschen uns grüßt wie auf Bildern Walter Leistikows. Was uns das Buch aber wert macht, was es über alle müde Dekadenz und pessimistisches Ästhetentum erhebt, ist seine tiefe Kenntnis des Lebens, sein stilles und weites Verstehen und sein herzliches Mitleben mit Menschen und Dingen und ihren Nöten, das Verständnis der sozialen Fragen unserer Zeit. Man merkt es dem Buche an, daß sein Dichter liebt, daß er helfen möchte; und fast ist es, als ob in seinem gütigen Wissen die Schuld dieser Menschen aufgehoben wäre. Viel kluge Dinge stehen in dem Buche über alles Mögliche: über japanische Kunst und über Syphilis, über Eduard VII. und über Raabe, dessen Pessimismus dem Buche verwandt, aber bodenständiger ist, über Frauen und über Goethe, über die Ehe und über Liebe. Aber das Wesentliche in dem Buche bildet doch nicht das Naturleben oder die Gestaltungen des objektiven Geistes, sondern die Menschen, ihre Seelen und Beziehungen, ihr Ethos und ihr Pathos. Es ist, als ob alle Dinge nicht in ihrer Wesenheit lebten, sondern in Relationen zu diesen Menschen, vor allem zu dem, der der einsamste und weiseste ist, Dr. Herzfeld.
Es sind zwei, deren Schicksal diese Nacht miteinander verbindet, ohne sie doch einander näherzubringen: Dr. Alwin Herzfeld und Hermann Gutzeit; beide Literaten, beide Männer, die intim zu leben, zu erleben verstehen und die dieses Erlebnis umsetzen in die Rhythmen des Wortes, beide Männer, in deren Leben beherrschend und entscheidend eine Frau eingegriffen hat, und beide Menschen, die große Versprechungen nicht gehalten, berechtigte Erwartungen nicht erfüllt haben, die nicht das geworden sind, was sie hätten werden müssen, werden können und wovon sie einst in ihren besten Stunden geträumt haben. Beide Kinder des Großstadtpflasters, auf dem sie bei der atemlosen Hast des Vorwärtsdrängens zurückgeblieben sind, unscheinbar, abgeflogen, ziemlich ramponiert und des Schmelzes entkleidet wie leicht lädierte Schmetterlinge, die eben noch für eine Sammlung angehen, „ditto passabel“ sind, und auf beide passt das Wort des ihnen verwandten Peter Altenberg: „Ich bin fünfzig Jahre, glatzköpfig und ziemlich verkommen und habe es zu nichts gebracht trotz herrlicher Anlagen.“ Und doch welcher Unterschied zwischen ihnen, trotz des gleichen Milieus, des gleichen Berufs, des gleichen Lebens. Es ist, als repräsentierte jeder seine Rasse, als stünden zwei Welten einander gegenüber“ nicht in ihren besten Vertretern, sondern in Menschen eines müden, entwurzelten, dekadenten, trüben Typus. Beide sind Entwurzelte: der eine weg vom Lande, das ihn hat aufwachsen seinen, in die Großstadt und in ihrem Trubel untergetaucht, nachdem er kurze Zeit sich an der Oberfläche zu halten gewußt hatte. Und er sehnt sich nach dem Lande, sehnt sich in einer Weise, wie er selbst ist, halb verlogen-träumerisch sentimental, und ist doch für das Land bereits völlig verdorben, kann nur noch in der Großstadt leben, würde es auf dem Lande kaum drei Tage aushalten. Der andere ist in noch tieferem Sinne entwurzelt; aber sein Entwurzeltsein ist weiter, wissender, größer: ihn hat die Großstadt nicht verderbt, er war kein Kind des Landes, er weiß wohl, daß er nirgendwo ein Daheim hat, er ist sich jede Minute bewußt, „daß ihm von der ganzen Gotteswelt auch nicht ein Fußbreit gehört“. Wohin sollte er sich auch sehnen? Hier in Berlin, da hat er wenigstens immer mitgespielt, da ist er dabei gewesen, mit der Großstadt ist er selbst gewachsen, ihre Atemzüge hat er belauscht und verstanden und zu singen gewußt, er ist so entwurzelt, daß ihm die Negation aller Heimat, die Großstadt, zur Heimat wird und die Sehnsucht in ihm nicht mehr rege ist. So gehen sie nebeneinander durch die abendlichen Straßen Berlins: der Deutsche groß, ein wenig aufgeschwemmt, schwer und graublond, ein großer Kopf mit übermäßig hoher Stirne und graublaue, kurzsichtige gewölbte Augen hinter scharfen Kneifergläsern, .,Augen, die immer gleich ernst und grübelnd, gleichsam erstaunt blieben darüber, daß alles so gekommen, das heißt ganz anders als Hermann Gutzeit und die Welt es vermutet hatten“. So geht er, den Schlapphut auf dem Kopfe, einen alten, braunen, flatternden Mantel um sich, alt und abgenutzt, das blonde Haupthaar stark gelichtet und tiefe Furchen im Gesichte. Und neben ihm geht der andere, klein, vornübergebeugt, in kurzen Schritten, wortlos, die Hände auf dem Rücken, kränklich, trübsinnig und müde. Aber wie es bei häßlichen, kleinen Juden immer ist, wenn sie zu reden beginnen von dem, was ihnen nahe geht, wenn die Müdigkeit des Tages Raum macht der Begeisterung ihrer Stunde, da sind sie das, was sie seit alters gewesen: Künder des Pathos, Meister des Wortes. „Sowie er aber zu reden anhub und die dunklen Augen in dem blassen Gesicht die Herrschaft bekamen, dann war dieser Mensch da nicht mehr ein ziemlich mitgenommener Fünfziger, verbraucht über seine Jahre hinaus, sondern kaum erst ein Vierziger. Man sah dann ordentlich, wie ihm seine Gedanken aufstiegen, gleich schimmernden Blasen, die zur Oberfläche wollen. Er sprach gut, gern, sicher, liebte seine Worte, bog und feilte mitten im Satz, um eine andere Wendung zu geben, um etwas zu vertiefen, ein Plumpes zu verfeinern, ein Rohes zu umschreiben.“
Beide Entwurzelte: der Deutsche und der Jude. Und doch so verschieden: Gutzeit, der am Rande der Erschöpfung arbeitet, ein mühseliges Dasein, eine niedere Stufe jener erhabenen modernen Askese des Künstlers und Wissenschaftlers, von der Friedrich Nietzsche spricht (Zur Genealogie der Moral: Was bedeuten asketische Ideale?) und die Thomas Mann in Aschenbach (Der Tod in Venedig) gestaltet hat, bleibt doch hei aller Kränklichkeil und allem frühen vorschnellen Abgenutztsein zu einfach, zu gesund, zu undifferenziert: sein Leben kennt keine große Schuld, sondern nur kleine, in ihrer Wichtigkeit übertriebene und nur in ihrer Gesamtheit nieder drückende, alltägliche Verfehlungen, und so wird die tragische Nacht für ihn im Grunde zu einer Tragikomödie mit heiterem Ausgang, an deren Ende er etwas großsprecherisch und mit unnötiger Wichtigkeit sich selbst mehr bedauert als er zu bedauern ist. Und im Grunde siegt über all sein Gespiel und Getue doch seine lustige, laute und breite Art. Der andere ist ihm unverständlich; er hört ihm erstaunt zu, dem anderen, „der darin ganz Orientale war, daß man ihn selbst nie kennen lernte, ihn nie halten konnte, daß er immer hinter seinen eigenen Worten zurückwich.“ Denn Herzfeld ist der Tiefere von beiden; es ist, als käme er aus ganz anderen Weiten, als wäre er Jahrhunderte älter, als lebten in seinem Blute ungeheure Schicksale, Abgrundtiefen und Bergeshöhen.
Beide haben schon lange aufgehört aus dem Vollen zu leben; beider Leben ist mühsam zusammengeleimt aus ein paar Illusionen, nur damit man der Wahrheit nicht ins Gesicht zu sehen brauchte. Aber der Einsamere ist Herzfeld; er ist so namenlos einsam, daß er das Aussprechen fast verlernt hat; und nur diese Nacht öffnet ihm seine Seele, und dieser sonst stille Mensch, der ruhig, vornehm und unscheinbar in seiner zurückgezogenen Wohlhabenheit lebt und alles eher will als Aufsehen, bricht aus sich heraus und stellt uns vor sein Leben hin, in einem scharfen, hellen Blitzlicht, daß uns vor all dem inneren Jammer dieser Existenz schauert und wir doch Achtung haben vor dieser Selbstbeherrschung, diesem trotzigen Alleinsein. Aber wie arm ist dieses Leben! Dieser Mensch mit all seinem Wissen, seinem Takt, seiner geistigen Regsamkeit, alleinstehend, reich und unabhängig, voll tiefsten Verständnisses des Lebens und der Kunst, der sein Leben mit kostbaren Dingen umgeben hat, die er liebt, mit Büchern und Stichen, alten goldbraunen Möbeln und einfarbigen Porzellanen Chinas, die köstlicher waren als schöne Verse, mit den Holzschnitten Japans, die wie Blumen bunt, seltsam und von exotischem Duft, und mit Lackdosen von dem Glanz geschnittener Steine und Juwelen — dieser Mensch mit all seinem inneren und äußeren Reichtum, mit dieser seiner ganzen, kostbaren, künstlichen Welt, hatte das Leben sich entgleiten sehen müssen, war machtlos und hilflos dem Leben gegenüber, ärmer als der letzte Arme, der noch ein schlagendes Herz, ein wirkliches Stück Erde, etwas Lebendiges und Vertrautes sein eigen nennt. Er selbst aber hat sich zu weit entfernt von allem wirklichen Leben, von dem, was im Leben Halt und Sicherheit gibt, von Land und Familie, Freund und Volk. Wie die Nürnberger und Beermann in Schnitzlers „Der Weg ins Freie“ haben ihn die Schicksale seines Volkes weit fortgetrieben von Gemeinsamkeit und Leben und haben ihn zu dem gemacht, unter dessen Druck er fast zusammenbricht, zum heimatlosen Literaten. Wie dieser lebt er nicht mehr in Realitäten, sondern in Surrogaten, aus Fiktionen ist sein künstliches Dasein aufgebaut, nichts bietet seiner Seele festen Halt, und so ist sie veränderlich und schwankend; sie kennt die Wandlung, aber nicht jene große Wandlung des Orientalen, die uns in unseren Grundfesten erschüttert und zu einem völlig neuen Menschen macht — denn dazu hat er sich von diesem Urlebenskreis zu weit entfernt — , aber die stete Verwandlungsfähigkeit der Oberfläche, die nur Oberfläche ist, die nur den Stimmungen des Augenblicks horcht und der die Konstanz der Kontinuität fremd ist. „Wer kann für sich gutstehen, daß er nicht schon morgen anderer Meinung ist? Ich beneide alle, die glauben, irgend etwas verantworten zu können!“ Doch wozu mehr? Wir kennen alle diesen Typus des entwurzelten, seiner Familie und seinem Volke fremden jüdischen Literaten, wie er durch unsere Tage geht, die letzte Verkleidung, in der Ahasveros auf seiner endlosen Wanderung vor uns erscheint. Und Alwin Herzfeld ist vielleicht die beste Gestalt dieses Typus, der freudlos und einsam ist und aus dem der Schmerzensschrei bricht. „Und wenn sie weiter sagen, daß ich doch nur Verantwortung für mich trage — hier — meine rechte Hand gäbe ich dafür, wenn ich es damit erkaufen könnte, daß es noch anders wäre.“ So schreit er aus seiner Not nach Gefährten, nach Verantwortung, nach Volk, nach Aufgabe. Und ist doch zu schwach und kann nicht anders. Kann aus seinen Lebenslügen nicht hinaus zur Wirklichkeit, und weiß, daß er sterben wird, niemandem etwas, fremd und allein, und nach drei Tagen schon hat ihn der Kellner in seinem Stammcafe vergessen. Und in dieser Nacht, wo das, was er so lange zurückgehalten hat, zutage tritt, wo ihm auf Schritt und Tritt Erinnerungen begegnen, wo er sein Leben wiederlebt mit all seinen Versäumnissen und seiner vermeintlichen Schuld, wo er im Kreise von Männern, gleich ihm und Gutzeit ramponiert und nur noch „ditto passabel“, sein letztes Liebeserlebnis wiedersieht, die letzte Vortäuschung von wahrem Leben — und unter diesen Männern des Kreises der „Dittopassabeln“ sind einige, die entwurzelt sind gleich ihm: Goldschmidt, der seichte Verstandesmensch, der viel zu flach ist, um an seiner Entwurzelung zu leiden, der gar nicht die Fähigkeit besitzt, in sich zu seiner Wurzel hinabzusteigen, für den das Leben keine Tiefen hat und für den es aus Begriffsschemen und Büchertiteln — was kümmert ihn der Inhalt! — besteht, und ein zweiter, bei dem die Entwurzelung akut ist, bei dem nicht eine historische Tragödie, ein Volksschicksal von Jahrhunderten dahinter steht, ein alter englischer Sprachlehrer, der schlecht deutsch sprach, weil er mit seinen Schülern nur englisch sprach, und schlecht englisch, weil er immer nur Fehler hörte, und so zu dem stillen, gleichmäßigen Stumpfsinn einer Schildkröte gekommen war. — „Er führte aber auch das traurigste Dasein, das ersonnen werden kann: Sprachlehrer in einem fremden Land sein, nie Wurzel fassen können, abhängig sein von Menschen, denen man gleichgültig ist und für die man trotzdem Interesse heucheln muß, wenn man sie auch verachtet, da man meint, sie ständen tief unter einem, eben, weil jedes beiderseitige Verstehen ausgeschlossen ist.“ — „Aber Mr. Young ertrug die Kümmerlichkeit seiner Heimatlosigkeit mit dem müden Lächeln eines Gentleman, wie ein alter zerfledderter Raubvogel, der mit beschnittenen Flügeln im Käfig auf seiner Stange hockt, mit dem allerletzten, geheimen Glühen einer jähzornigen Sehnsucht in den Augen“ — und wo in gleicher Nacht ein Weib ihm begegnet, das er seit Jahren nicht mehr gesehen hat und mit dem sein erstes himmelhoch jauchzendes Glück verknüpft war wie seine tiefsten, von Schuld zernagten Stunden; in dieser Nacht, wo er über sein Leben richtet, wird er sich dessen ganzer Schalheit und Leere bewußt, ist er der ewigen Surrogate überdrüssig, die das Leben ihm bietet, und will nach der einzigen Realität greifen, die ihm zugänglich ist: dem Tode. Seiner komplizierten, verwirrten, zerrissenen Seele ist das Leben in seiner Einfachheit und Größe nur fassbar in seiner Negation, im Tode. Und er überschaut, was er sein Leben genannt hat, und die Erinnerungen kommen und steigen auf vom Grunde seiner Seele, und mit der Feinheit des Literaten weiß ei sie zu genießen, aus ihnen ihren letzten, heimlichsten Duft hervorzuholen und aus Dämmerung und Halbbewusstsein sie gleich goldenen Spielkugeln in die Luft zu schleudern, zum Genussspiel seiner Nerven und Sinne. Und ganz aus dem geheimsten Fach seines Herzens kamen die verblassenden Erinnerungen an Jugend, Familie und väterliche Riten, und er sah sie vor sich mit jener letzten, ironischen Liebe, „die selbst der freie Jude noch heute für seine Riten hegt“, die kleine Betschule in einem unerhört schmierigen Hof, wo Männer mit wirren Bärten und mit Käppchen stehen in gelbweißen Seidenmänteln. Und im bräunlichen Dunkel des überfüllten Raumes schwammen mit rötlichen Höfen Kerzen, deren Lichter von dem unausgesetzten und doch so melodiösen Singsang der Litaneien ganz leise zitterten, in denen so eine wilde, fanatische Bitterkeit lag, zornig, freudlos und hingebend. Ja, das Haus möchte er noch einmal gerne sehen. Aber über all die Erinnerungen hinaus jagt ihn eines: der Tod, die Sehnsucht nach Ruhe, nach Endgültigem, nach Wahrheit.
Und doch ... er überlebt. In einer Krise seiner Nerven endet diese Nacht für ihn. Und draußen ist wieder der geschäftige, helle Tag, der ihm Schutz gibt, wo die Mühle der Lebenslügen lustig klappert, und bei diesem altgewohnten Klang kommt ihm die alte, müde, wissende Ruhe wieder. Was war das für eine Nacht gewesen! Ohne daß er es wollte, hatte er alle Labyrinthe des Menschlichen durchirrt, hatte weite Reisen gemacht — fast bis zur letzten verschlossenen Kammer. War überhaupt er der Reisende gewesen, er, Dr. Alwin Herzfeld, der ruhige Bewohner seiner stillen Zimmer mit ihren alten Möbeln und japanischen Bildern, oder ein anderer, den er vorher nie gekannt und den er auch nie wiedersehen wird? Und so geht er hin und ist etwas beschämt ob all des Gespensterspuks dieser Nacht. Es ist ihm, als hätte er auch die allerletzte Probe auf sein Menschentum nicht bestanden, als sei er nicht einmal zu dem geeignet gewesen, was jeder einfache Mensch, ohne viel nachzudenken, zu tun fähig ist. Aber die Monotonie seines trägen Lebens hat wieder Gewalt über ihn, all die kleinen Freuden, die er sich mühsam aus aller Kümmerlichkeit eines entgleisten Lebens zusammengelesen hat. Und Dr. Herzfelds Ahne Heinrich Heine lächelt ihm zu, ironisch, klug und müde, mit der gleichen unheimlichen Krankheit behaftet, unjung und nicht mehr ganz gesund, und doch voll glühender Sehnsucht nach dem Leben.
Es ist in vielem der Geist Heinrich Heines, der über dem Buche liegt, seine Sehnsucht nach alten griechischen Tempeln, nach ihrer unter tiefblauem Himmel emporblühenden strahlenden Heiterkeit, und seine Freude am Frühling und an den Mädchen, kurzrockig, schlank und hellblau. Und dabei die leise Ironie, daß das alles doch nur Spiel sei, die Erbschaft der Romantik, die Illusion haut und Illusion zerstört. Nur ist hier alles weiter und bunter, feiner und vielgestaltiger als bei Heine, das alte Lied erklingt in neuen, volleren Harmonien, über all dem liegt eine Heine fremde Art gütigen und doch überlegenen Verständnisses, und die Sprache hat einen weiten Weg gemacht in ihrer Geschmeidigkeit, ihrem Glänze und ihrer Treffsicherheit von Heine bis Dr. Herzfeld.
Und doch leiden beide an einem gleichen Übel, nur daß Herzfeld hier der Jüngere ist und damit der Spätere, der Vollendetere. In seinem Roman der beginnenden Entwurzelung des Berliner Juden, in seinem Jettchen Gebert, da stehen die einzelnen Menschen noch nicht einsam und allein da. In ihnen allen sind die Züge ein und derselben Familie unverkennbar, Familiengeist und -tracht, die sie alle an sich haben, unauslöschlich, vom uralten Eli Gebert bis zu Jettchen. Und in diesen Familienzügen sind mit gleicher meisterhafter Sicherheit die Rassenzüge eingeprägt, und so sind es nicht einzelne, einsame Menschen, deren Schicksal uns der Dichter malt, es ist das Leben und die Geschichte eines verbundenen Ganzen, einer Familie, eines Volkes, einer Rasse, das hinter dem Schicksal jedes einzelnen steht und von dem sich sein Lebensbild abhebt, sicher, ruhend und fest, getragen von Banden des Blutes, vom Boden der Tradition. Und es ist fast am Ende des Werkes, daß einer den Sinn des ganzen Buches zusammenfasst und ihn vor uns hinstellt, einer, der still und weise, ironisch und schmerzbeladen ist, Jason Gebert, der Philosoph und Liebhaber schöner Kunstgegenstände, vielleicht ein Großvater Dr. Alwin Herzfelds. Und, in der Art, wie er es sagt, da klingt es wieder wie von der Art seines Zeitgenossen Heinrich Heine: „Weißt du, man mag reden, was man will, Jettchen — eigentlich ist die Familie doch das Einzige, was uns Halt gibt im Leben. Es ist mit der Familie wie mit dem Ofen: solange es Sommer ist, wollen wir nichts von ihm wissen, und jedesmal, wenn wir durchs Zimmer gehen, stoßen wir uns daran, und wenn wir ihn anfassen, ist er hundekalt. Aber sowie es Winter ist, da merken wir erst, was er uns bedeutet, und was wir ohne ihn überhaupt wären.“ Und grimmiger, verzweifelter sagt es Dr. Herzfeld: „Wir leben unser Lebtag mit anderen Menschen, aber wir sterben mit der Familie.“
So endet die weite Reise des Dr. Herzfeld. Und mag sie ihn noch so weit geführt haben: die letzte verschlossene Kammer hat er nicht aufzusperren vermocht, zu den Wurzeln der Dinge konnte der Entwurzelte nicht steigen. Und so lebt er weiter und träumt vom Leben, das stark und berauschend ihn tragen würde wie jagende Pferde. Und hockt in dem Käfig seiner Surrogate, unjung und nicht mehr ganz gesund, mit beschnittenen Flügeln, ramponiert und glanzlos, und in den müden, trüben Augen ein allerletztes geheimes Glühen der Sehnsucht.
Dieses Kapitel ist Teil des Buches Juden in der deutschen Literatur

Peter Altenberg (1859-1919), österreichischer Schriftsteller

Arthur Schnitzler (1862-1931), österreichischer Erzähler und Dramatiker
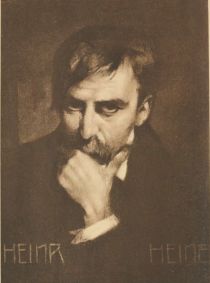
Heinrich Heine (1797-1856), deutscher Dichter und Journalist
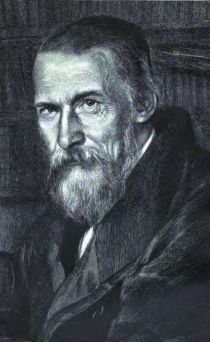
Wilhelm Raabe (1831-1910), deutscher Erzähler und Schriftsteller

Peer Gynt ist ein von Hendrik Ibsen geschriebenes dramatisches Gedicht

Hendrik Ibsen (1828-1906), norwegischer Schriftsteller
alle Kapitel sehen