Paul Cézanne (1839-1906) französischer Maler
Biographie und Bilder
Autor: Glaser, Curt (1879-1943) Arzt, Kunsthistoriker, Kunstkritiker und Sammler, Erscheinungsjahr: 1922
Themenbereiche
Enthaltene Themen: Paul Cézanne, Maler, Kunst, Malerei, Gemälde
Paul Cézanne war keines Meisters Schüler. Talent und Neigung wiesen dem Jüngling den Beruf des Malers. Aber ebenso schwer wurden ihm die ersten Schritte, der Widerstand gegen den Willen eines strengen Vaters und die Überwindung eigener Zweifel, wie der lange Weg zur Meisterschaft, den er ohne anderer Beistand bis zum Ende gehen musste.
Am 19. Januar 1839 wurde Cézanne geboren. In Aix wuchs er auf, besuchte die Schule, begann, dem Wunsche des Vaters folgend, das Studium der Rechte. Erst dem Zweiundzwanzigjährigen öffnete sich der Weg in die Freiheit. In der "Academie Suisse" in Paris begann die Laufbahn des Malers. Er lernte Guillaumin und Pissarro kennen, und er fand Aufnahme in dem Kreise der Künstler, die als die Impressionisten bekannt wurden.
*****************************
Am 19. Januar 1839 wurde Cézanne geboren. In Aix wuchs er auf, besuchte die Schule, begann, dem Wunsche des Vaters folgend, das Studium der Rechte. Erst dem Zweiundzwanzigjährigen öffnete sich der Weg in die Freiheit. In der "Academie Suisse" in Paris begann die Laufbahn des Malers. Er lernte Guillaumin und Pissarro kennen, und er fand Aufnahme in dem Kreise der Künstler, die als die Impressionisten bekannt wurden.
*****************************
Cézanne hat in seinen späteren Jahren ein hartes Urteil über die Arbeit seiner Jugend gefällt. Er klagte, er habe bis zu seinem vierzigsten Lebensjahre nichts Rechtes zustande gebracht und seine Zeit nutzlos vertrödelt. Wahr ist, dass er spät seinen Weg gefunden hat. Sein eigentliches Werk setzt nicht früher ein als um das Jahr 1879, da Manet, der nur sechs Jahre älter war, schon nahe dem Abschluss seines Lebens stand.
Cézanne hat anders begonnen als die Gefährten der Jugend, deren Schaffen von allem Anfang unter dem Zeichen des neuen Realismus stand. Er, der von der Knabenzeit her Zolas vertrauter Freund gewesen, sah keineswegs sein Ziel in sachlicher Naturabschrift. Er begeisterte sich im Louvre an Rubens und an den Venezianern, entwarf romantische Kompositionen in scheinbar ungeschickter, seltsam geballter Form, in dunkel glühenden Farben, die er dick auf die Leinwand strich und mit dem Spachtel modellierte. Sein Ideal war gedrängte Bewegung, barocke Komposition, es war eher das Ideal Daumiers als das Manets, und es kann kaum einem Zweifel unterliegen, er ebenso bewusst an Daumier anknüpfte, wie er zu Manet sich in Gegensatz stellte.
Cézanne bewunderte Manets glückliche Begabung, aber seine Bildvorstellung verlangte ein anderes Maß von Bewegung. Er malte im Jahre 1872 seine „Olympia“, statt der ruhig gelagerten, zierlichen Mädchengestalt Manets ein Weib mit hochgezogenen Knien, wie zu einem Klumpen verschoben, inmitten breit strömender Flächen schräger Tücher und Vorhänge, begleitet von den zwei dunklen Figuren eines schwerfällig sitzenden Mannes und der dienenden Negerin, die groß in dem Ausschnitt des Hintergrundes erscheint.
So baute sich in Cézannes Vorstellung ein Bild. In der Ausführung gab er nicht mehr als Anweisungen. Es war ein Beginn, eine erste Konzeption, und er klagte, dass es ihm nicht gegeben sei, zu gestalten, wie es die Venezianer gekonnt hätten, er sehnte sich nach der restlosen Verwirklichung seiner Vision, aber er hätte doch nicht mit Manet tauschen mögen, dem es nach seiner Ansicht an „Temperament“ fehlte.
„Temperament“ war Cézannes Lieblingswort. Man spürt, was es ihm bedeutet, wenn man seine frühen Bilder sieht, die von Spannung geladen sind, deren drängende Konturen ein Übermaß von innerer Bewegung zu sprengen droht. Man spürt es angesichts eines Selbstbildnisses jener Zeit, eines Kopfes, der von Leidenschaft zu brausen scheint, dessen Augen dunkel glühen, dessen Formen aufgewühlt sind von einer Unruhe, die das Gegenteil von Nervosität, die das Zeichen selbstverzehrender Kraft ist.
In wenigen Jahren reifte der Jüngling zum Mann. Die Wellen des Haares, die den kahlen Schädel rahmten, haben sich geglättet, dichter Bartwuchs überdeckt die sinnlich geschwungenen Lippen und das stark vorspringende Kinn. Die einstmals flackernden Augen blicken ruhig und streng. Die Kleidung verliert den romantischen Schwung, wird zum nüchternen Werktagsrock. So sah sich der Vierzigjährige, der seinen Weg und seine Kunst gefunden, der zu arbeiten gelernt hatte, anstatt zu träumen.
Nicht ohne äußeren Einfluss war der entscheidende Wandel erfolgt. Im Jahre 1872 war Cézanne, einer Einladung Dr. Gachets folgend, nach Auvers sur Oise übersiedelt, wo er Pissarro traf, dessen ernste methodische Arbeit starken Eindruck auf ihn übte, dessen unermüdliche Tätigkeit ihm ein Beispiel gab. Zum ersten Male räumte er einem Fremden Macht über sein eigenes Schaffen ein. Seine Palette erfuhr eine neue Zusammensetzung, seine Malweise änderte sich, die Farbe wurde nicht mehr dick und pastos aufgetragen, nicht mehr fest ineinander geknetet, die Leinwand wurde nur noch dünn gedeckt, mit der Spitze des Pinsels ein Ton frei neben den anderen gesetzt.
Es brauchte geraume Zeit, bis die neue Anschauung sich durchsetzte. Es dauerte Jahre, bis der neue Kern sich von der alten Schale befreite. Erst um 1880 setzte eine starke Produktivität ein, sie ist das Zeichen für das neugewonnene Selbstbewusstsein des Künstlers, der seinen Weg gefunden hat, dem die Arbeit Freude bereitet, weil sie Befriedigung schafft. Cézanne stellte seine Staffelei draußen in der Landschaft auf, er malte im Atelier unermüdlich Stilleben, ließ die wenigen Modelle, die er brauchte, am liebsten die eigene Frau, zu vielen Bildnissen sitzen.
Der Romantiker von einst bekannte sich zur Natur. „Ich male nichts, was ich nicht sehe,“ schrieb er, „ganz gewiss bin ich kein Dichter, doch ich bin ein Maler, das genügt wohl.“ Durch Cézanne hatte das Wort Malerei einen neuen Sinn erhalten. Malerei hieß ihm von nun an farbige Gestaltung, Aufbau des Bildes aus der Relation farbiger Teile. Manets Tonmalerei schien ihm „schmutzig“, seit er die Schönheit der reinen Farbe entdeckt hatte. Es gibt weder Zeichnung noch Modellierung, keine Konturen und keine Gegensätze von hell und dunkel in dieser neuen Malerei, die Cézannes eigenste Schöpfung ist. Aus dem reinen Nebeneinander von Farben in der Fläche entsteht der Eindruck einer natürlichen Gegebenheit. ,,Malen heißt, seine farbigen Empfindungen feststellen“, sagte Cézanne. Er konnte Stunden damit verbringen, die richtige Nuance für einen einzigen Pinselstrich zu suchen. Er konnte ein Modell in hundert Sitzungen beobachten, um seinem Gedächtnis jeden Zug einzuprägen. Er malte an einem Apfelstilleben bis die Früchte längst verfault waren. Er benutzte Papierblumen, weil sie nicht verwelken konnten, ehe sein Bild vollendet war, und er ließ viele Leinwände stehen, ehe sie ganz mit Farbe bedeckt waren, weil ihn das angefangene Werk nicht befriedigte, oder weil er über den Punkt, der erreicht war, nicht hinauszukommen glaubte.
Solche Methode kann pedantisch scheinen, und Cézanne nannte sich selbst in einer Anwandlung des Zweifels einen Gelehrten. Aber er war ein Künstler, und die Schöpfungen dieses methodischen Fleißes wurden die höchsten Offenbarungen neuer Malerei. Cézanne suchte in dem Bilde eine Harmonie der Töne, die ein Gleichnis der Wirklichkeit gibt, indem sie die Gegenstandsfarben in ihre neue Tonart transponiert, deren Akkorde und Kadenzen er ebenso sicher empfand, wie der Musiker die Klangfolgen seiner Partitur. Renoir hat das Wesentliche getroffen, wenn er einmal sagte: ,,Es ist erstaunlich, wenn Cézanne nur zwei Farbflecke auf die Leinwand setzt, so ist es schon etwas Außerordentliches“. Das war das Geheimnis des Meisters, das war seine Entdeckung, die revolutionäre Tat, die alle künftige Malerei vor eine neue Aufgabe stellte. Cézanne sah niemals eine Farbe isoliert, er hatte immer das sichere Gefühl für die gegenseitige Beziehung der Töne, und ein Bild war ihm ein vielstimmiger Zusammenklang von Farben, die in reinen Rhythmen einander begleiten und ergänzen.
Jeder Pinselstrich auf einem Gemälde Cézannes steht in einer festen Relation zu der Gesamtheit aller übrigen Teile der Fläche, darum zieht ein einziger Strich, der die Rhythmik des Bildes verändert, eine neue Organisation des Ganzen nach sich. Cézanne malte niemals an einem Teile seines Bildes, im Fortschreiten der Arbeit wurde ständig das Werk in seiner Gesamtheit gefördert. Es erscheint auf jeder Stufe fertig, weil es in sich vollkommen geschlossen ist, von der ersten Andeutung bis zur letzten Bereicherung, von der ersten Niederschrift einer Melodie bis zur vollen Orchestrierung der Farben.
Wenn Cézanne zeichnet, bildet er nicht trennende Konturen, sondern er teilt feine Flecken über das Papier aus, er tieft keine Schatten mit schwellenden Dunkelheiten, sondern er stellt mit einem gleichmäßig schwebenden Bleistiftstrich Flächenbeziehungen von Schwarz und Weiß her. Ähnlich wie eine Zeichnung entsteht ein Aquarell aus leichten Farbflecken, deren Helligkeitswert kaum unterschieden ist, die im Schatten nicht minder leuchten als im Lichte, und die Raum und Gegenstand nicht mit den Künsten der Perspektive und Modellierung beschreiben, sondern in dem Geflecht durchsichtiger Farben wie eine Vision der Wirklichkeit erstehen lassen.
Worte vermögen die Methode zu erklären, aber nicht den Sinn und die Schönheit des Kunstwerkes zu deuten. Auch die Künstlerschaft Cézannes gründet sich nicht auf eine Erkenntnis, die nach seinem Tode in einer neuen akademischen Lehre ausgemünzt wurde, vielmehr auf jene geheimnisvolle Gabe schöpferischer Kraft, die über die Jahrhunderte hinweg die Meister aller Zeiten miteinander verbindet. Cézanne hat eine neue Schönheit geschaffen. Er fand das Gold in der Asche, im irdischen Staub das zeitlose Wesen. Kein Maler war minder abhängig vom Motiv, verwirklichte reiner die Idee seiner Kunst in dem farbigen Rhythmus der Fläche. Cézanne hat niemals schöne Modelle gesucht, nicht wie Manet elegante Pariserinnen, nicht wie Renoir liebliche Mädchen, er hat die dumpfen Frauen und Männer seiner Umgebung gemalt. Er brauchte nicht glänzende Stillleben und nicht eine interessante Landschaft. Er hat die Schönheit niemals außerhalb, sondern immer nur innerhalb seiner Kunst gefunden. Aber sein Bildideal erfüllte sich darum nicht in einer abstrakten Flächenrhythmik. Der Wille des Schaffenden war immer auf die Darstellung einer Realität gerichtet, und zur Wirkung seines Werkes gehört nicht zuletzt das eigentümliche Spannungsverhältnis zwischen Welt und Bild, zwischen Geschautem und Gestaltetem. Cézanne wollte die Fläche, aber er meinte den Raum. Jeder Farbfleck erhält eine raumbildende Bedeutung. Cezanne wehrte sich mit aller Entschiedenheit gegen das Missverständnis Gauguins, der absichtlich flächenhaft stilisierte und exotische Modelle suchte, um sich aus der Realität des Alltags in ein künstliches Paradies zu flüchten.
Cézanne tat einen Blick in das wahre Paradies. Er entdeckte die unvergängliche Schönheit in einer scheinbar ausgeschöpften Welt. Er wollte ebenso weit gelangen wie die Alten, aber nicht mehr wie einst, als er unmittelbar an Delacroix und Daumier anknüpfte. Aus eigener Kraft, auf dem eigenen Wege trachtete er das große Ziel zu verwirklichen, die Schönheit, die Poussin geschaut hatte, von neuem der Natur zu entreißen. Cézannes höchstes Ziel war die freie Figurenkomposition, um die er seit seiner Jugend gerungen, die er im Alter zu verwirklichen hoffte. Seine Gedanken kreisten um große Bilder mit nackten Gestalten. Er entwarf viele Kompositionen in kleinem Format, und er übermalte immer von neuem das große Gemälde, das zehn Jahre lang in seiner Werkstatt stand, um zu jener Versöhnung von Form und Farbe, von Fläche und Raum, von Körper und Rhythmus, von Wirklichkeit und Phantasie zu gelangen, die ihm in aller seiner Arbeit als höchstes Ideal vorschwebte.
Die Bilder badender Menschen in idealer Landschaft sind die Krönung von Cézannes Schöpfung. Hier sammelte er alle seine Erfahrung, um frei von der Realität eine neue Schönheit zu finden. In diesen festlichen Kompositionen erfüllte sich die alte Sehnsucht des Malers. Hier schuf er ganz rein aus der Phantasie, wie die Venezianer es getan hatten. Cézanne zeichnete nackte Körper nach Skulpturen und Gemälden alter Meister, und er nährte sein Formengedächtnis an eigenen Aktstudien früherer Jahre. So entwarf der Sechzigjährige figurenreiche Bilder in der einsamen Werkstatt. Er ertrug es nicht, dass Fremde ihn beim Malen beobachteten, und der Überempfindliche scheute die Gegenwart nackter weiblicher Modelle, die dem streng konservativen und kirchengläubigen Manne üble Nachrede bei den Bürgern der kleinen Provinzstadt eingetragen hätte. Aber der letzte Grund seiner Enthaltsamkeit war das Bedürfnis nach völliger Unabhängigkeit vom Modell in der Stunde der Schöpfung. Das Auge, das sich in hundert Studien vollgesaugt hatte an der Wirklichkeit, wandte sich nach innen, da es galt, das Bleibende zu suchen, im Gegensatz zu dem vergänglichen Schein des Wirklichen das dauerhafte Werk zu gestalten, aus der eigenen Vorstellung etwas zu bilden, das würdig sei, neben dem Werke Poussins, neben der ,,Kunst der Museen“ sich zu behaupten.
Cézanne war allmählich in Paris ein Fremder geworden. Immer längere Zeit verbrachte er in seiner Vaterstadt Aix, wo er in einer engen, bigotten Umgebung, von der Zuckerkrankheit gequält, in fast völliger Abgeschiedenheit lebte. Sein Vater, der im Jahre 1886 gestorben war, hatte ihm ein ansehnliches Vermögen hinterlassen. So brauchte er sich nicht um die Notdurft des Daseins zu sorgen. Er dachte nicht an den Verkauf seiner Bilder. Er achtete ihrer kaum. Es kam vor, dass eine angefangene Leinwand draußen vergessen, im Regen verkam, und nicht selten zerstörte er in leidenschaftlichen Ausbrüchen die eigenen Schöpfungen.
Wenige drangen in diesen späten Tagen zu ihm vor. Emile Bernard wagte die Reise und fand Zutritt bei dem Misstrauischen, der immer argwöhnte, man wolle ihm einen Kniff ablernen. Vollard stand, seit er es im Jahre 1895 zum ersten Male unternommen hatte, in seinem Laden in der Rue Laffitte die seltsamen Bilder den Parisern zu zeigen, in regelmäßigem Verkehr mit dem Maler. Der Sohn seines Freundes Gasquet gewann in Aix allmählich das Vertrauen des Alten, der ihn tiefer als andere in das Geheimnis seines Denkens und Schaffens blicken ließ. Gasquets Aufzeichnungen enthüllen etwas von der Tragik dieses Künstlerschicksals, das nicht in äußeren Kämpfen, sondern in dem steten Ringen mit dem eigenen Dämon sich erfüllte.
Am 22. Oktober des Jahres 1906 ist Cézanne gestorben. Wie er keinen Lehrer hatte, hinterließ er keinen Schüler. Er hat in seinem Alter oft geklagt, dass all sein Wissen mit ihm dahingehen müsse. Er hat keinen gefunden, der würdig gewesen wäre, seine Unterweisung zu empfangen. Erst nach seinem Tode wuchsen sein Ruhm und sein Einfluss. Eine Generation jüngerer Künstler beugt sich ihm in Verehrung. Seine Bilder werden von vielen unbedenklich nachgeahmt, seine Worte geflissentlich missdeutet. Sein Werk aber blieb unerreicht, und im Abstand der Jahre, in der Perspektive der Geschichte, in die es langsam hineinwächst, steigt es immer höher empor über die Schöpfung einstiger Genossen seiner Jugend.
Cézanne hat anders begonnen als die Gefährten der Jugend, deren Schaffen von allem Anfang unter dem Zeichen des neuen Realismus stand. Er, der von der Knabenzeit her Zolas vertrauter Freund gewesen, sah keineswegs sein Ziel in sachlicher Naturabschrift. Er begeisterte sich im Louvre an Rubens und an den Venezianern, entwarf romantische Kompositionen in scheinbar ungeschickter, seltsam geballter Form, in dunkel glühenden Farben, die er dick auf die Leinwand strich und mit dem Spachtel modellierte. Sein Ideal war gedrängte Bewegung, barocke Komposition, es war eher das Ideal Daumiers als das Manets, und es kann kaum einem Zweifel unterliegen, er ebenso bewusst an Daumier anknüpfte, wie er zu Manet sich in Gegensatz stellte.
Cézanne bewunderte Manets glückliche Begabung, aber seine Bildvorstellung verlangte ein anderes Maß von Bewegung. Er malte im Jahre 1872 seine „Olympia“, statt der ruhig gelagerten, zierlichen Mädchengestalt Manets ein Weib mit hochgezogenen Knien, wie zu einem Klumpen verschoben, inmitten breit strömender Flächen schräger Tücher und Vorhänge, begleitet von den zwei dunklen Figuren eines schwerfällig sitzenden Mannes und der dienenden Negerin, die groß in dem Ausschnitt des Hintergrundes erscheint.
So baute sich in Cézannes Vorstellung ein Bild. In der Ausführung gab er nicht mehr als Anweisungen. Es war ein Beginn, eine erste Konzeption, und er klagte, dass es ihm nicht gegeben sei, zu gestalten, wie es die Venezianer gekonnt hätten, er sehnte sich nach der restlosen Verwirklichung seiner Vision, aber er hätte doch nicht mit Manet tauschen mögen, dem es nach seiner Ansicht an „Temperament“ fehlte.
„Temperament“ war Cézannes Lieblingswort. Man spürt, was es ihm bedeutet, wenn man seine frühen Bilder sieht, die von Spannung geladen sind, deren drängende Konturen ein Übermaß von innerer Bewegung zu sprengen droht. Man spürt es angesichts eines Selbstbildnisses jener Zeit, eines Kopfes, der von Leidenschaft zu brausen scheint, dessen Augen dunkel glühen, dessen Formen aufgewühlt sind von einer Unruhe, die das Gegenteil von Nervosität, die das Zeichen selbstverzehrender Kraft ist.
In wenigen Jahren reifte der Jüngling zum Mann. Die Wellen des Haares, die den kahlen Schädel rahmten, haben sich geglättet, dichter Bartwuchs überdeckt die sinnlich geschwungenen Lippen und das stark vorspringende Kinn. Die einstmals flackernden Augen blicken ruhig und streng. Die Kleidung verliert den romantischen Schwung, wird zum nüchternen Werktagsrock. So sah sich der Vierzigjährige, der seinen Weg und seine Kunst gefunden, der zu arbeiten gelernt hatte, anstatt zu träumen.
Nicht ohne äußeren Einfluss war der entscheidende Wandel erfolgt. Im Jahre 1872 war Cézanne, einer Einladung Dr. Gachets folgend, nach Auvers sur Oise übersiedelt, wo er Pissarro traf, dessen ernste methodische Arbeit starken Eindruck auf ihn übte, dessen unermüdliche Tätigkeit ihm ein Beispiel gab. Zum ersten Male räumte er einem Fremden Macht über sein eigenes Schaffen ein. Seine Palette erfuhr eine neue Zusammensetzung, seine Malweise änderte sich, die Farbe wurde nicht mehr dick und pastos aufgetragen, nicht mehr fest ineinander geknetet, die Leinwand wurde nur noch dünn gedeckt, mit der Spitze des Pinsels ein Ton frei neben den anderen gesetzt.
Es brauchte geraume Zeit, bis die neue Anschauung sich durchsetzte. Es dauerte Jahre, bis der neue Kern sich von der alten Schale befreite. Erst um 1880 setzte eine starke Produktivität ein, sie ist das Zeichen für das neugewonnene Selbstbewusstsein des Künstlers, der seinen Weg gefunden hat, dem die Arbeit Freude bereitet, weil sie Befriedigung schafft. Cézanne stellte seine Staffelei draußen in der Landschaft auf, er malte im Atelier unermüdlich Stilleben, ließ die wenigen Modelle, die er brauchte, am liebsten die eigene Frau, zu vielen Bildnissen sitzen.
Der Romantiker von einst bekannte sich zur Natur. „Ich male nichts, was ich nicht sehe,“ schrieb er, „ganz gewiss bin ich kein Dichter, doch ich bin ein Maler, das genügt wohl.“ Durch Cézanne hatte das Wort Malerei einen neuen Sinn erhalten. Malerei hieß ihm von nun an farbige Gestaltung, Aufbau des Bildes aus der Relation farbiger Teile. Manets Tonmalerei schien ihm „schmutzig“, seit er die Schönheit der reinen Farbe entdeckt hatte. Es gibt weder Zeichnung noch Modellierung, keine Konturen und keine Gegensätze von hell und dunkel in dieser neuen Malerei, die Cézannes eigenste Schöpfung ist. Aus dem reinen Nebeneinander von Farben in der Fläche entsteht der Eindruck einer natürlichen Gegebenheit. ,,Malen heißt, seine farbigen Empfindungen feststellen“, sagte Cézanne. Er konnte Stunden damit verbringen, die richtige Nuance für einen einzigen Pinselstrich zu suchen. Er konnte ein Modell in hundert Sitzungen beobachten, um seinem Gedächtnis jeden Zug einzuprägen. Er malte an einem Apfelstilleben bis die Früchte längst verfault waren. Er benutzte Papierblumen, weil sie nicht verwelken konnten, ehe sein Bild vollendet war, und er ließ viele Leinwände stehen, ehe sie ganz mit Farbe bedeckt waren, weil ihn das angefangene Werk nicht befriedigte, oder weil er über den Punkt, der erreicht war, nicht hinauszukommen glaubte.
Solche Methode kann pedantisch scheinen, und Cézanne nannte sich selbst in einer Anwandlung des Zweifels einen Gelehrten. Aber er war ein Künstler, und die Schöpfungen dieses methodischen Fleißes wurden die höchsten Offenbarungen neuer Malerei. Cézanne suchte in dem Bilde eine Harmonie der Töne, die ein Gleichnis der Wirklichkeit gibt, indem sie die Gegenstandsfarben in ihre neue Tonart transponiert, deren Akkorde und Kadenzen er ebenso sicher empfand, wie der Musiker die Klangfolgen seiner Partitur. Renoir hat das Wesentliche getroffen, wenn er einmal sagte: ,,Es ist erstaunlich, wenn Cézanne nur zwei Farbflecke auf die Leinwand setzt, so ist es schon etwas Außerordentliches“. Das war das Geheimnis des Meisters, das war seine Entdeckung, die revolutionäre Tat, die alle künftige Malerei vor eine neue Aufgabe stellte. Cézanne sah niemals eine Farbe isoliert, er hatte immer das sichere Gefühl für die gegenseitige Beziehung der Töne, und ein Bild war ihm ein vielstimmiger Zusammenklang von Farben, die in reinen Rhythmen einander begleiten und ergänzen.
Jeder Pinselstrich auf einem Gemälde Cézannes steht in einer festen Relation zu der Gesamtheit aller übrigen Teile der Fläche, darum zieht ein einziger Strich, der die Rhythmik des Bildes verändert, eine neue Organisation des Ganzen nach sich. Cézanne malte niemals an einem Teile seines Bildes, im Fortschreiten der Arbeit wurde ständig das Werk in seiner Gesamtheit gefördert. Es erscheint auf jeder Stufe fertig, weil es in sich vollkommen geschlossen ist, von der ersten Andeutung bis zur letzten Bereicherung, von der ersten Niederschrift einer Melodie bis zur vollen Orchestrierung der Farben.
Wenn Cézanne zeichnet, bildet er nicht trennende Konturen, sondern er teilt feine Flecken über das Papier aus, er tieft keine Schatten mit schwellenden Dunkelheiten, sondern er stellt mit einem gleichmäßig schwebenden Bleistiftstrich Flächenbeziehungen von Schwarz und Weiß her. Ähnlich wie eine Zeichnung entsteht ein Aquarell aus leichten Farbflecken, deren Helligkeitswert kaum unterschieden ist, die im Schatten nicht minder leuchten als im Lichte, und die Raum und Gegenstand nicht mit den Künsten der Perspektive und Modellierung beschreiben, sondern in dem Geflecht durchsichtiger Farben wie eine Vision der Wirklichkeit erstehen lassen.
Worte vermögen die Methode zu erklären, aber nicht den Sinn und die Schönheit des Kunstwerkes zu deuten. Auch die Künstlerschaft Cézannes gründet sich nicht auf eine Erkenntnis, die nach seinem Tode in einer neuen akademischen Lehre ausgemünzt wurde, vielmehr auf jene geheimnisvolle Gabe schöpferischer Kraft, die über die Jahrhunderte hinweg die Meister aller Zeiten miteinander verbindet. Cézanne hat eine neue Schönheit geschaffen. Er fand das Gold in der Asche, im irdischen Staub das zeitlose Wesen. Kein Maler war minder abhängig vom Motiv, verwirklichte reiner die Idee seiner Kunst in dem farbigen Rhythmus der Fläche. Cézanne hat niemals schöne Modelle gesucht, nicht wie Manet elegante Pariserinnen, nicht wie Renoir liebliche Mädchen, er hat die dumpfen Frauen und Männer seiner Umgebung gemalt. Er brauchte nicht glänzende Stillleben und nicht eine interessante Landschaft. Er hat die Schönheit niemals außerhalb, sondern immer nur innerhalb seiner Kunst gefunden. Aber sein Bildideal erfüllte sich darum nicht in einer abstrakten Flächenrhythmik. Der Wille des Schaffenden war immer auf die Darstellung einer Realität gerichtet, und zur Wirkung seines Werkes gehört nicht zuletzt das eigentümliche Spannungsverhältnis zwischen Welt und Bild, zwischen Geschautem und Gestaltetem. Cézanne wollte die Fläche, aber er meinte den Raum. Jeder Farbfleck erhält eine raumbildende Bedeutung. Cezanne wehrte sich mit aller Entschiedenheit gegen das Missverständnis Gauguins, der absichtlich flächenhaft stilisierte und exotische Modelle suchte, um sich aus der Realität des Alltags in ein künstliches Paradies zu flüchten.
Cézanne tat einen Blick in das wahre Paradies. Er entdeckte die unvergängliche Schönheit in einer scheinbar ausgeschöpften Welt. Er wollte ebenso weit gelangen wie die Alten, aber nicht mehr wie einst, als er unmittelbar an Delacroix und Daumier anknüpfte. Aus eigener Kraft, auf dem eigenen Wege trachtete er das große Ziel zu verwirklichen, die Schönheit, die Poussin geschaut hatte, von neuem der Natur zu entreißen. Cézannes höchstes Ziel war die freie Figurenkomposition, um die er seit seiner Jugend gerungen, die er im Alter zu verwirklichen hoffte. Seine Gedanken kreisten um große Bilder mit nackten Gestalten. Er entwarf viele Kompositionen in kleinem Format, und er übermalte immer von neuem das große Gemälde, das zehn Jahre lang in seiner Werkstatt stand, um zu jener Versöhnung von Form und Farbe, von Fläche und Raum, von Körper und Rhythmus, von Wirklichkeit und Phantasie zu gelangen, die ihm in aller seiner Arbeit als höchstes Ideal vorschwebte.
Die Bilder badender Menschen in idealer Landschaft sind die Krönung von Cézannes Schöpfung. Hier sammelte er alle seine Erfahrung, um frei von der Realität eine neue Schönheit zu finden. In diesen festlichen Kompositionen erfüllte sich die alte Sehnsucht des Malers. Hier schuf er ganz rein aus der Phantasie, wie die Venezianer es getan hatten. Cézanne zeichnete nackte Körper nach Skulpturen und Gemälden alter Meister, und er nährte sein Formengedächtnis an eigenen Aktstudien früherer Jahre. So entwarf der Sechzigjährige figurenreiche Bilder in der einsamen Werkstatt. Er ertrug es nicht, dass Fremde ihn beim Malen beobachteten, und der Überempfindliche scheute die Gegenwart nackter weiblicher Modelle, die dem streng konservativen und kirchengläubigen Manne üble Nachrede bei den Bürgern der kleinen Provinzstadt eingetragen hätte. Aber der letzte Grund seiner Enthaltsamkeit war das Bedürfnis nach völliger Unabhängigkeit vom Modell in der Stunde der Schöpfung. Das Auge, das sich in hundert Studien vollgesaugt hatte an der Wirklichkeit, wandte sich nach innen, da es galt, das Bleibende zu suchen, im Gegensatz zu dem vergänglichen Schein des Wirklichen das dauerhafte Werk zu gestalten, aus der eigenen Vorstellung etwas zu bilden, das würdig sei, neben dem Werke Poussins, neben der ,,Kunst der Museen“ sich zu behaupten.
Cézanne war allmählich in Paris ein Fremder geworden. Immer längere Zeit verbrachte er in seiner Vaterstadt Aix, wo er in einer engen, bigotten Umgebung, von der Zuckerkrankheit gequält, in fast völliger Abgeschiedenheit lebte. Sein Vater, der im Jahre 1886 gestorben war, hatte ihm ein ansehnliches Vermögen hinterlassen. So brauchte er sich nicht um die Notdurft des Daseins zu sorgen. Er dachte nicht an den Verkauf seiner Bilder. Er achtete ihrer kaum. Es kam vor, dass eine angefangene Leinwand draußen vergessen, im Regen verkam, und nicht selten zerstörte er in leidenschaftlichen Ausbrüchen die eigenen Schöpfungen.
Wenige drangen in diesen späten Tagen zu ihm vor. Emile Bernard wagte die Reise und fand Zutritt bei dem Misstrauischen, der immer argwöhnte, man wolle ihm einen Kniff ablernen. Vollard stand, seit er es im Jahre 1895 zum ersten Male unternommen hatte, in seinem Laden in der Rue Laffitte die seltsamen Bilder den Parisern zu zeigen, in regelmäßigem Verkehr mit dem Maler. Der Sohn seines Freundes Gasquet gewann in Aix allmählich das Vertrauen des Alten, der ihn tiefer als andere in das Geheimnis seines Denkens und Schaffens blicken ließ. Gasquets Aufzeichnungen enthüllen etwas von der Tragik dieses Künstlerschicksals, das nicht in äußeren Kämpfen, sondern in dem steten Ringen mit dem eigenen Dämon sich erfüllte.
Am 22. Oktober des Jahres 1906 ist Cézanne gestorben. Wie er keinen Lehrer hatte, hinterließ er keinen Schüler. Er hat in seinem Alter oft geklagt, dass all sein Wissen mit ihm dahingehen müsse. Er hat keinen gefunden, der würdig gewesen wäre, seine Unterweisung zu empfangen. Erst nach seinem Tode wuchsen sein Ruhm und sein Einfluss. Eine Generation jüngerer Künstler beugt sich ihm in Verehrung. Seine Bilder werden von vielen unbedenklich nachgeahmt, seine Worte geflissentlich missdeutet. Sein Werk aber blieb unerreicht, und im Abstand der Jahre, in der Perspektive der Geschichte, in die es langsam hineinwächst, steigt es immer höher empor über die Schöpfung einstiger Genossen seiner Jugend.

1. Selbstporträt. Um 1872

2. Selbstporträt. Um 1879

3. Bacchanal. Um 1870

4. Olympia. 1871

5. Sommertag. 1871

6. Bahndurchstich. Um 1878
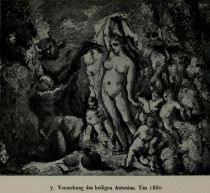
7. Versuchung des heiligen Antonius. Um 1880

8. L Estaque. Um 1883

9. Gardanne. Um 1885
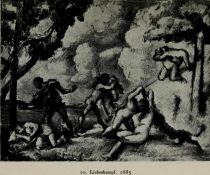
10. Liebeskampf. 1885

11. Stilleben. Um 1885

12. Stilleben. Um 1885

13. Mardi gras. Um 1888

14. Porträt Gustave Geffroy. Um 1890

15. Frau Cézanne. 1891

16. Die Spieler. 1892

17. Alte Frau. 1896

18. Schloss im Wald. Um 1904

19. Die Badenden. 1895 bis 1905

20. Hermes, nach Pigalle. Zeichnung