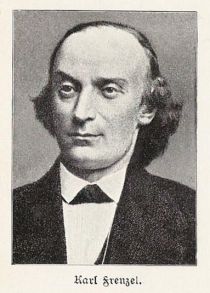Auf stiller Heide
Eine Wanderung auf der Insel Rügen
Autor: Frenzel, Karl (1827-1914) Romanschriftsteller, Essayist und Theaterkritiker, Erscheinungsjahr: 1863
Themenbereiche
Enthaltene Themen: Mecklenburg-Vorpommern, Insel Rügen, Wanderung, Land und Leute, Reisebericht
An einem Augustabend, im ersten Beginn der Dämmerstunde, ging ein Wanderer einen einsamen, stillen Weg.
Wäre ihm einer entgegengekommen, würde ihm an dem noch jugendlichen, schlanken Mann nichts aufgefallen sein, als dass er eben nach seiner Kleidung und noch mehr nach der freien und nicht ungefälligen Weise, in der er sie trug, ein Reisender aus den sogenannten „bessern“ Ständen sei, der zum Vergnügen eine Fußtour durch die Insel machte — einen Spaziergang nach jenen Buchenwäldern, deren mächtige Stämme der Epheu umrankt, dem dunkeln, tiefschwarzen Moorteich und den kreidigen, von fern wie gediegenes Silber schimmernden Uferfelsen, die dies nordische Eiland in den blauen Wogen der Ostsee ebenso eigentümlich schmücken wie ihre Palmen, ihr Vulkan, ihre gesunkenen griechischen Tempelsäulen unten im Süden die liedergefeierte Insel Sizilien.
*******************************
Wäre ihm einer entgegengekommen, würde ihm an dem noch jugendlichen, schlanken Mann nichts aufgefallen sein, als dass er eben nach seiner Kleidung und noch mehr nach der freien und nicht ungefälligen Weise, in der er sie trug, ein Reisender aus den sogenannten „bessern“ Ständen sei, der zum Vergnügen eine Fußtour durch die Insel machte — einen Spaziergang nach jenen Buchenwäldern, deren mächtige Stämme der Epheu umrankt, dem dunkeln, tiefschwarzen Moorteich und den kreidigen, von fern wie gediegenes Silber schimmernden Uferfelsen, die dies nordische Eiland in den blauen Wogen der Ostsee ebenso eigentümlich schmücken wie ihre Palmen, ihr Vulkan, ihre gesunkenen griechischen Tempelsäulen unten im Süden die liedergefeierte Insel Sizilien.
*******************************
Für ein durch landschaftliche Schönheiten verwöhntes Auge, das viel gesehen, für ein Gemüt, das sich nur wenig von dem Schauer und dem Reiz der Einsamkeit berührt fühlt — und beides schien der Wanderer zu besitzen — bot die Gegend umher nichts Anziehendes.
Ein langgedehnter schmaler Heidestreifen, der den eigentlichen Leib der Insel mit einer nach Norden sich ausstreckenden Halbinsel verbindet . . . weder vorwärts noch rückwärts schauend, kann der Blick auf einer Baumgruppe ausruhen, flach und öde alles, gleichmäßig eintönig, ein schlechter Weg, den man mühsam neben den tiefen Wagengleisen verfolgen muss und der scheinbar so in die Endlosigkeit ohne Ziel dahinläuft. Hier und dort ist niedriges Fichtengestrüpp zu kleinen Gebüschen zusammengewachsen; das einzige Grün, das den Boden farbiger kleidet, ist das des üppig wuchernden Ginsters; sonst herrscht weithin ein braunrötlicher Ton von dem Heidekraut, das sich flechtenartig über den Sand hinzieht, und den schmächtigen, blassroten Ericas, die dazwischen ausschießen. Aber ganz von allem Zauber ist auch diese Landschaft nicht verlassen, die im Munde der Umwohnenden die „Schmale Heide“ heißt; nur freilich ist nicht jedes Menschenauge für diesen Zauber empfänglich geschaffen. Denn der Wanderer konnte über die Fichtengebüsche hinweg zur linken wie zur rechten Hand das Meer sehen, dessen Wellen an diesem sandigen und flachen Strande verrinnen. Zuweilen, bei der tiefen Stille umher, schlug das Geräusch einer heranbrausenden mächtigern Welle, ehe sie sich den Kopf an den Steinen des Ufers schäumend zerstieß, an sein Ohr. In gleichen Zwischenräumen kehrte dieser Ton wieder, dumpf und langsam heranrollend und so verhallend. In goldenen und purpurnen, in violetten und grünlich schimmernden Wolken zerflatterte am West-Himmel das Abendrot. Auf dieser Seite bildet das Meer eine tiefeinschneidende, geschützte Bucht, der „Kleine Bodden“ genannt; eine Landzunge, die in einer von Fichten und Buchen bestandenen Anhöhe endet, zieht sich in die See hinein; ein kleines Eiland wird darin sichtbar; in eigentümlicher Farbenwirkung hob sich das Dunkelgrün des Uferbergs von den breiten goldgelben Wolkenstreifen ab. Im Osten wölbte der Himmel sein graublaues Gewölbe über dem offenen, grauen Meer. Von dorther kamen die Nebel gezogen, nah und näher, gespenstisch zusammengeballt, als wandelten die alten Götter des Nordens, riesige Gestalten in ihren Regenmänteln, mit unhörbar leisen Schritten auf den Wassern hin.
Der Reisende hatte einen weiten Tagesmarsch gemacht und da er nach seiner Berechnung noch eine tüchtige Strecke Wegs vor sich hatte, ehe er den „Heidekrug“ erreichte, wo er zu übernachten beschlossen, setzte er sich ermüdet auf einen der hohen Steine, die, zwischen dem Ginster verstreut, von einer dürftigen Moosdecke übersponnen lagen. In seinem weder bedeutsamen noch abstoßenden Gesicht malte sich unverkennbar Verdruss, üble Laune. „Warum bist du auch auf den närrischen Einfall gekommen“, schien er sich zu sagen, „statt im Wagen behaglich diesen langweiligen Weg mit guten Pferden zu durchfliegen, ihn auf deinen eigenen Füßen schneckengleich hinzukriechen! Solche Tollheiten überlässt man doch Studenten, Handwerksburschen oder Landschaftsmalern, die eine schöne Aussicht suchen. Melancholisch ist's hier“ — und nun schaute er sich um — „Sand und Steine und Heidekraut. Und drüben das Meer — das alles soll dichterische Gefühle erwecken, die Seele stimmen, dass sie wie eine Harfe erklingt, in deren Saiten eine göttliche Hand greift. Wer hätte das nicht gehört und nachgesprochen? Ich mag solche Gefühlsschwärmereien im Anblick der Natur nicht leiden, mit denen wir noch lieber als die andern uns selbst belügen, um vor dem eigenen Spiegel als empfindungsreiche und begabte Menschen zu erscheinen! Nun, ich meinerseits wünschte, ich säße an einer guten Wirtshaustafel und hätte keine andere Aussicht als die auf ein gutes Bett.“
Diese und ähnliche Gedanken hätte ohne viel Scharfsinn jeder aus dem verdrossenen Gesicht des Fremden gelesen, wenn er hineingeblickt. Aber es kam niemand dieses Wegs, nur die Möwen flogen über den Wasserspiegel. Sein Ranzel hatte der Wanderer neben sich auf den Boden gelegt, den breiten, von einem schwarzen Seidenband eingefassten Strohhut abgenommen; der Wind, der erfrischend von der See herüberstrich, spielte in seinem blonden, leichtgelockten Haar.
Allmählich tiefer war die Dämmerung gesunken, wie rotes Gold schien der Sonnenball zu zerschmelzen und der Widerschein lag verglühend über der Heide.
Am Himmel im Sonnenuntergang das schönste Bild irdischer Vergänglichkeit, unten in der See das Symbol einer einsamen Unendlichkeit, farblos, aber gerade durch diesen Mangel großartig, herzergreifend und klangvoll zugleich. Oft ist es uns, als müsste der Gesang der Sphären, von dem die Dichter träumen, so an das Ohr der Gottheit tönen wie an das unsere, wenn wir mit geschlossenen Augen beim Heranschreiten der Nacht auf den Strandsteinen sitzen, das Rauschen des Meeres.
Jetzt erhob sich der junge Mann, nahm sein Ränzel wieder auf und schickte sich zum Weitergehen an. Sei es aus Ärger oder um seines Unmuts los und ledig zu werden, er begann ein Lied zu pfeifen. Noch einmal sah er nach der Seite des Boddens hin, wo die Fichtengebüsche dichter standen: zwei Gestalten schritten von dorther langsam dem Fahrwege näher.
„Menschen in dieser Öde“, dachte der Reisende; „vielleicht gar Gefährten, die auch nach dem Heidekrug wollen“. . . Und da er gerade in der Stimmung war, die ihm Gesellschafter willkommen machte, um ihnen seinen Verdruss zu klagen, so blieb er stehen.
Bald erkannte er nun zwar seinen Irrtum, denn die eine der Nahenden war eine Dame und ihr Begleiter, der, wie es ihm schien, absichtlich einige Schritte hinter ihr zurückblieb, im grünen Jagdrock, die Büchse über die Schulter geworfen, der Förster aus der Försterei, an der er selbst vor kurzer Zeit vorübergegangen. Dennoch stand er still, den rechten Fuß mit einem gewissen Trotz auf den Stein stemmend, darauf er bisher gesessen.
Die Herankommenden wechselten kein Wort. Von ihrem dunkeln, breitrandigen Hut, den etwas phantastisch eine schwarze Feder schmücke, hatte die Dame den Schleier niedergeschlagen, in ihrer Hand trug sie eine Zeichenmappe. Alles, als der Fremde sie mit neugierigem Blick musterte, war schwarz an ihr; schwarz das Kleid, die Handschuhe, der Schleier, der ihr Gesicht verhüllte, die kleinen Kügelchen der Kette, die sie um den Hals geschlungen hatte. Hoch hinauf ging das Kleid, oben war es mit einem schmalen Streifen schwarzer Spitzen besetzt. Sowohl die Dämmerung wie der Schleier ließen die Züge ihres Antlitzes kaum erkennen. Ohne seine Stellung zu verändern, hatte der Reisende doch, als sie ganz nahe an dem Stein vorbeischritt, in unwillkürlicher Bewegung leicht grüßend sich verneigt. Mit vornehmer Herablassung, als sei sie früh an die Unterwürfigkeit der andern gewöhnt, dankte sie.
Dies zumeist bestimmte den Fremden, an den ihr folgenden Förster eine Frage zu richten; denn es quälte ihn, dass er am Ende für einen lästigen Neugierigen gehalten werden könnte, der sich ihr in den Weg gestellt — je nun, wie sich die Gaffer auf der Straße versammeln, wenn eine Prinzessin vorüberfährt. So sollte sie nicht von ihm denken; mit seiner Frage wollte er sein Verweilen entschuldigen.
Wenn er geahnt, welche Verwickelungen sich für ihn an diese Eine harmlose Frage knüpften!
„Schönen guten Abend! Ist es noch weit bis nach dem Heidekrug?“
„Drei Viertelstunden, wenn Sie nicht große Schritte machen wollen“, antwortete der Förster und sah sich den Fragenden gutmütig lächelnd an. „Aber das Nachtquartier wird Ihnen nicht behagen“...
„Ich werde wohl schon in schlechteren geschlafen haben.“
„Kann sein! Glücklichen Weg!“ Und er rückte an seiner Mütze.
Die Dame in Schwarz, die sich indessen ruhig ausschreitend weiter von ihnen entfernt hatte, wandte jetzt plötzlich den Kopf nach den Männern zurück.
„Wenn kein besseres Wirtshaus in der Nähe ist, muss man sich eben in sein Geschick ergeben. So im kleinen wie im großen; Geduld und Gleichgültigkeit ist das Beste.“
„Nun, ich würde Ihnen sagen, übernachten Sie in der Försterei“...
Täuschte ihn die Dämmerung oder die eigene Phantasie? Der Fremde glaubte zu sehen, dass die Dame eine rasche Bewegung machte.
Eine Nacht mit ihr unter demselben Dache — der Gedanke hatte für ihn etwas Verführerisches.
„Da müsste ich zurück“, meinte er, sein Felleisen wieder auf den Rücken schnallend.
„Das müßten Sie freilich!“
„Ich werde Ihrer Frau ungelegen kommen“ —
„Oho! Vielleicht freut sie sich gerade, einmal ein anderes Gesicht zu sehen. Es ist einsam in der Prora und sie ist ein Stadtkind.“
„Wie Sie’s denn wollen! So, ich bin fertig! Aber wir müssen eilen, Ihre Begleiterin ist eine gute Strecke voraus.“
„Lassen Sie nur! Es genügt mir und ihr, wenn ich sie im Auge behalte.“
„Wohl eine Malerin? Ich schließe das aus der Mappe, die sie trägt.“
„Ja, eine Malerin.“
Mit dem sichern Gefühl eines Menschen, der das Leben und die andern eine Zeit lang in vielfachen Verhältnissen und Formen beobachtet hat, merkte der Reisende, dass er am klügsten täte, von der Dame zu schweigen; und da er, wie kurz sein Aufenthalt auf der Insel auch erst gewesen, die Eigenheit ihrer Bewohner kennen gelernt, die gern die Schönheiten ihres Heimatlandes preisen hören, so fing er eins jener landläufigen Gespräche an, die zwischen Reisegefährten mit der Schönheit des Wetters beginnen und mit dem Austausch der beiderseitigen Visitenkarten endigen. Er für seine Person hatte nichts zu verbergen; in seinem Leben gab es nichts Geheimnisvolles und keine Tat, die bedeutsam aus dem Gewühl der Alltäglichkeit hervorgeragt, und ehe sie darum noch weit gegangen, erfuhr der Förster, dass sein Begleiter Georg Rechberg heiße und aus einer der kleinen Fürstenstädte des thüringischen Landes käme. „Und wie ich hierher gekommen?“ fuhr er fort. „Drollig genug! Immer hatte ich den Willen gehabt, hierher zu gehen; meine Mutter ist hier geboren und hat mir so viel Herrliches und Märchenhaftes von ihrer Heimat erzählt; das ist dann nicht aus der Phantasie des Jünglings und des Mannes gewichen. Beständig aber traten Umstände ein, die mich von diesem Punkte abzogen und bald da und dorthin in die Ferne wiesen. In diesem Jahre ging es mir nicht gut; bis vor einem Monat musste ich an dem Krankenbett eines Oheims sitzen; ich war längst von ihm zu seinem Universalerben eingesetzt und liebte den alten Mann. Mein Interesse wie meine Neigung fesselten mich an den langsam Sterbenden, allein Sie begreifen, dass meine Gedanken weitab schweiften. Da, als ich zufällig, es war an seinem Sterbetag, in seiner Kartensammlung blättere — die Geographie war sein Steckenpferd —, raten Sie, welches ist die erste Karte, die mir in die Hand fällt? Die Ihrer Insel! Und wir sollen nicht abergläubisch sein!“
„War Ihr Oheim der Bruder Ihrer Mutter?“
„Es tut mir ordentlich leid, der Geschichte wegen, dass er es nicht war. Ich werde wohl auf der Insel noch Verwandte haben, aber zum Glück kenne ich sie so wenig wie sie mich, habe auch gar kein Verlangen, mich ihnen zu nähern; nichts Langweiligeres und Drückenderes für einen Menschen, der unabhängig zu sein strebt, als Oheime und Tanten, Vettern und Muhmen!“
„Nun, nun! Man liebt doch seine Angehörigen!“
„Liebt sie! Ich habe keine!“ „Keine Eltern mehr, keine Geschwister?“ „Die Eltern sind längst gestorben, Geschwister hatte ich nie.“
„Schade!“
„Wie man es nimmt. Frei sein, für sich dasein, das ist die Hauptsache! Ich hindere niemand, ich zertrete nicht einmal eine Spinne oder einen Wurm, wenn ich es vermeiden kann. Wie heißt’s in der Schrift: „Was du willst, das dir die Leute tun, das tue du ihnen auch!“ Nach dem Grundsatz handle ich!“
Der Förster war ein schlichter Mann, schon vorgerückt in den fünfziger Jahren, ein wettergebräuntes, ehrliches Soldatengesicht mit grauen Augen, kurzgeschnittenem Haar und krausem, vollem Bart. Mochte ihn auch manches in den Äußerungen des Reisenden wunderlich und überspannt dünken, er fand Gefallen an der scheinbar so unbefangenen Weise, in der jener redete und ihm beinahe das Herz auf der Hand entgegentrug. Um die Dame, die ihnen immer noch vorausging, wenn auch nur um so wenige Schritte, dass ihr kaum ein Wort von dem ziemlich laut geführten Gespräch entgehen konnte, kümmerte sich Georg Rechberg weiter nicht und dies gewann ihm sichtlich die Freundschaft und das Vertrauen des Försters mehr und mehr. Er sah freilich nicht in die Gedankenwelt seines Begleiters, den das Geheimnis dieser schweigsamen, schwarzgekleideten, hohen und, wie er sich gestehen mußte, schönen Frauengestalt schon wie etwas Dämonisches anlockte. Tausend Vermutungen stiegen in Georgs Kopf auf. Ist der Förster ihr Diener oder ihr Wächter? Und wenn das letztere der Fall war — eine Ansicht, zu der er sich neigte — wer hielt sie dann gefangen, wer und warum? War sie vielleicht aus der fürstlichen Familie, eine Tiefsinige?
Und in diesem Gedankengange fragte er unbedachtsam: „Sie sind der fürstliche Förster?“
„Ich diene dem Fürsten im Grunde, so lange ich denken kann, die Zeit ausgenommen, in der ich als Soldat in dem blauen Rock des Königs steckte.“
„Ein guter Mann, der Fürst. Und bemüht sich redlich um seine Schlösser und Wälder; ein hübscher Flecken mit seinen weißen Häusern, den er unten an der See hat. Alle Leute, mit denen ich sprach, rühmten ihn.“
„Wess’ Brot ich esse, dess’ Lied ich singe. Aber auch sonst, kann nicht über ihn klagen. Ein Herr, wie geschaffen für uns Förster und den Wald. Jeden alten Eichbaum kennt er, jeden, sag' ich. Es ist eine Freude, mit ihm durch die Wälder zu spazieren. Gott gebe, dass sein Sohn nicht aus der Art schlägt!“
Georg Rechberg lachte: „Sie sagen das mit einem Stoßseufzer, als glaubten Sie selbst nicht recht an die Erfüllung Ihres Wunsches. Ja, wozu wären denn die Söhne da, wenn sie nichts Besseres zu thun wüssten als ihre Väter?“
„Man hat Beispiele vom Gegentheil. Die Welt wird nicht besser, junger Herr, sondern schlechter! Das ist ja so klar wie der Tag!“
Schon seit einer Weile hatten sie die Ebene verlassen und schritten in einer engen, steil ansteigenden Schlucht bergan. Der Weg war hier so schmal und durch die Steine, die zerstreut umherlagen, die Baumwurzeln, die sich über den sandigen Boden schlangen, so unsicher gemacht, dass nur mit Mühe und Not ein Wagen hindurchfahren konnte; jeder Kutscher, der am oberen Ende einfuhr, pflegte darum mit aller Gewalt seiner Stimme „Halt!“ zu rufen, um einen von der „Schmalen Heide“ vielleicht herankommenden Wagen zu warnen. Dieses Geschrei ertönte auch jetzt und im nächsten Augenblick das sausende Rollen der Räder, die wiederholt an die Steine stießen.
„Das sind seine Pferde!“ sagte die Dame hastig und ängstlich zugleich und drängte sich fast in das Gebüsch, das die Abhänge der Schlucht überwucherte.
Dem Förster stieg der Verdruss in das Gesicht; er murmelte etwas von Weiberfurcht und Narrenstreichen zwischen den Zähnen, offenbar aber kam ihm der Zufall so ungelegen wie seiner Begleiterin.
Indem brausten die Pferde daher, vier prächtige Rappen im Galopp, vor einem leichten Jagdwagen; sie flogen wie Pfeile mit ihm dahin über Stock und Stein; es schien, als müsse in jeder nächsten Sekunde das leichte Gefährt an einen Stein geschleudert werden und zusammenbrechen. Dennoch ging es dem Mann, der fuhr, nicht schnell genug; „Halloh! Ho!“ rief er und knallte mit der Peitsche. „Halloh! Ho!“ und so im Sturm jählings hinunter, als wäre er Pluto, der nach dem Raub der Proserpina die Rosse zur Unterwelt peitschte. Wie im Flug war der Wagen an den beiden vorüber, die zur Seite getreten.
„Wenn der nicht den Hals bricht“, meinte Rechberg in seiner gleichmütigen Ruhe, „hat ihn Luzifer noch zu mancherlei Dingen bestimmt!“
„Luzifer?“ Der Förster fuhr in die Höhe. „Was fällt Ihnen auch gerade der Gottseibeiuns ein! Das ist der tolle Hans von Lauken. Manches Pferd hat er zu Schanden geritten und gefahren, und wollte der Himmel, dass es nur—“
Er unterbrach sich, mit den Augen die Dame suchend. Aus dem Dickicht, in das sie sich geflüchtet, kam sie eben hervor. Am Himmel tauchte die Sichel des Mondes auf; in deren Glänze, der voll über sie hinstrahlte, erschien die Seltsame Georg noch seltsamer. Noch war sie nicht Herrin über die Bewegung geworden, die sie bei dem Heranrollen des Wagens ergriffen; sie zitterte ein wenig, ihr Gang war unsicher. Über einen Stein, den sie nicht bemerkte, wäre sie gefallen, hätte Georg nicht noch zur rechten Zeit sie am Arm ergriffen und festgehalten.
„Ich danke Ihnen!“ sagte sie mit fester Stimme. „Es geht nicht mehr ohne Stütze. Geben Sie mir Ihren Arm, lieber Hedrich!“ Und so auf den Förster sich stützend, schritt sie dem Anfang der Schlucht zu.
Damit nahm auch das Gespräch zwischen Georg und Hedrich ein Ende; denn da die Dame in ihrem Schweigen verharrte, hielt es Georg in seinem weltmännischen Takt für unangemessen, weiter mit dem Förster zu sprechen, und war wiederum viel zu stolz, eine Unterredung mit ihr zu beginnen, die ihm so lange auch nicht die geringste Beachtung geschenkt. Überdies hatte der Ausruf seines Wirts: „Das ist der tolle Hans von Lauken!“ eine andere Reihe Empfindungen und Gedanken in ihm angeregt. Seine Mutter stammte aus dem Geschlecht derer von Lauken und war von ihrer adelsstolzen Familie wenn nicht verstoßen, doch auf immer aus ihrem Kreise verbannt worden, als sie einem bürgerlichen Mann ihre Hand gereicht. Hans von Lauken — das musste sein Vetter sein; alte, halbvergessene Erinnerungen stiegen in Georg auf; niemals hatte der Vater den Schimpf verzeihen können, den ihm die hochmütigen Verwandten seiner Frau angetan, und seinen Hass auf den Sohn vererbt, soweit dessen kühle, verständige und von allem Leidenschaftlichen entfernte Natur zu hassen vermochte. Auch jetzt, als sein erstes Erstaunen über den so unerwartet gefundenen adeligen Vetter sich gemäßigt, zuckte er gleichgültig die Schultern wie einer, den all diese Dinge herzlich wenig bekümmerten, und sagte sich selbst: „Einmal haben wir uns getroffen und hoffentlich nicht wieder!“
In einiger Entfernung lag da das Försterhaus vor ihnen, von roten Steinen aufgebaut, mit bLauken Scheiben, die im Widerschein des Mondlichts glänzten, wohnlich, geräumig; ein Eckturm nach der Seite der Schlucht zu überragte es, von dem man eine gefällige und weite Aussicht über das flache Land umher haben musste. Mit lautem, freudigem Gebell stürzten die Hunde den Kommenden entgegen. Auf der Schwelle des Hauses stand ihrer schon wartend die Frau, die Georg im Grunde „viel zu jung und zu hübsch“ für den Förster fand.
„Da bring’ ich dir einen Gast mit, Marie!“ sagte er, auf Georg zeigend, und sie, dem Fremden unbefangen die Hand reichend: „Willkommen, Herr!“
Nun wird sich die Schwarze doch endlich entschleiern, dachte der junge Mann, während er den Gruß der Försterin freundlich erwiderte und sie in die Flur des Hauses traten.
Aber die Schwarze hob den Schleier nicht. „Lassen Sie mir den Tee auf mein Zimmer bringen!“ sagte sie kurz zu der Frau; „meine Dienerin ist doch oben?“
„Sie ist oben, gnädiges Fräulein!“
Und noch eine halbe, nachlässige Verbeugung, ein „Gute Nacht!“. . . damit stieg sie die Treppe hinauf, die aus dem Flur in die oberen Stockwerke des Hauses führte.
Das war deutlich, meinte Rechberg; denn warum zog sie sich von dem gemeinsamen Abendessen zurück, wenn nicht um seinetwillen? Allein auch in dieser Vermutung, die doch noch eine gewisse, wenngleich nicht allzu schmeichelhafte Teilnahme an seiner Persönlichkeit voraussetzte, hatte er sich getäuscht, wie er bei Tische erfuhr, als er bedauerte, dass sein Erscheinen den Hausfrieden wenigstens für die Dame in Schwarz gestört habe.
„Nicht doch“, entgegnete der Förster. „Sie hat öfters solche Grillen und bleibt zuweilen ganze Tage in ihrer Stube, ohne herabzusteigen. Wir sind daran gewöhnt und nehmen’s nicht übel. Im Gegenteil, ganz im Gegenteil! Es ist nicht vergnüglich, in ihr Gesicht zu sehen.“
„Übertreibe doch nicht!“ begütigte scherzend die Frau. „Du bringst mit deinen Reden unsern Gast noch zu dem Glauben, Fräulein Hertha sei ein Mannweib oder eine Here. O, es gibt Stunden, wo sie wunderhübsch aussieht und manchem den Kopf verrücken würde.“
„Meinst? Wäre neugierig, den kennen zu lernen, der sich in sie vergaffte.“
„Förster, was gucken Sie mich dabei so an?“ rief Georg. „Vor mir ist die Schwarze sicher. Ich bin auch einer, der sich so leicht verliebt!“ Und ein Lächeln ging über seine Lippen, das seinen bis dahin ruhigen und nicht allzu ausdrucksvollen Zügen einen scharf hervorstechenden Charakter des Übermuts und Spottes verlieh, vor dem Frau Marie unwillkürlich wie vor etwas Bösem zurückfuhr. Aber wie im April ein Wolkenschatten kommt und vorüberhuscht, so war in Georgs Gesicht schon wieder die stille Gleichmütigkeit zurückgekehrt und er sagte: „Ist die Dame vielleicht eine Verwandte von Ihnen, dass Sie so viel teil an ihrem Schicksal nehmen?“
„Ist keine Verwandte von uns, und wäre sie nicht mit einem Briefe des“ — er machte eine bedenkliche Pause und suchte seine Verlegenheit unter dem Ausruf zu verbergen: „Aber Sie trinken ja nicht! Schenk' ein, Marie! Ist Rheinwein aus dem fürstlichen Keller, das Weihnachtsgeschenk des Herrn! Freilich, Sie mögen wohl schon besseren getrunken haben!“
„Wohl möglich, doch keinen, der mir so gut gemundet! Wahrhaftig, diesen Abend hatte ich auf kein Glas Wein gerechnet!“
„Auf unserer Insel müssen Sie damit fürlieb nehmen, Sie müssten denn auf Lauken zu Mittag geladen werden.“
„Nach Lauken? Von dem wilden Hans? Das könnte geschehen! Wie ich da bin, mein lieber Herr Hedrich, bin ich der Vetter des Herrn von Lauken, vorausgesetzt, dass dieser Hans einen Vater hatte, der Fritz hieß.“
„Getroffen, Fritz Lauken.“
„Abgemacht! Meine Mutter Anna war dessen Stiefschwester. Die Geschichte ist in drei Worten zu Ende. Mein Großvater hatte aus erster Ehe nur diese eine Tochter und heiratete noch in späterem Alter ein junges Mädchen. Zwischen der und der heranwachsenden Tochter gab’s keinen Frieden; meine Mutter Anna wurde nach Stettin zu entfernten Verwandten geschickt. Dort machte sie die Bekanntschaft meines Vaters; sie liebten sich, sie wurden einig. Das Geschrei der adeligen Sippschaft war groß und von ihrem Standpunkt aus hatten die Leute auch recht. Zum Glück war mein Großvater ein vernünftiger Mann, er entließ die Tochter wenigstens ohne tragischen Fluch aus seinem Hause. So bin ich mit den Laukens verwandt.“
„Da werden Sie kein Verlangen haben, sie aufzusuchen“, bemerkte Frau Marie.
„Der tolle Hans indessen wäre im Stande, um Mittemacht von seinem Hause die zwei Meilen herüberzufahren, wüsste er, dass in der Prora ein Vetter von ihm säße“, fuhr der Förster dazwischen. „Ein wilder, jähzorniger Gesell, aber nicht Adelsstolz und gut zu allen, die ihm nicht im Wege stehen.“
„Ich werde keinen Schatten über den seinigen werfen. Ich brauche ihn so wenig als einen andern Menschen. Jeder für sich, das ist das Gescheiteste.“
Darauf sagte noch die Frau: „Wenn Sie morgen über die „Schmale Heide“ gegangen, an einem Hünengrabe vorbei, sehen Sie zur Linken das Herrenhaus von Lauken auf einer kleinen Anhöhe liegen; eine Allee von Rüstern führt hinan, verfehlen können Sie’s nicht.“
„Ich könnte es mir schon getrost beschauen, ebne Furcht erkannt zu werden. Lebt mein Oheim noch?“
„Der Fritz Lauken? Lebt noch, aber man spricht nicht mehr von ihm. Er sitzt tief hinein im Lande in einer Irrenanstalt.“
„Nemesis oder gerechte Strafe des Schicksals, wie man es nun nennen will“ — und das höhnische Lächeln spielte wieder um Georgs Mund.
„Genug der alten Geschichten, die Todten haben keine Rechte. Auf die Frau Försterin und dass ich Sie morgen noch beim Abschied sehe!“ Damit leerte er ein volles Glas.
Wenige Minuten später leuchtete ihm eine Magd dieselbe Treppe hinauf, die vorher die schwarze Dame emporgestiegen. Sie brachte ihn in das zweite Stockwerk, in ein behaglich eingerichtetes Zimmer. Während sie das offene Fenster schloss und den Vorhang niederließ, tönten von unten herauf die Töne eines Klaviers, dicht unter seinem Zimmer wurde gespielt.
„Schöne Aussichten für meine Nachtruhe!“ murrte er. „Wer spielt denn da? Die Frau Försterin?“
„Nein, das gnädige Fräulein.“
„So? Spielt sie lange?“
„Nicht lange. Nach elf wird alles still.“
Georg blickte auf seine Uhr, es fehlte noch eine halbe Stunde an elf.
„Es wird sich überstehen lassen, das Geklimper“. . . Er warf sich in den mit Leder überzogenen Lehnstuhl.
Das Mädchen zündete noch ein Licht an, wünschte gute Ruhe... er war allein.
Ein langgedehnter schmaler Heidestreifen, der den eigentlichen Leib der Insel mit einer nach Norden sich ausstreckenden Halbinsel verbindet . . . weder vorwärts noch rückwärts schauend, kann der Blick auf einer Baumgruppe ausruhen, flach und öde alles, gleichmäßig eintönig, ein schlechter Weg, den man mühsam neben den tiefen Wagengleisen verfolgen muss und der scheinbar so in die Endlosigkeit ohne Ziel dahinläuft. Hier und dort ist niedriges Fichtengestrüpp zu kleinen Gebüschen zusammengewachsen; das einzige Grün, das den Boden farbiger kleidet, ist das des üppig wuchernden Ginsters; sonst herrscht weithin ein braunrötlicher Ton von dem Heidekraut, das sich flechtenartig über den Sand hinzieht, und den schmächtigen, blassroten Ericas, die dazwischen ausschießen. Aber ganz von allem Zauber ist auch diese Landschaft nicht verlassen, die im Munde der Umwohnenden die „Schmale Heide“ heißt; nur freilich ist nicht jedes Menschenauge für diesen Zauber empfänglich geschaffen. Denn der Wanderer konnte über die Fichtengebüsche hinweg zur linken wie zur rechten Hand das Meer sehen, dessen Wellen an diesem sandigen und flachen Strande verrinnen. Zuweilen, bei der tiefen Stille umher, schlug das Geräusch einer heranbrausenden mächtigern Welle, ehe sie sich den Kopf an den Steinen des Ufers schäumend zerstieß, an sein Ohr. In gleichen Zwischenräumen kehrte dieser Ton wieder, dumpf und langsam heranrollend und so verhallend. In goldenen und purpurnen, in violetten und grünlich schimmernden Wolken zerflatterte am West-Himmel das Abendrot. Auf dieser Seite bildet das Meer eine tiefeinschneidende, geschützte Bucht, der „Kleine Bodden“ genannt; eine Landzunge, die in einer von Fichten und Buchen bestandenen Anhöhe endet, zieht sich in die See hinein; ein kleines Eiland wird darin sichtbar; in eigentümlicher Farbenwirkung hob sich das Dunkelgrün des Uferbergs von den breiten goldgelben Wolkenstreifen ab. Im Osten wölbte der Himmel sein graublaues Gewölbe über dem offenen, grauen Meer. Von dorther kamen die Nebel gezogen, nah und näher, gespenstisch zusammengeballt, als wandelten die alten Götter des Nordens, riesige Gestalten in ihren Regenmänteln, mit unhörbar leisen Schritten auf den Wassern hin.
Der Reisende hatte einen weiten Tagesmarsch gemacht und da er nach seiner Berechnung noch eine tüchtige Strecke Wegs vor sich hatte, ehe er den „Heidekrug“ erreichte, wo er zu übernachten beschlossen, setzte er sich ermüdet auf einen der hohen Steine, die, zwischen dem Ginster verstreut, von einer dürftigen Moosdecke übersponnen lagen. In seinem weder bedeutsamen noch abstoßenden Gesicht malte sich unverkennbar Verdruss, üble Laune. „Warum bist du auch auf den närrischen Einfall gekommen“, schien er sich zu sagen, „statt im Wagen behaglich diesen langweiligen Weg mit guten Pferden zu durchfliegen, ihn auf deinen eigenen Füßen schneckengleich hinzukriechen! Solche Tollheiten überlässt man doch Studenten, Handwerksburschen oder Landschaftsmalern, die eine schöne Aussicht suchen. Melancholisch ist's hier“ — und nun schaute er sich um — „Sand und Steine und Heidekraut. Und drüben das Meer — das alles soll dichterische Gefühle erwecken, die Seele stimmen, dass sie wie eine Harfe erklingt, in deren Saiten eine göttliche Hand greift. Wer hätte das nicht gehört und nachgesprochen? Ich mag solche Gefühlsschwärmereien im Anblick der Natur nicht leiden, mit denen wir noch lieber als die andern uns selbst belügen, um vor dem eigenen Spiegel als empfindungsreiche und begabte Menschen zu erscheinen! Nun, ich meinerseits wünschte, ich säße an einer guten Wirtshaustafel und hätte keine andere Aussicht als die auf ein gutes Bett.“
Diese und ähnliche Gedanken hätte ohne viel Scharfsinn jeder aus dem verdrossenen Gesicht des Fremden gelesen, wenn er hineingeblickt. Aber es kam niemand dieses Wegs, nur die Möwen flogen über den Wasserspiegel. Sein Ranzel hatte der Wanderer neben sich auf den Boden gelegt, den breiten, von einem schwarzen Seidenband eingefassten Strohhut abgenommen; der Wind, der erfrischend von der See herüberstrich, spielte in seinem blonden, leichtgelockten Haar.
Allmählich tiefer war die Dämmerung gesunken, wie rotes Gold schien der Sonnenball zu zerschmelzen und der Widerschein lag verglühend über der Heide.
Am Himmel im Sonnenuntergang das schönste Bild irdischer Vergänglichkeit, unten in der See das Symbol einer einsamen Unendlichkeit, farblos, aber gerade durch diesen Mangel großartig, herzergreifend und klangvoll zugleich. Oft ist es uns, als müsste der Gesang der Sphären, von dem die Dichter träumen, so an das Ohr der Gottheit tönen wie an das unsere, wenn wir mit geschlossenen Augen beim Heranschreiten der Nacht auf den Strandsteinen sitzen, das Rauschen des Meeres.
Jetzt erhob sich der junge Mann, nahm sein Ränzel wieder auf und schickte sich zum Weitergehen an. Sei es aus Ärger oder um seines Unmuts los und ledig zu werden, er begann ein Lied zu pfeifen. Noch einmal sah er nach der Seite des Boddens hin, wo die Fichtengebüsche dichter standen: zwei Gestalten schritten von dorther langsam dem Fahrwege näher.
„Menschen in dieser Öde“, dachte der Reisende; „vielleicht gar Gefährten, die auch nach dem Heidekrug wollen“. . . Und da er gerade in der Stimmung war, die ihm Gesellschafter willkommen machte, um ihnen seinen Verdruss zu klagen, so blieb er stehen.
Bald erkannte er nun zwar seinen Irrtum, denn die eine der Nahenden war eine Dame und ihr Begleiter, der, wie es ihm schien, absichtlich einige Schritte hinter ihr zurückblieb, im grünen Jagdrock, die Büchse über die Schulter geworfen, der Förster aus der Försterei, an der er selbst vor kurzer Zeit vorübergegangen. Dennoch stand er still, den rechten Fuß mit einem gewissen Trotz auf den Stein stemmend, darauf er bisher gesessen.
Die Herankommenden wechselten kein Wort. Von ihrem dunkeln, breitrandigen Hut, den etwas phantastisch eine schwarze Feder schmücke, hatte die Dame den Schleier niedergeschlagen, in ihrer Hand trug sie eine Zeichenmappe. Alles, als der Fremde sie mit neugierigem Blick musterte, war schwarz an ihr; schwarz das Kleid, die Handschuhe, der Schleier, der ihr Gesicht verhüllte, die kleinen Kügelchen der Kette, die sie um den Hals geschlungen hatte. Hoch hinauf ging das Kleid, oben war es mit einem schmalen Streifen schwarzer Spitzen besetzt. Sowohl die Dämmerung wie der Schleier ließen die Züge ihres Antlitzes kaum erkennen. Ohne seine Stellung zu verändern, hatte der Reisende doch, als sie ganz nahe an dem Stein vorbeischritt, in unwillkürlicher Bewegung leicht grüßend sich verneigt. Mit vornehmer Herablassung, als sei sie früh an die Unterwürfigkeit der andern gewöhnt, dankte sie.
Dies zumeist bestimmte den Fremden, an den ihr folgenden Förster eine Frage zu richten; denn es quälte ihn, dass er am Ende für einen lästigen Neugierigen gehalten werden könnte, der sich ihr in den Weg gestellt — je nun, wie sich die Gaffer auf der Straße versammeln, wenn eine Prinzessin vorüberfährt. So sollte sie nicht von ihm denken; mit seiner Frage wollte er sein Verweilen entschuldigen.
Wenn er geahnt, welche Verwickelungen sich für ihn an diese Eine harmlose Frage knüpften!
„Schönen guten Abend! Ist es noch weit bis nach dem Heidekrug?“
„Drei Viertelstunden, wenn Sie nicht große Schritte machen wollen“, antwortete der Förster und sah sich den Fragenden gutmütig lächelnd an. „Aber das Nachtquartier wird Ihnen nicht behagen“...
„Ich werde wohl schon in schlechteren geschlafen haben.“
„Kann sein! Glücklichen Weg!“ Und er rückte an seiner Mütze.
Die Dame in Schwarz, die sich indessen ruhig ausschreitend weiter von ihnen entfernt hatte, wandte jetzt plötzlich den Kopf nach den Männern zurück.
„Wenn kein besseres Wirtshaus in der Nähe ist, muss man sich eben in sein Geschick ergeben. So im kleinen wie im großen; Geduld und Gleichgültigkeit ist das Beste.“
„Nun, ich würde Ihnen sagen, übernachten Sie in der Försterei“...
Täuschte ihn die Dämmerung oder die eigene Phantasie? Der Fremde glaubte zu sehen, dass die Dame eine rasche Bewegung machte.
Eine Nacht mit ihr unter demselben Dache — der Gedanke hatte für ihn etwas Verführerisches.
„Da müsste ich zurück“, meinte er, sein Felleisen wieder auf den Rücken schnallend.
„Das müßten Sie freilich!“
„Ich werde Ihrer Frau ungelegen kommen“ —
„Oho! Vielleicht freut sie sich gerade, einmal ein anderes Gesicht zu sehen. Es ist einsam in der Prora und sie ist ein Stadtkind.“
„Wie Sie’s denn wollen! So, ich bin fertig! Aber wir müssen eilen, Ihre Begleiterin ist eine gute Strecke voraus.“
„Lassen Sie nur! Es genügt mir und ihr, wenn ich sie im Auge behalte.“
„Wohl eine Malerin? Ich schließe das aus der Mappe, die sie trägt.“
„Ja, eine Malerin.“
Mit dem sichern Gefühl eines Menschen, der das Leben und die andern eine Zeit lang in vielfachen Verhältnissen und Formen beobachtet hat, merkte der Reisende, dass er am klügsten täte, von der Dame zu schweigen; und da er, wie kurz sein Aufenthalt auf der Insel auch erst gewesen, die Eigenheit ihrer Bewohner kennen gelernt, die gern die Schönheiten ihres Heimatlandes preisen hören, so fing er eins jener landläufigen Gespräche an, die zwischen Reisegefährten mit der Schönheit des Wetters beginnen und mit dem Austausch der beiderseitigen Visitenkarten endigen. Er für seine Person hatte nichts zu verbergen; in seinem Leben gab es nichts Geheimnisvolles und keine Tat, die bedeutsam aus dem Gewühl der Alltäglichkeit hervorgeragt, und ehe sie darum noch weit gegangen, erfuhr der Förster, dass sein Begleiter Georg Rechberg heiße und aus einer der kleinen Fürstenstädte des thüringischen Landes käme. „Und wie ich hierher gekommen?“ fuhr er fort. „Drollig genug! Immer hatte ich den Willen gehabt, hierher zu gehen; meine Mutter ist hier geboren und hat mir so viel Herrliches und Märchenhaftes von ihrer Heimat erzählt; das ist dann nicht aus der Phantasie des Jünglings und des Mannes gewichen. Beständig aber traten Umstände ein, die mich von diesem Punkte abzogen und bald da und dorthin in die Ferne wiesen. In diesem Jahre ging es mir nicht gut; bis vor einem Monat musste ich an dem Krankenbett eines Oheims sitzen; ich war längst von ihm zu seinem Universalerben eingesetzt und liebte den alten Mann. Mein Interesse wie meine Neigung fesselten mich an den langsam Sterbenden, allein Sie begreifen, dass meine Gedanken weitab schweiften. Da, als ich zufällig, es war an seinem Sterbetag, in seiner Kartensammlung blättere — die Geographie war sein Steckenpferd —, raten Sie, welches ist die erste Karte, die mir in die Hand fällt? Die Ihrer Insel! Und wir sollen nicht abergläubisch sein!“
„War Ihr Oheim der Bruder Ihrer Mutter?“
„Es tut mir ordentlich leid, der Geschichte wegen, dass er es nicht war. Ich werde wohl auf der Insel noch Verwandte haben, aber zum Glück kenne ich sie so wenig wie sie mich, habe auch gar kein Verlangen, mich ihnen zu nähern; nichts Langweiligeres und Drückenderes für einen Menschen, der unabhängig zu sein strebt, als Oheime und Tanten, Vettern und Muhmen!“
„Nun, nun! Man liebt doch seine Angehörigen!“
„Liebt sie! Ich habe keine!“ „Keine Eltern mehr, keine Geschwister?“ „Die Eltern sind längst gestorben, Geschwister hatte ich nie.“
„Schade!“
„Wie man es nimmt. Frei sein, für sich dasein, das ist die Hauptsache! Ich hindere niemand, ich zertrete nicht einmal eine Spinne oder einen Wurm, wenn ich es vermeiden kann. Wie heißt’s in der Schrift: „Was du willst, das dir die Leute tun, das tue du ihnen auch!“ Nach dem Grundsatz handle ich!“
Der Förster war ein schlichter Mann, schon vorgerückt in den fünfziger Jahren, ein wettergebräuntes, ehrliches Soldatengesicht mit grauen Augen, kurzgeschnittenem Haar und krausem, vollem Bart. Mochte ihn auch manches in den Äußerungen des Reisenden wunderlich und überspannt dünken, er fand Gefallen an der scheinbar so unbefangenen Weise, in der jener redete und ihm beinahe das Herz auf der Hand entgegentrug. Um die Dame, die ihnen immer noch vorausging, wenn auch nur um so wenige Schritte, dass ihr kaum ein Wort von dem ziemlich laut geführten Gespräch entgehen konnte, kümmerte sich Georg Rechberg weiter nicht und dies gewann ihm sichtlich die Freundschaft und das Vertrauen des Försters mehr und mehr. Er sah freilich nicht in die Gedankenwelt seines Begleiters, den das Geheimnis dieser schweigsamen, schwarzgekleideten, hohen und, wie er sich gestehen mußte, schönen Frauengestalt schon wie etwas Dämonisches anlockte. Tausend Vermutungen stiegen in Georgs Kopf auf. Ist der Förster ihr Diener oder ihr Wächter? Und wenn das letztere der Fall war — eine Ansicht, zu der er sich neigte — wer hielt sie dann gefangen, wer und warum? War sie vielleicht aus der fürstlichen Familie, eine Tiefsinige?
Und in diesem Gedankengange fragte er unbedachtsam: „Sie sind der fürstliche Förster?“
„Ich diene dem Fürsten im Grunde, so lange ich denken kann, die Zeit ausgenommen, in der ich als Soldat in dem blauen Rock des Königs steckte.“
„Ein guter Mann, der Fürst. Und bemüht sich redlich um seine Schlösser und Wälder; ein hübscher Flecken mit seinen weißen Häusern, den er unten an der See hat. Alle Leute, mit denen ich sprach, rühmten ihn.“
„Wess’ Brot ich esse, dess’ Lied ich singe. Aber auch sonst, kann nicht über ihn klagen. Ein Herr, wie geschaffen für uns Förster und den Wald. Jeden alten Eichbaum kennt er, jeden, sag' ich. Es ist eine Freude, mit ihm durch die Wälder zu spazieren. Gott gebe, dass sein Sohn nicht aus der Art schlägt!“
Georg Rechberg lachte: „Sie sagen das mit einem Stoßseufzer, als glaubten Sie selbst nicht recht an die Erfüllung Ihres Wunsches. Ja, wozu wären denn die Söhne da, wenn sie nichts Besseres zu thun wüssten als ihre Väter?“
„Man hat Beispiele vom Gegentheil. Die Welt wird nicht besser, junger Herr, sondern schlechter! Das ist ja so klar wie der Tag!“
Schon seit einer Weile hatten sie die Ebene verlassen und schritten in einer engen, steil ansteigenden Schlucht bergan. Der Weg war hier so schmal und durch die Steine, die zerstreut umherlagen, die Baumwurzeln, die sich über den sandigen Boden schlangen, so unsicher gemacht, dass nur mit Mühe und Not ein Wagen hindurchfahren konnte; jeder Kutscher, der am oberen Ende einfuhr, pflegte darum mit aller Gewalt seiner Stimme „Halt!“ zu rufen, um einen von der „Schmalen Heide“ vielleicht herankommenden Wagen zu warnen. Dieses Geschrei ertönte auch jetzt und im nächsten Augenblick das sausende Rollen der Räder, die wiederholt an die Steine stießen.
„Das sind seine Pferde!“ sagte die Dame hastig und ängstlich zugleich und drängte sich fast in das Gebüsch, das die Abhänge der Schlucht überwucherte.
Dem Förster stieg der Verdruss in das Gesicht; er murmelte etwas von Weiberfurcht und Narrenstreichen zwischen den Zähnen, offenbar aber kam ihm der Zufall so ungelegen wie seiner Begleiterin.
Indem brausten die Pferde daher, vier prächtige Rappen im Galopp, vor einem leichten Jagdwagen; sie flogen wie Pfeile mit ihm dahin über Stock und Stein; es schien, als müsse in jeder nächsten Sekunde das leichte Gefährt an einen Stein geschleudert werden und zusammenbrechen. Dennoch ging es dem Mann, der fuhr, nicht schnell genug; „Halloh! Ho!“ rief er und knallte mit der Peitsche. „Halloh! Ho!“ und so im Sturm jählings hinunter, als wäre er Pluto, der nach dem Raub der Proserpina die Rosse zur Unterwelt peitschte. Wie im Flug war der Wagen an den beiden vorüber, die zur Seite getreten.
„Wenn der nicht den Hals bricht“, meinte Rechberg in seiner gleichmütigen Ruhe, „hat ihn Luzifer noch zu mancherlei Dingen bestimmt!“
„Luzifer?“ Der Förster fuhr in die Höhe. „Was fällt Ihnen auch gerade der Gottseibeiuns ein! Das ist der tolle Hans von Lauken. Manches Pferd hat er zu Schanden geritten und gefahren, und wollte der Himmel, dass es nur—“
Er unterbrach sich, mit den Augen die Dame suchend. Aus dem Dickicht, in das sie sich geflüchtet, kam sie eben hervor. Am Himmel tauchte die Sichel des Mondes auf; in deren Glänze, der voll über sie hinstrahlte, erschien die Seltsame Georg noch seltsamer. Noch war sie nicht Herrin über die Bewegung geworden, die sie bei dem Heranrollen des Wagens ergriffen; sie zitterte ein wenig, ihr Gang war unsicher. Über einen Stein, den sie nicht bemerkte, wäre sie gefallen, hätte Georg nicht noch zur rechten Zeit sie am Arm ergriffen und festgehalten.
„Ich danke Ihnen!“ sagte sie mit fester Stimme. „Es geht nicht mehr ohne Stütze. Geben Sie mir Ihren Arm, lieber Hedrich!“ Und so auf den Förster sich stützend, schritt sie dem Anfang der Schlucht zu.
Damit nahm auch das Gespräch zwischen Georg und Hedrich ein Ende; denn da die Dame in ihrem Schweigen verharrte, hielt es Georg in seinem weltmännischen Takt für unangemessen, weiter mit dem Förster zu sprechen, und war wiederum viel zu stolz, eine Unterredung mit ihr zu beginnen, die ihm so lange auch nicht die geringste Beachtung geschenkt. Überdies hatte der Ausruf seines Wirts: „Das ist der tolle Hans von Lauken!“ eine andere Reihe Empfindungen und Gedanken in ihm angeregt. Seine Mutter stammte aus dem Geschlecht derer von Lauken und war von ihrer adelsstolzen Familie wenn nicht verstoßen, doch auf immer aus ihrem Kreise verbannt worden, als sie einem bürgerlichen Mann ihre Hand gereicht. Hans von Lauken — das musste sein Vetter sein; alte, halbvergessene Erinnerungen stiegen in Georg auf; niemals hatte der Vater den Schimpf verzeihen können, den ihm die hochmütigen Verwandten seiner Frau angetan, und seinen Hass auf den Sohn vererbt, soweit dessen kühle, verständige und von allem Leidenschaftlichen entfernte Natur zu hassen vermochte. Auch jetzt, als sein erstes Erstaunen über den so unerwartet gefundenen adeligen Vetter sich gemäßigt, zuckte er gleichgültig die Schultern wie einer, den all diese Dinge herzlich wenig bekümmerten, und sagte sich selbst: „Einmal haben wir uns getroffen und hoffentlich nicht wieder!“
In einiger Entfernung lag da das Försterhaus vor ihnen, von roten Steinen aufgebaut, mit bLauken Scheiben, die im Widerschein des Mondlichts glänzten, wohnlich, geräumig; ein Eckturm nach der Seite der Schlucht zu überragte es, von dem man eine gefällige und weite Aussicht über das flache Land umher haben musste. Mit lautem, freudigem Gebell stürzten die Hunde den Kommenden entgegen. Auf der Schwelle des Hauses stand ihrer schon wartend die Frau, die Georg im Grunde „viel zu jung und zu hübsch“ für den Förster fand.
„Da bring’ ich dir einen Gast mit, Marie!“ sagte er, auf Georg zeigend, und sie, dem Fremden unbefangen die Hand reichend: „Willkommen, Herr!“
Nun wird sich die Schwarze doch endlich entschleiern, dachte der junge Mann, während er den Gruß der Försterin freundlich erwiderte und sie in die Flur des Hauses traten.
Aber die Schwarze hob den Schleier nicht. „Lassen Sie mir den Tee auf mein Zimmer bringen!“ sagte sie kurz zu der Frau; „meine Dienerin ist doch oben?“
„Sie ist oben, gnädiges Fräulein!“
Und noch eine halbe, nachlässige Verbeugung, ein „Gute Nacht!“. . . damit stieg sie die Treppe hinauf, die aus dem Flur in die oberen Stockwerke des Hauses führte.
Das war deutlich, meinte Rechberg; denn warum zog sie sich von dem gemeinsamen Abendessen zurück, wenn nicht um seinetwillen? Allein auch in dieser Vermutung, die doch noch eine gewisse, wenngleich nicht allzu schmeichelhafte Teilnahme an seiner Persönlichkeit voraussetzte, hatte er sich getäuscht, wie er bei Tische erfuhr, als er bedauerte, dass sein Erscheinen den Hausfrieden wenigstens für die Dame in Schwarz gestört habe.
„Nicht doch“, entgegnete der Förster. „Sie hat öfters solche Grillen und bleibt zuweilen ganze Tage in ihrer Stube, ohne herabzusteigen. Wir sind daran gewöhnt und nehmen’s nicht übel. Im Gegenteil, ganz im Gegenteil! Es ist nicht vergnüglich, in ihr Gesicht zu sehen.“
„Übertreibe doch nicht!“ begütigte scherzend die Frau. „Du bringst mit deinen Reden unsern Gast noch zu dem Glauben, Fräulein Hertha sei ein Mannweib oder eine Here. O, es gibt Stunden, wo sie wunderhübsch aussieht und manchem den Kopf verrücken würde.“
„Meinst? Wäre neugierig, den kennen zu lernen, der sich in sie vergaffte.“
„Förster, was gucken Sie mich dabei so an?“ rief Georg. „Vor mir ist die Schwarze sicher. Ich bin auch einer, der sich so leicht verliebt!“ Und ein Lächeln ging über seine Lippen, das seinen bis dahin ruhigen und nicht allzu ausdrucksvollen Zügen einen scharf hervorstechenden Charakter des Übermuts und Spottes verlieh, vor dem Frau Marie unwillkürlich wie vor etwas Bösem zurückfuhr. Aber wie im April ein Wolkenschatten kommt und vorüberhuscht, so war in Georgs Gesicht schon wieder die stille Gleichmütigkeit zurückgekehrt und er sagte: „Ist die Dame vielleicht eine Verwandte von Ihnen, dass Sie so viel teil an ihrem Schicksal nehmen?“
„Ist keine Verwandte von uns, und wäre sie nicht mit einem Briefe des“ — er machte eine bedenkliche Pause und suchte seine Verlegenheit unter dem Ausruf zu verbergen: „Aber Sie trinken ja nicht! Schenk' ein, Marie! Ist Rheinwein aus dem fürstlichen Keller, das Weihnachtsgeschenk des Herrn! Freilich, Sie mögen wohl schon besseren getrunken haben!“
„Wohl möglich, doch keinen, der mir so gut gemundet! Wahrhaftig, diesen Abend hatte ich auf kein Glas Wein gerechnet!“
„Auf unserer Insel müssen Sie damit fürlieb nehmen, Sie müssten denn auf Lauken zu Mittag geladen werden.“
„Nach Lauken? Von dem wilden Hans? Das könnte geschehen! Wie ich da bin, mein lieber Herr Hedrich, bin ich der Vetter des Herrn von Lauken, vorausgesetzt, dass dieser Hans einen Vater hatte, der Fritz hieß.“
„Getroffen, Fritz Lauken.“
„Abgemacht! Meine Mutter Anna war dessen Stiefschwester. Die Geschichte ist in drei Worten zu Ende. Mein Großvater hatte aus erster Ehe nur diese eine Tochter und heiratete noch in späterem Alter ein junges Mädchen. Zwischen der und der heranwachsenden Tochter gab’s keinen Frieden; meine Mutter Anna wurde nach Stettin zu entfernten Verwandten geschickt. Dort machte sie die Bekanntschaft meines Vaters; sie liebten sich, sie wurden einig. Das Geschrei der adeligen Sippschaft war groß und von ihrem Standpunkt aus hatten die Leute auch recht. Zum Glück war mein Großvater ein vernünftiger Mann, er entließ die Tochter wenigstens ohne tragischen Fluch aus seinem Hause. So bin ich mit den Laukens verwandt.“
„Da werden Sie kein Verlangen haben, sie aufzusuchen“, bemerkte Frau Marie.
„Der tolle Hans indessen wäre im Stande, um Mittemacht von seinem Hause die zwei Meilen herüberzufahren, wüsste er, dass in der Prora ein Vetter von ihm säße“, fuhr der Förster dazwischen. „Ein wilder, jähzorniger Gesell, aber nicht Adelsstolz und gut zu allen, die ihm nicht im Wege stehen.“
„Ich werde keinen Schatten über den seinigen werfen. Ich brauche ihn so wenig als einen andern Menschen. Jeder für sich, das ist das Gescheiteste.“
Darauf sagte noch die Frau: „Wenn Sie morgen über die „Schmale Heide“ gegangen, an einem Hünengrabe vorbei, sehen Sie zur Linken das Herrenhaus von Lauken auf einer kleinen Anhöhe liegen; eine Allee von Rüstern führt hinan, verfehlen können Sie’s nicht.“
„Ich könnte es mir schon getrost beschauen, ebne Furcht erkannt zu werden. Lebt mein Oheim noch?“
„Der Fritz Lauken? Lebt noch, aber man spricht nicht mehr von ihm. Er sitzt tief hinein im Lande in einer Irrenanstalt.“
„Nemesis oder gerechte Strafe des Schicksals, wie man es nun nennen will“ — und das höhnische Lächeln spielte wieder um Georgs Mund.
„Genug der alten Geschichten, die Todten haben keine Rechte. Auf die Frau Försterin und dass ich Sie morgen noch beim Abschied sehe!“ Damit leerte er ein volles Glas.
Wenige Minuten später leuchtete ihm eine Magd dieselbe Treppe hinauf, die vorher die schwarze Dame emporgestiegen. Sie brachte ihn in das zweite Stockwerk, in ein behaglich eingerichtetes Zimmer. Während sie das offene Fenster schloss und den Vorhang niederließ, tönten von unten herauf die Töne eines Klaviers, dicht unter seinem Zimmer wurde gespielt.
„Schöne Aussichten für meine Nachtruhe!“ murrte er. „Wer spielt denn da? Die Frau Försterin?“
„Nein, das gnädige Fräulein.“
„So? Spielt sie lange?“
„Nicht lange. Nach elf wird alles still.“
Georg blickte auf seine Uhr, es fehlte noch eine halbe Stunde an elf.
„Es wird sich überstehen lassen, das Geklimper“. . . Er warf sich in den mit Leder überzogenen Lehnstuhl.
Das Mädchen zündete noch ein Licht an, wünschte gute Ruhe... er war allein.