Goethe
Goethe
Wer über Goethe und die Juden spricht oder schreibt, tut am besten, von vornherein ein Glaubensbekenntnis zu formulieren. Ich spreche nicht als Jude, sondern als Literarhistoriker. Als Jude bin ich Partei, als Literarhistoriker bin ich parteilos. Ein großer französischer Moralist, der in seinen Essais das gesamte Menschenleben zum Gegenstande seines Studiums machte, sagte von sich: „ich urteile nicht, ich erzähle“. Von einem großen Historiker Leopold von Ranke berichtet man, er habe aus die Bemerkung einiger Begeisterten, welches Hochgefühl es doch sein müsse, die Wahrheit zu erkennen und den Zusammenhang der Völkergeschichte zu enträtseln, fein lächelnd, wie es seine Art war, gesagt, „was mich zur Geschichtsforschung treibt, das ist Neugierde. Ich möchte wissen, wie die Sachen waren, von denen man bisher nichts wußte“.
Ich wage nicht, mich mit Montaigne zu vergleichen und nicht mit Ranke. Aber ich möchte wie der letztere sagen, ich möchte wissen, was Goethe von den Juden gesagt, wie er zu ihnen stand, wie sie zu ihm standen, und mit dem ersteren aussprechen, ich bringe dies alles schlicht vor, aber ich urteile nicht, ich erzähle.
Ich will nicht dem größten deutschen Schriftsteller gegenüber, zu dessen Würdigung sich mit so vielen deutscheu Gelehrten auch solche jüdischen Ursprungs vereint haben, mit sittlichen Pathos oder hochmütiger Verachtung ausrufen: weg mit ihm, er war ein Judenfeind, oder auch nur: schade, daß er ein Judenfeind war; ich will untersuchen, wie Goethe, der sich mit leichthinniger Verwerfung oder einfachem unbegründeten Lob nie begnügte, sondern der kraft seiner wissenschaftlichen Anlage Lebensrätsel zu enthüllen und Weltausgaben zu lösen strebte, zeitlebens mit dem Problem rang, das Existenz und Wesen der Juden ihm und so vielen bot.
l.
Goethe lernte in Frankfurt schon frühzeitig Juden kennen. Was sie ihm aber zeigen konnten, war keine Bildung, sondern mehr Absonderlichkeit. Er war mehrfach in der Judengasse, wohnte auf Empfehlung angesehener Personen einzelnen Zeremonien, z. B. einer Beschneidung, auch einer Hochzeit und der Feier des Laubhüttenfestes bei. Er sah gern am Sabbat nachmittag die hübschen Judenmädchen spazieren gehen, und wir werden ihm nicht übel nehmen, wenn er sich an ihrem Anblick mehr erfreute, als an dem ihrer männlichen Begleiter. Er lernte weniger aus eigenem Willen als auf Befehl des Vaters, der ihm eine allseitige Bildung zuteil werden lassen wollte, bei einem originellen Lehrer, dem Rektor Albrecht, hebräisch und beschrieb auch diesen Unterricht wie so manchen, den er in seiner Kindheit erhielt, in drastischer Weise. Seltsamerweise aber wurde dieser Unterricht in der hebräischen Sprache auch verknüpft mit dem Hebräischschreiben, ja selbst das Jüdischdeutsche eignete er sich, sei es durch Lektüre oder durch einen gelegentlichen Umgang mit Juden, an. Diese Kenntnis suchte er in einem nichterhaltenen Werke darzulegen und offenbarte sie in einem uns aufbewahrten Schriftstück. Dieses, das man wohl geradezu ein antisemitisches nennen kann, ist eure sogenannte Judenpredigt, die man nicht in den gewöhnlichen Ausgaben von Goethes Werken findet, ein boshafter Scherz etwa folgenden Inhalts: in dreihunderttausend Jahren wird der Messias über das Rote Meer kommen, durch den Klang einer Posaune die Juden versammeln. Alle, so viele ihrer auch seien, werden auf dem einen Schimmel des Messias Platz haben und heil über das Rote Meer kommen, die Christen aber, welche sich ans Hohn auf den Schwanz gesetzt, werden im Meere ertrinken.
Erstere Arbeit sollte ein Teil eines siebensprachigen Romans werden. Sieben Geschwister sollten in verschiedenen Sprachen miteinander korrespondieren, das jüngste, das Nestquackelchen war dazu ausersehen, in jüdischdeutscher Sprache zu konversieren.
Wichtiger als diese Spielereien war das Erlernen des Hebräischen, und zwar weniger, weil Goethe dadurch zu einem Gelehrten wurde, sondern dadurch, daß er der Bibel nahetrat. „Ich für meine Person“, so äußerte er sich in seiner Selbstbiographie, „hatte die Bibel lieb und wert, denn fast ihr allein war ich meine sittliche Bildung schuldig, und die Begebenheiten, die Lehren, die Symbole, die Gleichnisse, alles hatte sich tief bei mir eingedrückt und war auf eine oder die andere Art wirksam gewesen“. Eine solche Schätzung der Bibel äußerte sich nun bei Goethe einerseits in der Behandlung biblischer Gegenstände, andererseits in der Benutzung von Aussprüchen der Bibel in seinen Briefen und in seinen Dichtungen. Die Behandlung biblischer Gegenstände ist nicht von großer Bedeutung. Denn wenn der von der Universität Heimgekehrte in einer Abhandlung „Was stand auf den Tafeln des Bundes“ die seltsame Antwort erteilt, „nicht die zehn Gebote, sondern zehn Gesetze des israelitischen Jehovabundes“, so gewinnen wir dadurch nicht viel oder nichts Richtiges, und auch die größeren Abhandlungen über die Wanderung der Israeliten durch die Wüste, die Goethe nach Jahrzehnten wohl auf Grund von Untersuchungen und Studien, die er in seiner Jünglingszeit gemacht hatte, niederschrieb, beweisen mehr geistreiche Vermutungen als ein wirkliches Versenken in Geist und Tiefe der Bibel.
Von weit größerer Bedeutung aber ist, daß in Gedichten und Briefen biblische Anklänge sich häufig finden. Bei den Gedichten ist dies oft in Ausdrücken der Fall, bei denen der gewöhnliche Leser an die Benutzung jener alten Urkunden nicht denkt. Denn ein solcher würde bei der Romanze vom Fischer, „die einer ganz anderen Welt als der der alten Hebräer angehört, nämlich der Mystik des Naturlebens“, bei dem Vers „und ward nicht mehr gesehen“ gewiß nicht an eine biblische Vorlage denken, und doch stammt der Vers aus Genesis 5, 24. Er muß erst belehrt werden, daß der Vers aus der Harzreise im Winter „Der Du der Freuden viel schaffst“ an Jesaias, Kapitel 9, Vers 3, anklingt. Weit eher denkt er schon bei dem Faust an biblische Quellen. Häufig genug ist darauf hingewiesen worden, und infolgedessen soll dieser Hinweis nicht noch einmal ausführlich dargelegt werden, daß der Prolog im Himmel mannigfache Verwandtschaft hat mit dem Buch Hiob, daß nicht bloß Situationen, sondern daß auch manche wörtliche Übereinstimmungen mit jenem Buche in dem Prolog sich finden. Aber viel merkwürdiger ist, daß in dem berühmten Liede Gretchens ein biblisches Buch benutzt ist, dem Goethe besondere Neigung schenkte, nämlich „Das Hohe Lied“, das er im Jahre 1775 zwar nicht ausschließlich nach dem Original, sondern mit Zuhilfenahme der sogenannten englischen Bibelübersetzung in deutsche Prosa übertrug. Denn es läßt sich gar nicht leugnen, daß die Worte, „ach, dürft' ich fassen und halten ihn“ dem Hohen Lied, Kapitel 3, Vers 4, ähnlich sind, und daß der Vers „und küssen ihn, so wie ich wollt' “, sehr stark an die Vorlage, Kapitel 7 Vers 12, erinnert. Ja, die ganze Beschreibung der edlen Gestalt, des Zauberflusses der Rede und die ganze Art, in der die Liebende den Geliebten sich vorstellt, gemahnen stark an die Ausdrücke, in denen das Hohe Lied vorn Bräutigam und von der Braut redet.
Bei Dramen und Gedichten möchte nun manchem die Benutzung biblischer Vorlagen nicht so auffällig erscheinen. Bei Werken beider Art hat man zur Überlegung, zur Aussuchung von Quellen Zeit genug; wer aber in Briefen, diesen spontanen Äußerungen einer flüchtigen Minute, biblische Ausdrücke anwendet, der beweist, daß er mit diesem Buch der Bücher, wie auch Goethe die Bibel nannte, völlig verwachsen ist, keiner Überlegung und keines Nachsuchens bedarf, sondern aus treuem Gedächtnis schafft. Und namentlich in der Zeit, die der Jugendepoche ziemlich nahe steht, besonders in den ersten Weimarer Jahren, bekundet Goethe namentlich in seinen vertraulichsten Äußerungen eine geradezu merkwürdige Neigung, biblische Ausdrücke anzuwenden.
1777, am 10. Dezember, schreibt Goethe: „Mit mir verfährt Gott wie mit seinen alten Heiligen, und ich weiß nicht, woher mirs kommt. Wenn ich zum Befestigungszeichen bitte, daß möge das Fell trocken sein und die Tenne naß, so ist's so“, wörtlich entnommen aus Buch Richter 6, 36—40. Am folgenden Tage „und ich kam mir vor wie der König, den der Prophet mit dem Bogen schlagen heißt, und der zu wenig schlägt“, eine Erinnerung an Zwei Könige, Kapitel 13, Vers 17—19. Da er zum erstenmal in Berlin ist, am 17. Mai 1778, gibt er seiner Vertrauten folgende Schilderung: „Sonst war meine Seele wie eine Stadt mit geringen Mauern, die hinter sich eine Zitadelle auf dem Berge hat. Das Schloß bewachte ich, und die Stadt ließ ich in Frieden und Krieg wehrlos; nun fange ich auch an, die zu befestigen, wärs nur indes gegen die leichten Truppen“. Die ganze Stelle ist nichts anderes als eine Erweiterung des Spruches Salomonis, Kapitel 25, Vers 28. Oder wenn am 25. Juni 1779 in seinem Tagebuch notiert ist, „aber ich lasse doch nicht ab von meinen Gedanken und ringe mit dem unbekannten Engel, sollte ich mir die Hüfte ausrenken“, so ist dies eine Anlehnung und Weiterbildung der Stelle aus Genesis, Kapitel 32.
II.
Während in Frankfurt kein Jude sich nachweisen läßt, der mit Goethe in wirkliche Berührung trat, und wohl auch die Meßjuden in Leipzig oder die Händler in Straßburg in keine Beziehung zu ihm kamen, wurde die Sache in Weimar etwas anders. Nicht als wenn in dem kleinen Landstädtchen eine zahlreiche Gemeinde existiert hätte — im Gegenteil lebten nur sehr wenige Juden dort —, aber wenigstens einzelne Dorfwohnende lernte er kennen und erhielt von manchen interessante Besuche. Es ist überaus charakteristisch und wohl geeignet, ebenso die schöne Unmenschlichkeit Goethes zu zeigen, wie die Freiheit von konfessionellem Vorurteil, daß er in den ersten Jahren seines Weimarer Aufenthaltes einen durchreisenden Schutzjuden seinem hochgebietenden Oheim in Frankfurt, dem Stadtschultheißen, empfiehlt. Und eine poetische Erwähnung (gewiß nicht eine Verherrlichung) eines Juden findet sich in einem Gedichte der ersten Weimarer Zeit. In dem herrlichen Gedichte „auf Miedings Tod“ hieß es ursprünglich:
Der Jude Elkan läuft mit manchem Rest,
Und diese Gärung deutet auf ein Fest.
Diese Worte enthalten keine Verspottung, sondern nur eine Charakterisierung eines untergeordneten Mannes, der, wie der Zimmermann und andere Handwerker und Kunstgeübte, mittätig waren bei den Theaterfreuden der Weimarer Hofgesellschaft. Der Jude Elkan muß etwa ein Händler mit alten Kleidern gewesen sein. Aber seine Beziehungen zum Hofe brachten ihn bald in die Höhe: er würde Hoffaktor, unterhielt wesentlich andere Geschäfte, als er ursprünglich betrieben, wurde Bankier und brachte wohl schon selbst sein neues Geschäft zu Ehren. Jedenfalls wurden seine Nachkommen hochgeachtete Kaufleute; die von ihnen geleitete Firma besorgte des Hofes und des Dichters Geldgeschäfte; einzelne Mitglieder der Familie erwarben sich deutsche Bildung und erlangten den Umgangston der seinen Gesellschaft, sodaß ein weibliches Mitglied, Johanna Elkan, später Gattin des feinsinnigen Moritz Veit, mit Schillers Töchtern gut bekannt war und auch Zugang in Goethes Hause hatte. Es läßt sich leicht denken, daß die materiell und geistig in die Höhe gelangten Persönlichkeiten diese Namensnennung eines Vorfahren, seine Bezeichnung als eines untergeordneten Händlers unwillig empfanden und entweder selbst oder durch Vermittler bei dem Dichter auf eine Änderung der ominösen Stelle antrugen. Das menschlich Schöne aber ist, daß der Dichter diesem Ansinnen alsbald entsprach. Er strich den Namen und gab dem Verse die folgende Gestalt, in der er seit der Ausgabe letzter Hand in allen Drucken zu lesen und ausschließlich in dieser allgemein bekannt ist:
Der tätige Jude läuft usw.
So war der Name getilgt, die Sache aber beibehalten. Welche einzelne Person den Dichter bestimmte, die Variante einzufügen, ist nicht bekannt; sicher aber ist es, daß er jene Änderung vornahm, um eine zu Ehren und Ansehen gelangte Familie nicht zu kränken durch einen Hinweis aus die mehr als bescheidene Lebensstellung, die der Urvater eingenommen hatte.
Wenn nun auch, wie erwähnt, in Weimar wenig Juden wohnten, und wenn auch die Ilmstadt in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts noch nicht das Ziel so vieler begeisterter Wallfahrer war, als in dem späteren Zeitraum, so wurde doch schon in jener Zeit mancher Pilger dort freundlich willkommen, aber auch manche Juden sprachen in Goethes Hause vor. Nur zwei von ihnen aus jener Zeit sollen erwähnt werden. Der eine ist ein Mitglied der Ephraimschen Familie, der am 28. Oktober 1782 nach Weimar kam. Es ist jedenfalls der Sohn des berüchtigten Münzunternehmers Friedrich des Großen, Veitel Heine Ephraim, der als Geheimrat Ephraim in jener Epoche eine merkwürdige Rolle spielt, eine Art untergeordneter diplomatischer Agent gewesen zu sein scheint, der übrigens schließlich in eine recht unangenehme, vielleicht nicht ganz unverschuldete Lage geriet. An dem genannten Tage berichtet Goethe seiner Freundin Charlotte von Stein: „Meiner Lieben einen guten morgen zu sagen, hat mich allerlei, zuletzt der Jude Ephraim abgehalten. Von ihm zu erzählen, wird mir ein Spaß sein. Bald habe ich das Bedeutende der Judenheit zusammen und habe große Lust, in meinem Roman auch einen Juden anzubringen.“ Wir würden nun freilich herzlich wünschen, eine ausführlichere Charakteristik des merkwürdigen Besuchers zu empfangen, aber auch in ihrer Kürze ist die Notiz von der allergrößten Bedeutung, denn mit jenem Roman ist nichts anderes gemeint als „Wilheim Meisters Lehrjahre“, die ja allerdings erst im Jahre 1795 im Druck erschienen, die aber, wie die Kenner wissen, schon am Anfang der achtziger Jahre geplant und in ihrer ersten Fassung so gut wie vollständig ausgeführt waren. Man darf ja nun freilich bei Plänen nicht überflüssige Seufzer ausstoßen, daß sie nicht vollendet worden sind. Aber hier wird es uns schwer, einen solchen Seufzer zu unterdrücken, denn, wenn man auch ohne Schmerz darauf hinweisen kann, daß jener siebensprachige Roman der Knabenzeit unvollendet geblieben ist, selbst, wenn man dadurch um den Genuß gekommen ist, Goethe jüdischdeutsch sprechen zu hören, so muß man es beklagen, daß diese ausführliche Schilderung eines Juden durch Goethe unterblieben ist.
Während Goethe durch diesen Besucher freilich nur halben Genuß empfangen zu haben scheint und wohl auch dem Berliner mehr als eine Kuriosität erschien, ist der Eindruck, den er von einem jungen Medizinstudenten David Veit empfing, ein größerer, und der, den er auf jenen machte, ein unvergänglicher. David Veit, einer hochachtbaren Berliner Familie entsprossen, war durch Rahel Levin, von der bald mit einigen Worten die Rede sein muß, an Goethe empfohlen worden. Er sah ihn seit 1793 in Weimar und Jena, wurde von ihm in mannigfache Gespräche gezogen, empfing reiche Belehrung und durfte seine gegenteiligen Ansichten offen äußern. Aber weit mehr als jenes geistige Verhältnis mutet uns eine kleine Szene an, die David Veit berichtet. Als er, wie Jenaer Studenten es gern taten, einmal im Theater zu Weimar saß, bemerkte er, wie sich die Exzellenz Goethe, der Theaterleiter, hinter ihn setzte. Der Minister verwickelte ihn in ein Gespräch über das Stück und dramatische Angelegenheiten und ließ sich die Gegenreden des Studenten gefallen. Man male sich diese Szene aus, ein jüdischer Student ausgezeichnet durch freundliche Bewillkommnung durch den allgebietenden Mann, den größten Dichter jener Zeit.
Gewiß konnte Goethe durch das Studium eines kleinen Diplomaten und eines bildungseifrigen Studenten nicht alle Seiten jüdischen Wesens kennen lernen. Aber er ließ es sich angelegen sein und wurde durch den Zufall unterstützt, von verständigen Männern und schönen brauen zu hören, die Schriften der ersteren zu lesen und sich an dem Anblick der letzteren zu erquicken. Unter den bedeutenden jüdischen Schriftstellern der Aufklärungszeit sind es drei, von denen Goethe gelegentlich spricht: die beiden Kantianer Salomon Marinon und Lazarus Bendavid und der Schriftsteller, Kaufmann und Gelehrte David Friedländer. Die beiden ersteren wurden Mitarbeiter an den „Horen“, der von Schiller begründeten, durch Goethe beorderten Zeitschrift. Der Meister, dem nichts menschliches fremd war, ließ sich, ohne Kantianer zu sein, imponieren durch das gediegene Wissen, den ernsten Eifer, auch das redliche Bemühen der Genannten, in klarem und verständlichem Deutsch ihre philosophischen Gedanken auszudrücken. Mit David Friedländer, dessen Bemühungen für geistige und sittliche Hebung der Juden dem Weimarer Meister wohl unbekannt blieben und unverständlich gewesen wären, wenn er sie gekannt hätte, verband ihn das gemeinsame Sammelinteresse. David Friedländer der wie alle Berliner der älteren Generation für Goethes Werke wenig Verständnis besaß, war gleich dem Weimaraner ein eifriger Sammler von Antiquitäten und erfuhr durch Zelter, Goethes intimen Freund, von den gleichen Neigungen Goethes. Ohne Aufdringlichkeit und Überhebung sandte er durch Vermittlung des genannten Freundes manche Dublette nach Weimar und erhielt aus demselben Wege gar manches Gegengeschenk mit herzlichen Grüßen für den wackeren Mann.
Je mehr Goethe der Patriarch wurde, zu dem aus allen Ländern Wallfahrten unternommen wurden, um so mehr wurde er auch von Juden aufgesucht. Oft waren solche Begegnungen nur sehr flüchtig. Studenten, an deren Namen Goethe sich so wenig erinnerte, daß er im Tagebuch bei Erwähnung dieser Besuche eine Lücke ließ, wie ein Herr Cohn aus Danzig, strömten herbei wie andere, die es später zu außerordentlichem Ansehen und hervorragender Stellung brachten, wie der berühmte Orientalist Salomon Munk und Eduard Simson, später der erste Präsident der Goethe-Gesellschaft. Gelegentlich wird im Tagebuch auch notiert, daß zwei Herren von Rothschild mit ihrem Erzieher in Goethes Hause vorsprachen.
Etwas ausführlicher kann von Goethes Beziehungen zu einem deutschen Maler und deutschen Dichter jüdischen Glaubens geredet werden. Das herzliche Verhältnis freilich, das Goethe zu dem genialen Musiker jüdischen Ursprungs Felix Mendelssohn-Bartholdy hatte, soll hier nur gestreift werden, teils, weil es allgemein bekannt ist, teils, weil Felix gleich nach seiner Geburt getauft wurde und manchem daher in diesem Zusammenhange als ungeeignet erscheinen möchte. Aber es soll doch darauf hingewiesen werden, daß Goethe den jüdischen Eltern des zauberhaft liebenswürdigen Knaben, der ebenso durch seine Kunst wie durch seine Schönheit, wie endlich durch sein kindliches Wesen Goethe und den Seinen eine wahre Herzensfreude bereitete, Abraham und Leo Mendelssohn freundliches Entgegenkommen zeigte, daß er sie durch manchen Brief ehrte und in Äußerungen, die er über sie tat, die Anerkennung ihrer Trefflichkeit nicht sparte. Der Maler ist Moritz Oppenheim, der Dichter Michael Beer. Jener kam nach Weimar und berichtete in enthusiastischer Weise von dem Eindruck, den der alte Meister aus ihn gemacht hatte. Als ein gutmütig ehrwürdiger Greis erschien er ihm. Oppenheim war damals noch nicht der Maler jüdischen Familienlebens, sondern der Darsteller teils biblischer, teils antiker Gegenstände. Er wurde in seinen Bemühungen von dem Meister geschätzt, empfing liebenswürdige Mahnungen, freundliche Anerkennung und durfte, was ihm gewiß mehr war als klingender Lohn, einzelne Erzeugnisse seines Fleißes nicht nur längere Zeit in den Gemächern des Meisters aufstellen, sondern einzelne ihm verehren. Der Dichter Michael Beer war gleichfalls in Weimar ein wohlaufgenommener Gast, aber die Beziehungen zu ihm sind unendlich charakteristischer, weil es sich hierbei geradezu um Jüdisches handelt, denn Beer hatte ein jüdisches Drama „Der Paria“ geschrieben. Er sandte es nach Weimar und erlangte, daß das Stück durch Goethe, obgleich dieser damals direkt mit dem Theater nichts mehr zu tun hatte, zur Aufführung empfohlen wurde. Und Goethe tat dies nicht etwa aus Rücksicht auf die allgesehene Familie des Dichters, auch keineswegs bloß deshalb, weil er selbst für den Stoff Interesse besaß, sondern gerade weil er die Bedeutung des Stoffes erkannte. Denn in einem sehr merkwürdigen Programm, das er selbst für diese Aufführung schrieb, finden sich die Worte: „Der Paria könne füglich als Symbol der herabgesetzten, unterdrückten, verachteten Menschheit aller Völker gelten, und wie ein solcher Gegenstand schon allgemein menschlich erscheint, so ist er dadurch höchst poetisch.“ Man sieht aus diesen Worten, daß Goethe im Gegensatz zu manchem Zeitgenossen die innere Bedeutung des Stückes klar erkannte und trotzdem das Drama zur Aufführung empfahl und dem Dichter ermunterndes Wohlwollen zuteil werden ließ.
Und wie die Männer, unter denen man wohl auch einen Bankier Simon Lämmel in Prag aufführen kann, von dem Goethe sich österreichisches Geld wechseln ließ, und dessen Einladungen nach Prag er mit höflichen Worten erwiderte, so spielen auch jüdische Frauen in Goethes Leben eine gewisse Rolle. Er lernte in Karlsbad die schon genannte Rahel Levin kennen, ließ sich von den beiden Schwestern Marianne und Sara Meyer in Berlin, von denen die erstere einen Fürsten von Reuß heiratete (zu linker Hand, sie führte den Namen Frau von Eybenberg), die letztere mit einem Herrn von Grotthus verehelicht war, leckere Bissen schicken und mit liebenswürdigen Schmeicheleien füttern. Aber seine Beziehungen zu den genannten Frauen und anderen, die wie jene dem Judentum entstammten, wenn auch nicht zeitlebens beim Judentum verharrten, sind von so großer Bedeutung, daß sie doch kurz dargelegt werden müssen. Es soll zwar keineswegs der Versuch gemacht werden, die tausenderlei enthusiastischen Worte der Rahel und ihrer Genossinnen über Goethe auszuzählen und ebensowenig die zahlreichen Briefe zu analysieren, die Goethe an die genannten Schwestern richtete. Nur ganz kurz sei darauf hingewiesen, daß Goethe Rahels Bemerkungen über die Wanderjahre als geistreiche Darlegungen seines Wollens zum Druck empfahl und daß er aus zarter Neigung für die genannte Marianne seinen Roman „Die Wahlverwandtschaften“ schneller, als er vorgehabt hatte, beendete. Die Bedeutung jener jüdischen Frauen aber besteht in folgenden: während die Berliner der älteren Generation, wie bei der Nennung David Friedländers angedeutet wurde, durchaus auf Lessingschem Standpunkte stehend, für Goethes Jugendwerke keinerlei Sympathien befassen, sind die Frauen die Verkünderinnen des Goetheschen Evangeliums in Berlin. Sie haben, so darf man ohne jede Übertreibung sagen, nicht bloß in den jüdischen Kreisen, sondern in Berlin überhaupt Lessing entthront und Goethe auf den Thron gesetzt. Sie sind es allein, denen jener großartige Umschwung, die Begeisterung für Goethe in erster Linie zu danken ist, und daß sie es taten, ist nicht etwa eine Wirkung des persönlichen Enthusiasmus für den großen und berühmten Mann, nicht bloß ein Dank für die Huldigungen, die sie gelegentlich von ihm empfingen, sondern es ist die Folge eines tiefen Verständnisses, eines wirklichen Begreifens von Goethes Größe und Bedeutung.
III.
Wie für die Menschen, so interessierte sich Goethe auch für einzelne Vorgänge, die, wenn sie auch keineswegs von hervorragender Bedeutung in der Geschichte des Judentums sind, doch immerhin Erwähnung verdienen. Am interessantesten ist gewiß sein Verhalten bei der Neuregelung der jüdischen Angelegenheiten in Frankfurt. Wie über so viele Angelegenheiten seiner Vaterstadt, so wurde er auch über diese von einer Frankfurterin, die ihn eine Zeitlang über alles Heimische auf dem Laufenden hielt, unterrichtet. Bettine Brentano schickte ihm die Broschüren, die von jüdischer oder philanthropischer Seite geschrieben wurden, erntete aber keinen großen Dank damit. Denn Goethe erbat sich zur Ergänzung des einseitigen Urteils, das er nach diesen Aktenstücken gefällt hatte, die Arbeiten der Gegner und las mit viel größerem Behagen die Art, wie der edle Israel Jacobsohn, den er einmal spöttisch „den braunschweigischen Judenheiland" nannte, von seinen Gegnern abgeführt wurde, als er sich an den humanen Forderungen erlabte, die von den Juden oder für sie ausgestellt wurden. Gewiß mag man von einem solchen Vorfahren nicht sonderlich erbaut sein, aber es ist doch von einigem Interesse, wenn man noch heute aus der Bibliothek im Goethehause konstatieren kann, daß Goethe die ihm zugesandten Broschüren nicht etwa nur annahm, sondern sie mit der größten Aufmerksamkeit las, einzelne Worte anstrich, bei besonders bemerkenswerten Sätzen Ausrufungszeichen machte, Fehler verbesserte. Dieses aufmerksame Durchlesen der Aktenstücke beweist, wenn auch nicht die Annahme der Bettineschen Ansichten, so doch immerhin den Eifer des mit so vielen Dingen Beschäftigten, über die Angelegenheiten zu denken und das große Problem der Judenfrage sich klarzumachen.
Es hat sich keine Nachricht erhalten, ob und wie Goethe den Bemühungen, wie sie seit 1811 in Preußen und anderen Ländern, wie sie später namentlich in der Bundesakte von 1815 zum Ausdruck gelangten, entgegentrat. Es scheint fast, als wenn sich in gewisser Weise eine feindliche Auffassung verhärtet hätte, denn ein grausames Wort, das allerdings an einer entlegenen Stelle steht, möglicherweise auch einer unmutigen Aufwallung entsprungen, beweist eine durchaus abweisende Gesinnung. Denn am 24. Juni 1816 schrieb Goethe in einem Briefe an einen Vertrauten die betrübenden Worte nieder: „In Jena darf nach alten Gesetzen kein Jude übernachten. Diese löbliche Anordnung dürfte gewiß künftighin besser als bisher aufrecht erhalten werden.“ Man muß nun freilich einem solchen Worte des Unmuts die freundliche Art entgegenhalten, in der der Dichter Manchen in Jena weilenden, oder auch nur aus der Durchreise vorsprechenden Juden behandelte, und die geradezu liebevolle Weise, in der er, wie oben gezeigt wurde, David Veit in Jena und Weimar empfing.
Und ein Vorgang des Jahres 1823 zeigt, wie die Stimmungen bei dem Meister wechseln, wie seine Betrachtung und Handlungsweise eine verschiedene sein konnte. Sein bedeutender Landesfürst, Großherzog Karl August, war der erste deutsche Fürst, der seinem Lande eine Verfassung gegeben hatte. Nach diesen Bemühungen schritt er weiter und erließ im Jahre 1823 eine Verordnung, nach welcher die Ehen zwischen Juden und Christen gestattet sein sollten. Damit war aber Goethe, der sich von der aktiven Mitwirkung bei öffentlichen Angelegenheiten zurückgezogen hatte, durchaus nicht einverstanden, wie er denn wohl auch mit den übrigen Bestimmungen des Judengesetzes vorn 20. Juni 1823, das man nicht eben eine vollkommene Gleichstellung, aber doch immerhin ein ganz liberales Gesetz nennen kann, keineswegs zufrieden war. In einer Unterredung mit dem Kanzler Müller, die man wohl für authentisch halten kann, obgleich man sich hüten muß, alle solche Unterredungsberichte für unbedingt wahr anzunehmen, drückte er seinen leidenschaftlichen Zorn darüber aus. „Er ahndete die schlimmsten und grellsten Folgen davon, behauptete, wenn der Generalsuperintendent Charakter habe, müsse er lieber seine Stellung niederlegen, als eine Jüdin in der Kirche im Namen der heiligen Dreifaltigkeit trauen. Alle sittlichen Gefühle in den Familien, die doch durchaus aus den religiösen ruhten, würden durch ein solch skandalöses Gesetz untergraben. Besonders ungern sah er es, daß das weimarische Ländchen mit derartigen Institutionen den Anfang machte. In diesem Sinne rief er aus: „Wollen wir denn überall im Absurden vorausgehen, alles Fratzenhafte zuerst probieren?“
Und merkwürdig, aus demselben Jahre hat sich eine andere Verfügung des Großherzogs von Sachsen erhalten, nach der zwei Waisen jüdischer Religion in dem Allgemeinen Waisenhause untergebracht und erzogen werden sollten, und in der Verfügung, die deshalb erlassen wurde, finden sich Ausdrücke der schönsten Toleranz, und man möchte in der Tatsache und in den Worten der Verfügung, wenn auch, wie schon vorhin bemerkt, eine besondere Mitwirkung Goethes weder bezeugt, noch wahrscheinlich ist, jene Rückwirkung des humanen Geistes sehen, von dem auch unser Meister trotz aller gelegentlicher Widersprüche erfüllt war.
Wenn man aber von Vorgängen innerhalb des Judentums spricht, so darf man nicht bloß einzelne gesetzliche Bestimmungen erwähnen, sondern auch an die große Epoche der Entwicklung erinnern, und hier ist es nun merkwürdig, daß Goethe den größten Erscheinungen des modernen Judentums eine durchaus sympathische, ja zum Teil begeisterte Beachtung schenkte. Gewiß hat er nicht, als er ziemlich früh schon von Baruch Spinoza Kenntnis nahm, mit besonderem Interesse auf dessen Zugehörigkeit zum Judentum geachtet, aber es ist immerhin bemerkenswert, daß er nach erlangter Kenntnis von Spinozas Zugehörigkeit zum Judentum sich dadurch in keiner Weise abschrecken ließ. Die Art und Weise aber, wie er die zwingende Macht seiner Gedanken aus sich wirken ließ, wie er insbesondere die großartige Gedankenarbeit seiner Ethik anerkannte und zu der seinigen machte, beweist, mit welchem Respekt er jüdische Gedankenarbeit verfolgte. Ein Genius wie Spinoza war Moses Mendelssohn nicht, so ungeheuer auch seine Bedeutung für das Judentum und speziell die Stellung der Juden zum Deutschtum und der deutschen Literatur ist. Und auch hier war der große Weimaraner in keiner Weise voreingenommen gegen den Weisen Berlins, obgleich er ja selbstverständlich wußte, daß er Jude war. Er war so wenig voreingenommen gegen ihn, daß er nach einem glaubwürdigen Bericht der Dichterin Karschin nur jenen allein im Jahre 1778 besuchte, da er, wie schon gelegentlich angedeutet, in Berlin war. Und wenn sich auch kein direkter Verkehr zwischen Mendelssohn und Goethe gestaltete, wenn der letztere vielleicht auch davon wohl unterrichtet war, daß Mendelssohn, durchaus auf Lessingschem Standpunkt stehend, den Werther und die Jugendschriften verabscheute, so vergalt Goethe keineswegs Gleiches mit Gleichem, vielmehr bemühte er sich schon zur Zeit von Mendelssohns Leben, sein großes Verdienst um die Popularisierung der Philosophie anzuerkennen, lobte die lichtvolle Art seines Vortrags und, von einzelnen kleinen unerfreulichen Ausdrücken abgesehen, schätzte ihn auch dann, als Mendelssohn sich zur Abwehr des Verdachtes des Spinozismus rüstete und bei diesem Wagnis starb. Besonders aber wußte er lange Jahre nach des Weltweisen Tode dessen Verdienst um die deutsche Literatur und um die Philosophie zu rühmen, und vielleicht geschah es im Andenken an den würdigen Mann, daß er wiederum viele Jahre später Felix Mendelssohn und dessen Eltern freundlich, fast liebreich aufnahm.
IV.
Bei einem Schriftsteller und Dichter aber fragt man nicht bloß, wie bisher geschehen ist, wie jener sich zu den Dokumenten einer fremden Gemeinschaft gestellt, wie er die Menschen und Schicksale jener Genossenschaft behandelt, sondern vor allem, ob und wie er in seinen Arbeiten der Juden und ihrer Allgelegenheiten gedacht hat. Nun ist es freilich nicht möglich, jenen schon früher erwähnten siebensprachigen Roman wiederzufinden, und es ist, wie gleichfalls schon gezeigt wurde, der Plan nicht ausgeführt worden, einen Juden in dem Roman Wilhelm Meister vorzubringen. Aber, wenn auch diese beiden Zeugnisse fehlen, manch andere haben sich erhalten. Es gibt deren so viele, daß, wenn man jede Erwähnung von Juden in Gedichten und Schriften aufführen wollte, man viele Seiten zu füllen imstande wäre. Infolgedessen soll auch hier mit Verzicht auf alle die kleinen Erwähnungen nur einzelnes Bedeutungsvolle hervorgehoben werden. Es ist wenig bekannt, daß Goethe den Stoff des ewigen Juden in einem Epos behandeln wollte. In seinen Werken haben sich einzelne Fragmente, die er selbst als „Fetzen“ bezeichnet, erhalten, die uns eben keinen vollständigen Begriff des Gedichts und noch weniger seiner Stellung zur Judenfrage zu geben vermögen. Für uns bleibt ausschließlich interessant, daß der Dichter, der im Jahre 1774 diesen merkwürdigen Stoff zur Darstellung des sogenannten Separat-Christentums, d. h. der Frommen, die sich von der Allgemeinheit der Gläubigen absondern, benutzte, im Jahre 1787 denselben Stoff zu verwenden gedachte, um den Gegensatz des damaligen Katholizismus gegen das Urchristentum zu erweisen, später, 1814, bei der Schilderung jener Jugendzeit das eigentliche Wesen dieses dichterischen Vorwurfs erkannte. Damals nämlich zuerst tritt die Absicht auf, jene Wanderung des Juden, oder vielmehr das Hindurchgehen des Judentums durch die Geschichte der Zeiten in lebhafter dichterischer Weise darzustellen. Wir mögen es für unwahrscheinlich halten, daß der Dichter, obwohl er es selbst berichtet, wirklich 1774 schon daran gedacht haben sollte, einen Besuch des ewigen Juden bei Spinoza darzustellen, wohl aber öffnet sich bei Erwähnung dieses Planes eine wunderbare Perspektive. Was hätte uns ein solches Gespräch zwischen dem durch die Zeiten wandernden Vertreter einer alten Anschauung und dem ausgeklärten, scharfsinnigen, kritischen Meister ergeben können, der vieles äußerliche der alten Religion abgestreift hatte und zu einer neuen großartigen Weltanschauung gelangt war. Es ist gewiß sehr häufig nicht angebracht, über den Verlust dieser oder jener Dichtung zu klagen; in unserm Falle aber kann man das Bedauern nicht unterdrücken, daß diese Fassung des merkwürdigen Fragments nicht erhalten, oder, was wahrscheinlicher, nicht ausgeführt worden ist.
Was wir sonst Dichterisches über die Juden besitzen, kann sich mit der Hoheit des eben Erwähnten nicht messen. Es ist immerhin interessant, daß in einer der bekanntesten Nachdichtungen Goethes, im Reineke Fuchs, mit Achtung von einem Meister Abryon gesprochen wird, der aller Sprachen kundig sei, die von Poitou bis Memel gesprochen werden. Merkwürdiger aber sind zwei Zeugnisse aus der Jugendzeit. Die eine ist eine Beurteilung der „Gedichte eines polnischen Juden“, die wegen ihrer herrlichen Darstellung der „Aufgaben eines lyrischen Dichters“ oft angeführt werden. Für uns ist diese Besprechung besonders wichtig wegen zweier Stellen, die so lauten: „Zuförderst müssen wir versichern, daß die Aufschrift dieser Bogen einen sehr vorteilhaften Eindruck auf uns gemacht hat. Da tritt, dachten wir, ein feuriger Geist, ein fühlbares Herz, bis zum selbständigen Alter unter einem fremden rauhen Himmel aufgewachsen, auf einmal in unsere Welt. Was für Empfindungen werden sich in ihm regen, was für Bemerkungen wird er machen, er, dem alles neu ist?“ Und dann: „Es ist recht löblich, ein polnischer Jude sein, der Handelschaft entsagen, sich den Musen weihen, Deutsch lernen, Liederchen ründen; wenn man aber in allem zusammen nicht mehr leistet, als ein christlicher Etudant en belles lettres auch, so ist es, däucht uns, übel getan, mit seiner Judenschaft ein Aufsehen zu machen.“
Wenige Jahre später ein Drama „Das Jahrmarktsfest in Plundersweilern“, das unter den Kampfspielen der streitvollen Jugendzeit besonders bemerkenswert ist. Alle die kleinen literarischen Plänkeleien dieses Spiels können hier nicht angedeutet, geschweige denn ausführlich behandelt werden; eine Erwähnung verdient aber das Puppenspiel Esther, das in diesem Markttreiben geschickt verwertet worden ist. (Die kurze Redaktion des Jahres 1774 hat später, 1789, einer breiteren und farbloseren Fassung Platz gemacht.) Ob auch in diesem Puppenspiel in den Persönlichkeiten der Esther, ihres Onkels, des Königs, des schuldigen Ministers Haman literarische Satiren gegen Zeitgenossen des Dichters versucht waren, bekümmert uns hier wenig; für uns ist die Tatsache wichtig, daß der Dichter diesen Stoff wählte und ihn mit einem Siege der Esther schließen ließ, denn ein Sieg dieses jüdischen Mädchens bedeutet zugleich den Triumph des Judentums, und wenn Goethe ihn auch nicht mit erhabenen Worten schilderte, so ist doch die Wahl des Stoffes und der Anschluß an die übliche Behandlung desselben ein höchst merkwürdiges Zeugnis für seine Gesinnung.
Am bedeutungsvollsten sind aber einzelne Prosaaussprüche, zwei aus der Jugendzeit, zwei aus der Epoche des Alters. Schon die Tatsache, daß sie aus verschiedenen Zeiten stammen, beweist, wie am Anfang dieser Studie auseinandergesetzt ist, daß Goethe nicht bloß gelegentlich von jüdischen Dingen sprach, sondern wirklich mit dem Problem rang, das auch ihm das Judentum bereitete. In derselben Zeitschrift, aus der kurz vorher eine Rezension erwähnt war, finden sich zwei Besprechungen, die man höchstwahrscheinlich als Goethes Eigentum beanspruchen kann. Die eine wendet sich gegen eine Missionsschrift und enthält folgende Sätze: „Herr Schulz ist einer der schlechtesten Missionarien, die jemals Völker verwirrt haben. Die Judenbekehrung ist sein Zweck, und das Talent, das ihn dazu beruft, seine Fähigkeit, Hebräisch zu sprechen und was dazu gehört. Übrigens ohne Gefühl, von dem was Mensch sei, was das Bedürfnis sei, das vor der Erweckung vorhergehen muß, woher es entspringe, wie ihm durch Religion abgeholfen werde. — — Er läuft durch die Welt, bellt die Juden an, die wenigstens gescheiter sind als er selbst, beißt sich mit ihnen herum, richtet nichts aus, erbaut die guten Leute, die ihn dagegen mit Essen und Trinken erquicken usw. Daß doch auch alle Missionsgeschichten Satiren auf sich selbst sein müssen.“
Die andere hat es zu tun mit einer Schmähschrift eines Antisemiten des 18. Jahrhunderts, des Herrn J. B. Kölbele, und gibt folgende sehr lebhafte Abfertigung, die nicht bloß die Achtung für Mendelssohn beweist, sondern die Art der gegen ihn gerichteten Angriffe aufs schärfste verdammt, denn in ihr findet sich die Stelle: „Nur ein Mann, bei dem der Religionshass und die Disputiersucht Leidenschaft geworden ist, konnte schreiben: ,Gemeine Journalisten können leichtlich den Juden schuldig sein, von reichen Juden Geschenke nehmen, bei reichen Juden schmarutzen, auch durch der Juden Vorschub ein Ämtchen suchen. Kein Wunder, wenn sie Mendelssonen Altäre bauen usw.? Denkt der H. K. so unmenschlich, daß er gegen einen großen Teil der Menschen darum keine Pflichten zu haben glaubt, weil sie Juden sind? Liest er so ganz ohne Gefühl, ist er so ganz ausgestopft von Vorurteilen, daß er den Beifall, den die Mendelsonischen Werke bey allen Vernünftigen erhalten haben wo anders suchen kann als in ihrem inneren Wert?“
Der eine dem Alter entstammende von Riemer überlieferte Ausspruch lautet so: „Die Deutschen gehen nicht zugrunde, so wenig wie die Juden, weil es lauter Individuen sind.“ Sie sind Individuen, d. h. nicht etwa, sie haben jeder seinen eigenen Kopf und seine eigene Meinung, sondern sie bedeuten wirklich etwas für sich, sie heben sich aus dem Gewöhnlichen heraus und wollen sich und ihrer Anschauung Geltung verschaffen.
Die zweite Stelle findet sich in den Wanderjahren. Zwar kommt in ihnen auch ein böser Ausspruch vor, der nicht verschwiegen werden darf: „In diesem Sinne, den man vielleicht pedantisch nennen mag aber als folgerecht anerkennen muß, dulden wir keinen Juden unter uns, denn wie sollten wir ihm den Anteil an der höchsten Kultur vergönnen, deren Ursprung und Herkommen er verleugnet?“
Aber in demselben Werke findet sich noch folgendes: Bei der Darstellung der „pädagogischen Provinz“ nämlich wird dem Ältesten eine Rede in den Mund gelegt, die dazu bestimmt ist, die Bilder zu erklären, die in einem großen Saale ausgestellt sind, und da heißt es von der israelitischen Religion, die hier als eine heidnische bezeichnet wird, folgendermaßen: „Vor dem ethnischen Richterstuhl, vor dem Richterstuhl des Gottes der Völker wird nicht gefragt, ob es die beste, die vortrefflichste Nation sei, sondern nur, ob sie daure, ob sie sich erhalten habe. Das israelitische Volk hat niemals viel getaugt, wie es ihm seine Anführer, Richter, Vorsteher und Propheten tausendmal vorgeworfen haben, es besitzt wenig Tugenden und die meisten Fehler anderer Völker: aber an Selbständigkeit, Festigkeit, Tapferkeit, und wenn alles das nicht mehr gilt, an Zähheit sucht es seines Gleichen. Es ist das beharrlichste Volk der Erde, es ist, es war, es wird sein, um den Namen Jehovas durch alle Zeiten zu verherrlichen.“
Wer über Goethe und die Juden spricht oder schreibt, tut am besten, von vornherein ein Glaubensbekenntnis zu formulieren. Ich spreche nicht als Jude, sondern als Literarhistoriker. Als Jude bin ich Partei, als Literarhistoriker bin ich parteilos. Ein großer französischer Moralist, der in seinen Essais das gesamte Menschenleben zum Gegenstande seines Studiums machte, sagte von sich: „ich urteile nicht, ich erzähle“. Von einem großen Historiker Leopold von Ranke berichtet man, er habe aus die Bemerkung einiger Begeisterten, welches Hochgefühl es doch sein müsse, die Wahrheit zu erkennen und den Zusammenhang der Völkergeschichte zu enträtseln, fein lächelnd, wie es seine Art war, gesagt, „was mich zur Geschichtsforschung treibt, das ist Neugierde. Ich möchte wissen, wie die Sachen waren, von denen man bisher nichts wußte“.
Ich wage nicht, mich mit Montaigne zu vergleichen und nicht mit Ranke. Aber ich möchte wie der letztere sagen, ich möchte wissen, was Goethe von den Juden gesagt, wie er zu ihnen stand, wie sie zu ihm standen, und mit dem ersteren aussprechen, ich bringe dies alles schlicht vor, aber ich urteile nicht, ich erzähle.
Ich will nicht dem größten deutschen Schriftsteller gegenüber, zu dessen Würdigung sich mit so vielen deutscheu Gelehrten auch solche jüdischen Ursprungs vereint haben, mit sittlichen Pathos oder hochmütiger Verachtung ausrufen: weg mit ihm, er war ein Judenfeind, oder auch nur: schade, daß er ein Judenfeind war; ich will untersuchen, wie Goethe, der sich mit leichthinniger Verwerfung oder einfachem unbegründeten Lob nie begnügte, sondern der kraft seiner wissenschaftlichen Anlage Lebensrätsel zu enthüllen und Weltausgaben zu lösen strebte, zeitlebens mit dem Problem rang, das Existenz und Wesen der Juden ihm und so vielen bot.
l.
Goethe lernte in Frankfurt schon frühzeitig Juden kennen. Was sie ihm aber zeigen konnten, war keine Bildung, sondern mehr Absonderlichkeit. Er war mehrfach in der Judengasse, wohnte auf Empfehlung angesehener Personen einzelnen Zeremonien, z. B. einer Beschneidung, auch einer Hochzeit und der Feier des Laubhüttenfestes bei. Er sah gern am Sabbat nachmittag die hübschen Judenmädchen spazieren gehen, und wir werden ihm nicht übel nehmen, wenn er sich an ihrem Anblick mehr erfreute, als an dem ihrer männlichen Begleiter. Er lernte weniger aus eigenem Willen als auf Befehl des Vaters, der ihm eine allseitige Bildung zuteil werden lassen wollte, bei einem originellen Lehrer, dem Rektor Albrecht, hebräisch und beschrieb auch diesen Unterricht wie so manchen, den er in seiner Kindheit erhielt, in drastischer Weise. Seltsamerweise aber wurde dieser Unterricht in der hebräischen Sprache auch verknüpft mit dem Hebräischschreiben, ja selbst das Jüdischdeutsche eignete er sich, sei es durch Lektüre oder durch einen gelegentlichen Umgang mit Juden, an. Diese Kenntnis suchte er in einem nichterhaltenen Werke darzulegen und offenbarte sie in einem uns aufbewahrten Schriftstück. Dieses, das man wohl geradezu ein antisemitisches nennen kann, ist eure sogenannte Judenpredigt, die man nicht in den gewöhnlichen Ausgaben von Goethes Werken findet, ein boshafter Scherz etwa folgenden Inhalts: in dreihunderttausend Jahren wird der Messias über das Rote Meer kommen, durch den Klang einer Posaune die Juden versammeln. Alle, so viele ihrer auch seien, werden auf dem einen Schimmel des Messias Platz haben und heil über das Rote Meer kommen, die Christen aber, welche sich ans Hohn auf den Schwanz gesetzt, werden im Meere ertrinken.
Erstere Arbeit sollte ein Teil eines siebensprachigen Romans werden. Sieben Geschwister sollten in verschiedenen Sprachen miteinander korrespondieren, das jüngste, das Nestquackelchen war dazu ausersehen, in jüdischdeutscher Sprache zu konversieren.
Wichtiger als diese Spielereien war das Erlernen des Hebräischen, und zwar weniger, weil Goethe dadurch zu einem Gelehrten wurde, sondern dadurch, daß er der Bibel nahetrat. „Ich für meine Person“, so äußerte er sich in seiner Selbstbiographie, „hatte die Bibel lieb und wert, denn fast ihr allein war ich meine sittliche Bildung schuldig, und die Begebenheiten, die Lehren, die Symbole, die Gleichnisse, alles hatte sich tief bei mir eingedrückt und war auf eine oder die andere Art wirksam gewesen“. Eine solche Schätzung der Bibel äußerte sich nun bei Goethe einerseits in der Behandlung biblischer Gegenstände, andererseits in der Benutzung von Aussprüchen der Bibel in seinen Briefen und in seinen Dichtungen. Die Behandlung biblischer Gegenstände ist nicht von großer Bedeutung. Denn wenn der von der Universität Heimgekehrte in einer Abhandlung „Was stand auf den Tafeln des Bundes“ die seltsame Antwort erteilt, „nicht die zehn Gebote, sondern zehn Gesetze des israelitischen Jehovabundes“, so gewinnen wir dadurch nicht viel oder nichts Richtiges, und auch die größeren Abhandlungen über die Wanderung der Israeliten durch die Wüste, die Goethe nach Jahrzehnten wohl auf Grund von Untersuchungen und Studien, die er in seiner Jünglingszeit gemacht hatte, niederschrieb, beweisen mehr geistreiche Vermutungen als ein wirkliches Versenken in Geist und Tiefe der Bibel.
Von weit größerer Bedeutung aber ist, daß in Gedichten und Briefen biblische Anklänge sich häufig finden. Bei den Gedichten ist dies oft in Ausdrücken der Fall, bei denen der gewöhnliche Leser an die Benutzung jener alten Urkunden nicht denkt. Denn ein solcher würde bei der Romanze vom Fischer, „die einer ganz anderen Welt als der der alten Hebräer angehört, nämlich der Mystik des Naturlebens“, bei dem Vers „und ward nicht mehr gesehen“ gewiß nicht an eine biblische Vorlage denken, und doch stammt der Vers aus Genesis 5, 24. Er muß erst belehrt werden, daß der Vers aus der Harzreise im Winter „Der Du der Freuden viel schaffst“ an Jesaias, Kapitel 9, Vers 3, anklingt. Weit eher denkt er schon bei dem Faust an biblische Quellen. Häufig genug ist darauf hingewiesen worden, und infolgedessen soll dieser Hinweis nicht noch einmal ausführlich dargelegt werden, daß der Prolog im Himmel mannigfache Verwandtschaft hat mit dem Buch Hiob, daß nicht bloß Situationen, sondern daß auch manche wörtliche Übereinstimmungen mit jenem Buche in dem Prolog sich finden. Aber viel merkwürdiger ist, daß in dem berühmten Liede Gretchens ein biblisches Buch benutzt ist, dem Goethe besondere Neigung schenkte, nämlich „Das Hohe Lied“, das er im Jahre 1775 zwar nicht ausschließlich nach dem Original, sondern mit Zuhilfenahme der sogenannten englischen Bibelübersetzung in deutsche Prosa übertrug. Denn es läßt sich gar nicht leugnen, daß die Worte, „ach, dürft' ich fassen und halten ihn“ dem Hohen Lied, Kapitel 3, Vers 4, ähnlich sind, und daß der Vers „und küssen ihn, so wie ich wollt' “, sehr stark an die Vorlage, Kapitel 7 Vers 12, erinnert. Ja, die ganze Beschreibung der edlen Gestalt, des Zauberflusses der Rede und die ganze Art, in der die Liebende den Geliebten sich vorstellt, gemahnen stark an die Ausdrücke, in denen das Hohe Lied vorn Bräutigam und von der Braut redet.
Bei Dramen und Gedichten möchte nun manchem die Benutzung biblischer Vorlagen nicht so auffällig erscheinen. Bei Werken beider Art hat man zur Überlegung, zur Aussuchung von Quellen Zeit genug; wer aber in Briefen, diesen spontanen Äußerungen einer flüchtigen Minute, biblische Ausdrücke anwendet, der beweist, daß er mit diesem Buch der Bücher, wie auch Goethe die Bibel nannte, völlig verwachsen ist, keiner Überlegung und keines Nachsuchens bedarf, sondern aus treuem Gedächtnis schafft. Und namentlich in der Zeit, die der Jugendepoche ziemlich nahe steht, besonders in den ersten Weimarer Jahren, bekundet Goethe namentlich in seinen vertraulichsten Äußerungen eine geradezu merkwürdige Neigung, biblische Ausdrücke anzuwenden.
1777, am 10. Dezember, schreibt Goethe: „Mit mir verfährt Gott wie mit seinen alten Heiligen, und ich weiß nicht, woher mirs kommt. Wenn ich zum Befestigungszeichen bitte, daß möge das Fell trocken sein und die Tenne naß, so ist's so“, wörtlich entnommen aus Buch Richter 6, 36—40. Am folgenden Tage „und ich kam mir vor wie der König, den der Prophet mit dem Bogen schlagen heißt, und der zu wenig schlägt“, eine Erinnerung an Zwei Könige, Kapitel 13, Vers 17—19. Da er zum erstenmal in Berlin ist, am 17. Mai 1778, gibt er seiner Vertrauten folgende Schilderung: „Sonst war meine Seele wie eine Stadt mit geringen Mauern, die hinter sich eine Zitadelle auf dem Berge hat. Das Schloß bewachte ich, und die Stadt ließ ich in Frieden und Krieg wehrlos; nun fange ich auch an, die zu befestigen, wärs nur indes gegen die leichten Truppen“. Die ganze Stelle ist nichts anderes als eine Erweiterung des Spruches Salomonis, Kapitel 25, Vers 28. Oder wenn am 25. Juni 1779 in seinem Tagebuch notiert ist, „aber ich lasse doch nicht ab von meinen Gedanken und ringe mit dem unbekannten Engel, sollte ich mir die Hüfte ausrenken“, so ist dies eine Anlehnung und Weiterbildung der Stelle aus Genesis, Kapitel 32.
II.
Während in Frankfurt kein Jude sich nachweisen läßt, der mit Goethe in wirkliche Berührung trat, und wohl auch die Meßjuden in Leipzig oder die Händler in Straßburg in keine Beziehung zu ihm kamen, wurde die Sache in Weimar etwas anders. Nicht als wenn in dem kleinen Landstädtchen eine zahlreiche Gemeinde existiert hätte — im Gegenteil lebten nur sehr wenige Juden dort —, aber wenigstens einzelne Dorfwohnende lernte er kennen und erhielt von manchen interessante Besuche. Es ist überaus charakteristisch und wohl geeignet, ebenso die schöne Unmenschlichkeit Goethes zu zeigen, wie die Freiheit von konfessionellem Vorurteil, daß er in den ersten Jahren seines Weimarer Aufenthaltes einen durchreisenden Schutzjuden seinem hochgebietenden Oheim in Frankfurt, dem Stadtschultheißen, empfiehlt. Und eine poetische Erwähnung (gewiß nicht eine Verherrlichung) eines Juden findet sich in einem Gedichte der ersten Weimarer Zeit. In dem herrlichen Gedichte „auf Miedings Tod“ hieß es ursprünglich:
Der Jude Elkan läuft mit manchem Rest,
Und diese Gärung deutet auf ein Fest.
Diese Worte enthalten keine Verspottung, sondern nur eine Charakterisierung eines untergeordneten Mannes, der, wie der Zimmermann und andere Handwerker und Kunstgeübte, mittätig waren bei den Theaterfreuden der Weimarer Hofgesellschaft. Der Jude Elkan muß etwa ein Händler mit alten Kleidern gewesen sein. Aber seine Beziehungen zum Hofe brachten ihn bald in die Höhe: er würde Hoffaktor, unterhielt wesentlich andere Geschäfte, als er ursprünglich betrieben, wurde Bankier und brachte wohl schon selbst sein neues Geschäft zu Ehren. Jedenfalls wurden seine Nachkommen hochgeachtete Kaufleute; die von ihnen geleitete Firma besorgte des Hofes und des Dichters Geldgeschäfte; einzelne Mitglieder der Familie erwarben sich deutsche Bildung und erlangten den Umgangston der seinen Gesellschaft, sodaß ein weibliches Mitglied, Johanna Elkan, später Gattin des feinsinnigen Moritz Veit, mit Schillers Töchtern gut bekannt war und auch Zugang in Goethes Hause hatte. Es läßt sich leicht denken, daß die materiell und geistig in die Höhe gelangten Persönlichkeiten diese Namensnennung eines Vorfahren, seine Bezeichnung als eines untergeordneten Händlers unwillig empfanden und entweder selbst oder durch Vermittler bei dem Dichter auf eine Änderung der ominösen Stelle antrugen. Das menschlich Schöne aber ist, daß der Dichter diesem Ansinnen alsbald entsprach. Er strich den Namen und gab dem Verse die folgende Gestalt, in der er seit der Ausgabe letzter Hand in allen Drucken zu lesen und ausschließlich in dieser allgemein bekannt ist:
Der tätige Jude läuft usw.
So war der Name getilgt, die Sache aber beibehalten. Welche einzelne Person den Dichter bestimmte, die Variante einzufügen, ist nicht bekannt; sicher aber ist es, daß er jene Änderung vornahm, um eine zu Ehren und Ansehen gelangte Familie nicht zu kränken durch einen Hinweis aus die mehr als bescheidene Lebensstellung, die der Urvater eingenommen hatte.
Wenn nun auch, wie erwähnt, in Weimar wenig Juden wohnten, und wenn auch die Ilmstadt in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts noch nicht das Ziel so vieler begeisterter Wallfahrer war, als in dem späteren Zeitraum, so wurde doch schon in jener Zeit mancher Pilger dort freundlich willkommen, aber auch manche Juden sprachen in Goethes Hause vor. Nur zwei von ihnen aus jener Zeit sollen erwähnt werden. Der eine ist ein Mitglied der Ephraimschen Familie, der am 28. Oktober 1782 nach Weimar kam. Es ist jedenfalls der Sohn des berüchtigten Münzunternehmers Friedrich des Großen, Veitel Heine Ephraim, der als Geheimrat Ephraim in jener Epoche eine merkwürdige Rolle spielt, eine Art untergeordneter diplomatischer Agent gewesen zu sein scheint, der übrigens schließlich in eine recht unangenehme, vielleicht nicht ganz unverschuldete Lage geriet. An dem genannten Tage berichtet Goethe seiner Freundin Charlotte von Stein: „Meiner Lieben einen guten morgen zu sagen, hat mich allerlei, zuletzt der Jude Ephraim abgehalten. Von ihm zu erzählen, wird mir ein Spaß sein. Bald habe ich das Bedeutende der Judenheit zusammen und habe große Lust, in meinem Roman auch einen Juden anzubringen.“ Wir würden nun freilich herzlich wünschen, eine ausführlichere Charakteristik des merkwürdigen Besuchers zu empfangen, aber auch in ihrer Kürze ist die Notiz von der allergrößten Bedeutung, denn mit jenem Roman ist nichts anderes gemeint als „Wilheim Meisters Lehrjahre“, die ja allerdings erst im Jahre 1795 im Druck erschienen, die aber, wie die Kenner wissen, schon am Anfang der achtziger Jahre geplant und in ihrer ersten Fassung so gut wie vollständig ausgeführt waren. Man darf ja nun freilich bei Plänen nicht überflüssige Seufzer ausstoßen, daß sie nicht vollendet worden sind. Aber hier wird es uns schwer, einen solchen Seufzer zu unterdrücken, denn, wenn man auch ohne Schmerz darauf hinweisen kann, daß jener siebensprachige Roman der Knabenzeit unvollendet geblieben ist, selbst, wenn man dadurch um den Genuß gekommen ist, Goethe jüdischdeutsch sprechen zu hören, so muß man es beklagen, daß diese ausführliche Schilderung eines Juden durch Goethe unterblieben ist.
Während Goethe durch diesen Besucher freilich nur halben Genuß empfangen zu haben scheint und wohl auch dem Berliner mehr als eine Kuriosität erschien, ist der Eindruck, den er von einem jungen Medizinstudenten David Veit empfing, ein größerer, und der, den er auf jenen machte, ein unvergänglicher. David Veit, einer hochachtbaren Berliner Familie entsprossen, war durch Rahel Levin, von der bald mit einigen Worten die Rede sein muß, an Goethe empfohlen worden. Er sah ihn seit 1793 in Weimar und Jena, wurde von ihm in mannigfache Gespräche gezogen, empfing reiche Belehrung und durfte seine gegenteiligen Ansichten offen äußern. Aber weit mehr als jenes geistige Verhältnis mutet uns eine kleine Szene an, die David Veit berichtet. Als er, wie Jenaer Studenten es gern taten, einmal im Theater zu Weimar saß, bemerkte er, wie sich die Exzellenz Goethe, der Theaterleiter, hinter ihn setzte. Der Minister verwickelte ihn in ein Gespräch über das Stück und dramatische Angelegenheiten und ließ sich die Gegenreden des Studenten gefallen. Man male sich diese Szene aus, ein jüdischer Student ausgezeichnet durch freundliche Bewillkommnung durch den allgebietenden Mann, den größten Dichter jener Zeit.
Gewiß konnte Goethe durch das Studium eines kleinen Diplomaten und eines bildungseifrigen Studenten nicht alle Seiten jüdischen Wesens kennen lernen. Aber er ließ es sich angelegen sein und wurde durch den Zufall unterstützt, von verständigen Männern und schönen brauen zu hören, die Schriften der ersteren zu lesen und sich an dem Anblick der letzteren zu erquicken. Unter den bedeutenden jüdischen Schriftstellern der Aufklärungszeit sind es drei, von denen Goethe gelegentlich spricht: die beiden Kantianer Salomon Marinon und Lazarus Bendavid und der Schriftsteller, Kaufmann und Gelehrte David Friedländer. Die beiden ersteren wurden Mitarbeiter an den „Horen“, der von Schiller begründeten, durch Goethe beorderten Zeitschrift. Der Meister, dem nichts menschliches fremd war, ließ sich, ohne Kantianer zu sein, imponieren durch das gediegene Wissen, den ernsten Eifer, auch das redliche Bemühen der Genannten, in klarem und verständlichem Deutsch ihre philosophischen Gedanken auszudrücken. Mit David Friedländer, dessen Bemühungen für geistige und sittliche Hebung der Juden dem Weimarer Meister wohl unbekannt blieben und unverständlich gewesen wären, wenn er sie gekannt hätte, verband ihn das gemeinsame Sammelinteresse. David Friedländer der wie alle Berliner der älteren Generation für Goethes Werke wenig Verständnis besaß, war gleich dem Weimaraner ein eifriger Sammler von Antiquitäten und erfuhr durch Zelter, Goethes intimen Freund, von den gleichen Neigungen Goethes. Ohne Aufdringlichkeit und Überhebung sandte er durch Vermittlung des genannten Freundes manche Dublette nach Weimar und erhielt aus demselben Wege gar manches Gegengeschenk mit herzlichen Grüßen für den wackeren Mann.
Je mehr Goethe der Patriarch wurde, zu dem aus allen Ländern Wallfahrten unternommen wurden, um so mehr wurde er auch von Juden aufgesucht. Oft waren solche Begegnungen nur sehr flüchtig. Studenten, an deren Namen Goethe sich so wenig erinnerte, daß er im Tagebuch bei Erwähnung dieser Besuche eine Lücke ließ, wie ein Herr Cohn aus Danzig, strömten herbei wie andere, die es später zu außerordentlichem Ansehen und hervorragender Stellung brachten, wie der berühmte Orientalist Salomon Munk und Eduard Simson, später der erste Präsident der Goethe-Gesellschaft. Gelegentlich wird im Tagebuch auch notiert, daß zwei Herren von Rothschild mit ihrem Erzieher in Goethes Hause vorsprachen.
Etwas ausführlicher kann von Goethes Beziehungen zu einem deutschen Maler und deutschen Dichter jüdischen Glaubens geredet werden. Das herzliche Verhältnis freilich, das Goethe zu dem genialen Musiker jüdischen Ursprungs Felix Mendelssohn-Bartholdy hatte, soll hier nur gestreift werden, teils, weil es allgemein bekannt ist, teils, weil Felix gleich nach seiner Geburt getauft wurde und manchem daher in diesem Zusammenhange als ungeeignet erscheinen möchte. Aber es soll doch darauf hingewiesen werden, daß Goethe den jüdischen Eltern des zauberhaft liebenswürdigen Knaben, der ebenso durch seine Kunst wie durch seine Schönheit, wie endlich durch sein kindliches Wesen Goethe und den Seinen eine wahre Herzensfreude bereitete, Abraham und Leo Mendelssohn freundliches Entgegenkommen zeigte, daß er sie durch manchen Brief ehrte und in Äußerungen, die er über sie tat, die Anerkennung ihrer Trefflichkeit nicht sparte. Der Maler ist Moritz Oppenheim, der Dichter Michael Beer. Jener kam nach Weimar und berichtete in enthusiastischer Weise von dem Eindruck, den der alte Meister aus ihn gemacht hatte. Als ein gutmütig ehrwürdiger Greis erschien er ihm. Oppenheim war damals noch nicht der Maler jüdischen Familienlebens, sondern der Darsteller teils biblischer, teils antiker Gegenstände. Er wurde in seinen Bemühungen von dem Meister geschätzt, empfing liebenswürdige Mahnungen, freundliche Anerkennung und durfte, was ihm gewiß mehr war als klingender Lohn, einzelne Erzeugnisse seines Fleißes nicht nur längere Zeit in den Gemächern des Meisters aufstellen, sondern einzelne ihm verehren. Der Dichter Michael Beer war gleichfalls in Weimar ein wohlaufgenommener Gast, aber die Beziehungen zu ihm sind unendlich charakteristischer, weil es sich hierbei geradezu um Jüdisches handelt, denn Beer hatte ein jüdisches Drama „Der Paria“ geschrieben. Er sandte es nach Weimar und erlangte, daß das Stück durch Goethe, obgleich dieser damals direkt mit dem Theater nichts mehr zu tun hatte, zur Aufführung empfohlen wurde. Und Goethe tat dies nicht etwa aus Rücksicht auf die allgesehene Familie des Dichters, auch keineswegs bloß deshalb, weil er selbst für den Stoff Interesse besaß, sondern gerade weil er die Bedeutung des Stoffes erkannte. Denn in einem sehr merkwürdigen Programm, das er selbst für diese Aufführung schrieb, finden sich die Worte: „Der Paria könne füglich als Symbol der herabgesetzten, unterdrückten, verachteten Menschheit aller Völker gelten, und wie ein solcher Gegenstand schon allgemein menschlich erscheint, so ist er dadurch höchst poetisch.“ Man sieht aus diesen Worten, daß Goethe im Gegensatz zu manchem Zeitgenossen die innere Bedeutung des Stückes klar erkannte und trotzdem das Drama zur Aufführung empfahl und dem Dichter ermunterndes Wohlwollen zuteil werden ließ.
Und wie die Männer, unter denen man wohl auch einen Bankier Simon Lämmel in Prag aufführen kann, von dem Goethe sich österreichisches Geld wechseln ließ, und dessen Einladungen nach Prag er mit höflichen Worten erwiderte, so spielen auch jüdische Frauen in Goethes Leben eine gewisse Rolle. Er lernte in Karlsbad die schon genannte Rahel Levin kennen, ließ sich von den beiden Schwestern Marianne und Sara Meyer in Berlin, von denen die erstere einen Fürsten von Reuß heiratete (zu linker Hand, sie führte den Namen Frau von Eybenberg), die letztere mit einem Herrn von Grotthus verehelicht war, leckere Bissen schicken und mit liebenswürdigen Schmeicheleien füttern. Aber seine Beziehungen zu den genannten Frauen und anderen, die wie jene dem Judentum entstammten, wenn auch nicht zeitlebens beim Judentum verharrten, sind von so großer Bedeutung, daß sie doch kurz dargelegt werden müssen. Es soll zwar keineswegs der Versuch gemacht werden, die tausenderlei enthusiastischen Worte der Rahel und ihrer Genossinnen über Goethe auszuzählen und ebensowenig die zahlreichen Briefe zu analysieren, die Goethe an die genannten Schwestern richtete. Nur ganz kurz sei darauf hingewiesen, daß Goethe Rahels Bemerkungen über die Wanderjahre als geistreiche Darlegungen seines Wollens zum Druck empfahl und daß er aus zarter Neigung für die genannte Marianne seinen Roman „Die Wahlverwandtschaften“ schneller, als er vorgehabt hatte, beendete. Die Bedeutung jener jüdischen Frauen aber besteht in folgenden: während die Berliner der älteren Generation, wie bei der Nennung David Friedländers angedeutet wurde, durchaus auf Lessingschem Standpunkte stehend, für Goethes Jugendwerke keinerlei Sympathien befassen, sind die Frauen die Verkünderinnen des Goetheschen Evangeliums in Berlin. Sie haben, so darf man ohne jede Übertreibung sagen, nicht bloß in den jüdischen Kreisen, sondern in Berlin überhaupt Lessing entthront und Goethe auf den Thron gesetzt. Sie sind es allein, denen jener großartige Umschwung, die Begeisterung für Goethe in erster Linie zu danken ist, und daß sie es taten, ist nicht etwa eine Wirkung des persönlichen Enthusiasmus für den großen und berühmten Mann, nicht bloß ein Dank für die Huldigungen, die sie gelegentlich von ihm empfingen, sondern es ist die Folge eines tiefen Verständnisses, eines wirklichen Begreifens von Goethes Größe und Bedeutung.
III.
Wie für die Menschen, so interessierte sich Goethe auch für einzelne Vorgänge, die, wenn sie auch keineswegs von hervorragender Bedeutung in der Geschichte des Judentums sind, doch immerhin Erwähnung verdienen. Am interessantesten ist gewiß sein Verhalten bei der Neuregelung der jüdischen Angelegenheiten in Frankfurt. Wie über so viele Angelegenheiten seiner Vaterstadt, so wurde er auch über diese von einer Frankfurterin, die ihn eine Zeitlang über alles Heimische auf dem Laufenden hielt, unterrichtet. Bettine Brentano schickte ihm die Broschüren, die von jüdischer oder philanthropischer Seite geschrieben wurden, erntete aber keinen großen Dank damit. Denn Goethe erbat sich zur Ergänzung des einseitigen Urteils, das er nach diesen Aktenstücken gefällt hatte, die Arbeiten der Gegner und las mit viel größerem Behagen die Art, wie der edle Israel Jacobsohn, den er einmal spöttisch „den braunschweigischen Judenheiland" nannte, von seinen Gegnern abgeführt wurde, als er sich an den humanen Forderungen erlabte, die von den Juden oder für sie ausgestellt wurden. Gewiß mag man von einem solchen Vorfahren nicht sonderlich erbaut sein, aber es ist doch von einigem Interesse, wenn man noch heute aus der Bibliothek im Goethehause konstatieren kann, daß Goethe die ihm zugesandten Broschüren nicht etwa nur annahm, sondern sie mit der größten Aufmerksamkeit las, einzelne Worte anstrich, bei besonders bemerkenswerten Sätzen Ausrufungszeichen machte, Fehler verbesserte. Dieses aufmerksame Durchlesen der Aktenstücke beweist, wenn auch nicht die Annahme der Bettineschen Ansichten, so doch immerhin den Eifer des mit so vielen Dingen Beschäftigten, über die Angelegenheiten zu denken und das große Problem der Judenfrage sich klarzumachen.
Es hat sich keine Nachricht erhalten, ob und wie Goethe den Bemühungen, wie sie seit 1811 in Preußen und anderen Ländern, wie sie später namentlich in der Bundesakte von 1815 zum Ausdruck gelangten, entgegentrat. Es scheint fast, als wenn sich in gewisser Weise eine feindliche Auffassung verhärtet hätte, denn ein grausames Wort, das allerdings an einer entlegenen Stelle steht, möglicherweise auch einer unmutigen Aufwallung entsprungen, beweist eine durchaus abweisende Gesinnung. Denn am 24. Juni 1816 schrieb Goethe in einem Briefe an einen Vertrauten die betrübenden Worte nieder: „In Jena darf nach alten Gesetzen kein Jude übernachten. Diese löbliche Anordnung dürfte gewiß künftighin besser als bisher aufrecht erhalten werden.“ Man muß nun freilich einem solchen Worte des Unmuts die freundliche Art entgegenhalten, in der der Dichter Manchen in Jena weilenden, oder auch nur aus der Durchreise vorsprechenden Juden behandelte, und die geradezu liebevolle Weise, in der er, wie oben gezeigt wurde, David Veit in Jena und Weimar empfing.
Und ein Vorgang des Jahres 1823 zeigt, wie die Stimmungen bei dem Meister wechseln, wie seine Betrachtung und Handlungsweise eine verschiedene sein konnte. Sein bedeutender Landesfürst, Großherzog Karl August, war der erste deutsche Fürst, der seinem Lande eine Verfassung gegeben hatte. Nach diesen Bemühungen schritt er weiter und erließ im Jahre 1823 eine Verordnung, nach welcher die Ehen zwischen Juden und Christen gestattet sein sollten. Damit war aber Goethe, der sich von der aktiven Mitwirkung bei öffentlichen Angelegenheiten zurückgezogen hatte, durchaus nicht einverstanden, wie er denn wohl auch mit den übrigen Bestimmungen des Judengesetzes vorn 20. Juni 1823, das man nicht eben eine vollkommene Gleichstellung, aber doch immerhin ein ganz liberales Gesetz nennen kann, keineswegs zufrieden war. In einer Unterredung mit dem Kanzler Müller, die man wohl für authentisch halten kann, obgleich man sich hüten muß, alle solche Unterredungsberichte für unbedingt wahr anzunehmen, drückte er seinen leidenschaftlichen Zorn darüber aus. „Er ahndete die schlimmsten und grellsten Folgen davon, behauptete, wenn der Generalsuperintendent Charakter habe, müsse er lieber seine Stellung niederlegen, als eine Jüdin in der Kirche im Namen der heiligen Dreifaltigkeit trauen. Alle sittlichen Gefühle in den Familien, die doch durchaus aus den religiösen ruhten, würden durch ein solch skandalöses Gesetz untergraben. Besonders ungern sah er es, daß das weimarische Ländchen mit derartigen Institutionen den Anfang machte. In diesem Sinne rief er aus: „Wollen wir denn überall im Absurden vorausgehen, alles Fratzenhafte zuerst probieren?“
Und merkwürdig, aus demselben Jahre hat sich eine andere Verfügung des Großherzogs von Sachsen erhalten, nach der zwei Waisen jüdischer Religion in dem Allgemeinen Waisenhause untergebracht und erzogen werden sollten, und in der Verfügung, die deshalb erlassen wurde, finden sich Ausdrücke der schönsten Toleranz, und man möchte in der Tatsache und in den Worten der Verfügung, wenn auch, wie schon vorhin bemerkt, eine besondere Mitwirkung Goethes weder bezeugt, noch wahrscheinlich ist, jene Rückwirkung des humanen Geistes sehen, von dem auch unser Meister trotz aller gelegentlicher Widersprüche erfüllt war.
Wenn man aber von Vorgängen innerhalb des Judentums spricht, so darf man nicht bloß einzelne gesetzliche Bestimmungen erwähnen, sondern auch an die große Epoche der Entwicklung erinnern, und hier ist es nun merkwürdig, daß Goethe den größten Erscheinungen des modernen Judentums eine durchaus sympathische, ja zum Teil begeisterte Beachtung schenkte. Gewiß hat er nicht, als er ziemlich früh schon von Baruch Spinoza Kenntnis nahm, mit besonderem Interesse auf dessen Zugehörigkeit zum Judentum geachtet, aber es ist immerhin bemerkenswert, daß er nach erlangter Kenntnis von Spinozas Zugehörigkeit zum Judentum sich dadurch in keiner Weise abschrecken ließ. Die Art und Weise aber, wie er die zwingende Macht seiner Gedanken aus sich wirken ließ, wie er insbesondere die großartige Gedankenarbeit seiner Ethik anerkannte und zu der seinigen machte, beweist, mit welchem Respekt er jüdische Gedankenarbeit verfolgte. Ein Genius wie Spinoza war Moses Mendelssohn nicht, so ungeheuer auch seine Bedeutung für das Judentum und speziell die Stellung der Juden zum Deutschtum und der deutschen Literatur ist. Und auch hier war der große Weimaraner in keiner Weise voreingenommen gegen den Weisen Berlins, obgleich er ja selbstverständlich wußte, daß er Jude war. Er war so wenig voreingenommen gegen ihn, daß er nach einem glaubwürdigen Bericht der Dichterin Karschin nur jenen allein im Jahre 1778 besuchte, da er, wie schon gelegentlich angedeutet, in Berlin war. Und wenn sich auch kein direkter Verkehr zwischen Mendelssohn und Goethe gestaltete, wenn der letztere vielleicht auch davon wohl unterrichtet war, daß Mendelssohn, durchaus auf Lessingschem Standpunkt stehend, den Werther und die Jugendschriften verabscheute, so vergalt Goethe keineswegs Gleiches mit Gleichem, vielmehr bemühte er sich schon zur Zeit von Mendelssohns Leben, sein großes Verdienst um die Popularisierung der Philosophie anzuerkennen, lobte die lichtvolle Art seines Vortrags und, von einzelnen kleinen unerfreulichen Ausdrücken abgesehen, schätzte ihn auch dann, als Mendelssohn sich zur Abwehr des Verdachtes des Spinozismus rüstete und bei diesem Wagnis starb. Besonders aber wußte er lange Jahre nach des Weltweisen Tode dessen Verdienst um die deutsche Literatur und um die Philosophie zu rühmen, und vielleicht geschah es im Andenken an den würdigen Mann, daß er wiederum viele Jahre später Felix Mendelssohn und dessen Eltern freundlich, fast liebreich aufnahm.
IV.
Bei einem Schriftsteller und Dichter aber fragt man nicht bloß, wie bisher geschehen ist, wie jener sich zu den Dokumenten einer fremden Gemeinschaft gestellt, wie er die Menschen und Schicksale jener Genossenschaft behandelt, sondern vor allem, ob und wie er in seinen Arbeiten der Juden und ihrer Allgelegenheiten gedacht hat. Nun ist es freilich nicht möglich, jenen schon früher erwähnten siebensprachigen Roman wiederzufinden, und es ist, wie gleichfalls schon gezeigt wurde, der Plan nicht ausgeführt worden, einen Juden in dem Roman Wilhelm Meister vorzubringen. Aber, wenn auch diese beiden Zeugnisse fehlen, manch andere haben sich erhalten. Es gibt deren so viele, daß, wenn man jede Erwähnung von Juden in Gedichten und Schriften aufführen wollte, man viele Seiten zu füllen imstande wäre. Infolgedessen soll auch hier mit Verzicht auf alle die kleinen Erwähnungen nur einzelnes Bedeutungsvolle hervorgehoben werden. Es ist wenig bekannt, daß Goethe den Stoff des ewigen Juden in einem Epos behandeln wollte. In seinen Werken haben sich einzelne Fragmente, die er selbst als „Fetzen“ bezeichnet, erhalten, die uns eben keinen vollständigen Begriff des Gedichts und noch weniger seiner Stellung zur Judenfrage zu geben vermögen. Für uns bleibt ausschließlich interessant, daß der Dichter, der im Jahre 1774 diesen merkwürdigen Stoff zur Darstellung des sogenannten Separat-Christentums, d. h. der Frommen, die sich von der Allgemeinheit der Gläubigen absondern, benutzte, im Jahre 1787 denselben Stoff zu verwenden gedachte, um den Gegensatz des damaligen Katholizismus gegen das Urchristentum zu erweisen, später, 1814, bei der Schilderung jener Jugendzeit das eigentliche Wesen dieses dichterischen Vorwurfs erkannte. Damals nämlich zuerst tritt die Absicht auf, jene Wanderung des Juden, oder vielmehr das Hindurchgehen des Judentums durch die Geschichte der Zeiten in lebhafter dichterischer Weise darzustellen. Wir mögen es für unwahrscheinlich halten, daß der Dichter, obwohl er es selbst berichtet, wirklich 1774 schon daran gedacht haben sollte, einen Besuch des ewigen Juden bei Spinoza darzustellen, wohl aber öffnet sich bei Erwähnung dieses Planes eine wunderbare Perspektive. Was hätte uns ein solches Gespräch zwischen dem durch die Zeiten wandernden Vertreter einer alten Anschauung und dem ausgeklärten, scharfsinnigen, kritischen Meister ergeben können, der vieles äußerliche der alten Religion abgestreift hatte und zu einer neuen großartigen Weltanschauung gelangt war. Es ist gewiß sehr häufig nicht angebracht, über den Verlust dieser oder jener Dichtung zu klagen; in unserm Falle aber kann man das Bedauern nicht unterdrücken, daß diese Fassung des merkwürdigen Fragments nicht erhalten, oder, was wahrscheinlicher, nicht ausgeführt worden ist.
Was wir sonst Dichterisches über die Juden besitzen, kann sich mit der Hoheit des eben Erwähnten nicht messen. Es ist immerhin interessant, daß in einer der bekanntesten Nachdichtungen Goethes, im Reineke Fuchs, mit Achtung von einem Meister Abryon gesprochen wird, der aller Sprachen kundig sei, die von Poitou bis Memel gesprochen werden. Merkwürdiger aber sind zwei Zeugnisse aus der Jugendzeit. Die eine ist eine Beurteilung der „Gedichte eines polnischen Juden“, die wegen ihrer herrlichen Darstellung der „Aufgaben eines lyrischen Dichters“ oft angeführt werden. Für uns ist diese Besprechung besonders wichtig wegen zweier Stellen, die so lauten: „Zuförderst müssen wir versichern, daß die Aufschrift dieser Bogen einen sehr vorteilhaften Eindruck auf uns gemacht hat. Da tritt, dachten wir, ein feuriger Geist, ein fühlbares Herz, bis zum selbständigen Alter unter einem fremden rauhen Himmel aufgewachsen, auf einmal in unsere Welt. Was für Empfindungen werden sich in ihm regen, was für Bemerkungen wird er machen, er, dem alles neu ist?“ Und dann: „Es ist recht löblich, ein polnischer Jude sein, der Handelschaft entsagen, sich den Musen weihen, Deutsch lernen, Liederchen ründen; wenn man aber in allem zusammen nicht mehr leistet, als ein christlicher Etudant en belles lettres auch, so ist es, däucht uns, übel getan, mit seiner Judenschaft ein Aufsehen zu machen.“
Wenige Jahre später ein Drama „Das Jahrmarktsfest in Plundersweilern“, das unter den Kampfspielen der streitvollen Jugendzeit besonders bemerkenswert ist. Alle die kleinen literarischen Plänkeleien dieses Spiels können hier nicht angedeutet, geschweige denn ausführlich behandelt werden; eine Erwähnung verdient aber das Puppenspiel Esther, das in diesem Markttreiben geschickt verwertet worden ist. (Die kurze Redaktion des Jahres 1774 hat später, 1789, einer breiteren und farbloseren Fassung Platz gemacht.) Ob auch in diesem Puppenspiel in den Persönlichkeiten der Esther, ihres Onkels, des Königs, des schuldigen Ministers Haman literarische Satiren gegen Zeitgenossen des Dichters versucht waren, bekümmert uns hier wenig; für uns ist die Tatsache wichtig, daß der Dichter diesen Stoff wählte und ihn mit einem Siege der Esther schließen ließ, denn ein Sieg dieses jüdischen Mädchens bedeutet zugleich den Triumph des Judentums, und wenn Goethe ihn auch nicht mit erhabenen Worten schilderte, so ist doch die Wahl des Stoffes und der Anschluß an die übliche Behandlung desselben ein höchst merkwürdiges Zeugnis für seine Gesinnung.
Am bedeutungsvollsten sind aber einzelne Prosaaussprüche, zwei aus der Jugendzeit, zwei aus der Epoche des Alters. Schon die Tatsache, daß sie aus verschiedenen Zeiten stammen, beweist, wie am Anfang dieser Studie auseinandergesetzt ist, daß Goethe nicht bloß gelegentlich von jüdischen Dingen sprach, sondern wirklich mit dem Problem rang, das auch ihm das Judentum bereitete. In derselben Zeitschrift, aus der kurz vorher eine Rezension erwähnt war, finden sich zwei Besprechungen, die man höchstwahrscheinlich als Goethes Eigentum beanspruchen kann. Die eine wendet sich gegen eine Missionsschrift und enthält folgende Sätze: „Herr Schulz ist einer der schlechtesten Missionarien, die jemals Völker verwirrt haben. Die Judenbekehrung ist sein Zweck, und das Talent, das ihn dazu beruft, seine Fähigkeit, Hebräisch zu sprechen und was dazu gehört. Übrigens ohne Gefühl, von dem was Mensch sei, was das Bedürfnis sei, das vor der Erweckung vorhergehen muß, woher es entspringe, wie ihm durch Religion abgeholfen werde. — — Er läuft durch die Welt, bellt die Juden an, die wenigstens gescheiter sind als er selbst, beißt sich mit ihnen herum, richtet nichts aus, erbaut die guten Leute, die ihn dagegen mit Essen und Trinken erquicken usw. Daß doch auch alle Missionsgeschichten Satiren auf sich selbst sein müssen.“
Die andere hat es zu tun mit einer Schmähschrift eines Antisemiten des 18. Jahrhunderts, des Herrn J. B. Kölbele, und gibt folgende sehr lebhafte Abfertigung, die nicht bloß die Achtung für Mendelssohn beweist, sondern die Art der gegen ihn gerichteten Angriffe aufs schärfste verdammt, denn in ihr findet sich die Stelle: „Nur ein Mann, bei dem der Religionshass und die Disputiersucht Leidenschaft geworden ist, konnte schreiben: ,Gemeine Journalisten können leichtlich den Juden schuldig sein, von reichen Juden Geschenke nehmen, bei reichen Juden schmarutzen, auch durch der Juden Vorschub ein Ämtchen suchen. Kein Wunder, wenn sie Mendelssonen Altäre bauen usw.? Denkt der H. K. so unmenschlich, daß er gegen einen großen Teil der Menschen darum keine Pflichten zu haben glaubt, weil sie Juden sind? Liest er so ganz ohne Gefühl, ist er so ganz ausgestopft von Vorurteilen, daß er den Beifall, den die Mendelsonischen Werke bey allen Vernünftigen erhalten haben wo anders suchen kann als in ihrem inneren Wert?“
Der eine dem Alter entstammende von Riemer überlieferte Ausspruch lautet so: „Die Deutschen gehen nicht zugrunde, so wenig wie die Juden, weil es lauter Individuen sind.“ Sie sind Individuen, d. h. nicht etwa, sie haben jeder seinen eigenen Kopf und seine eigene Meinung, sondern sie bedeuten wirklich etwas für sich, sie heben sich aus dem Gewöhnlichen heraus und wollen sich und ihrer Anschauung Geltung verschaffen.
Die zweite Stelle findet sich in den Wanderjahren. Zwar kommt in ihnen auch ein böser Ausspruch vor, der nicht verschwiegen werden darf: „In diesem Sinne, den man vielleicht pedantisch nennen mag aber als folgerecht anerkennen muß, dulden wir keinen Juden unter uns, denn wie sollten wir ihm den Anteil an der höchsten Kultur vergönnen, deren Ursprung und Herkommen er verleugnet?“
Aber in demselben Werke findet sich noch folgendes: Bei der Darstellung der „pädagogischen Provinz“ nämlich wird dem Ältesten eine Rede in den Mund gelegt, die dazu bestimmt ist, die Bilder zu erklären, die in einem großen Saale ausgestellt sind, und da heißt es von der israelitischen Religion, die hier als eine heidnische bezeichnet wird, folgendermaßen: „Vor dem ethnischen Richterstuhl, vor dem Richterstuhl des Gottes der Völker wird nicht gefragt, ob es die beste, die vortrefflichste Nation sei, sondern nur, ob sie daure, ob sie sich erhalten habe. Das israelitische Volk hat niemals viel getaugt, wie es ihm seine Anführer, Richter, Vorsteher und Propheten tausendmal vorgeworfen haben, es besitzt wenig Tugenden und die meisten Fehler anderer Völker: aber an Selbständigkeit, Festigkeit, Tapferkeit, und wenn alles das nicht mehr gilt, an Zähheit sucht es seines Gleichen. Es ist das beharrlichste Volk der Erde, es ist, es war, es wird sein, um den Namen Jehovas durch alle Zeiten zu verherrlichen.“
Dieses Kapitel ist Teil des Buches Die Deutsche Literatur und die Juden
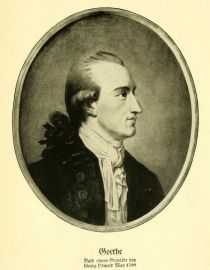
Goethe im Jahre 1799

Charlotte von Stein, enge Freundin von Goethe

Felix Mendelssohn-Batholdy (1809-1847), deutscher Komponist und Freund Goethes

Bettine Brentano (1785-1859), deutsche Schriftstellerin

Frankfurt am Main, Geburtsort Goethes

Goethe und Schiller in Weimar

Goethe und Herzog Karl August

Hiob, vom Teufel mit dem Aussatz geschlagen

Jüdische Hochzeit im jahre 1717

In Jena durfte zu Goethes Zeiten kein Jude übernachten

Großherzog Karl August, erlaubte 1823 die Ehe zwischen Juden und Christen

In Weimar lebten zur Zeit Goethes nur ganz wenig Juden

Straßburger Münster zur Zeit Goethes

Goethe und Schiller in Weimar
alle Kapitel sehen