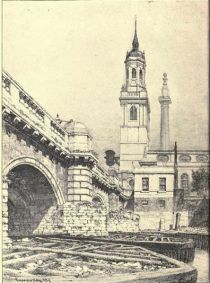Der englische Sittenroman
Aus: Deutsches Museum. Zeitschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben. Herausgegeben von Robert Prutz. 1ter Jahrgang 1851. Januar-Juni.
Autor: Wellmann A. (?), Erscheinungsjahr: 1851
Themenbereiche
Man hat den Roman mit Recht die vorzugsweise moderne, weil universale, Kunstform genannt. Die antike, ganz objektive Kunst schied die verschiedenen Gattungen der Poesie viel bestimmter und wies einer jeden, dem Epos, der Lyrik, dem Drama nicht nur ihren eigentümlichen Inhalt, sondern auch ihre gesonderte rhythmische Form, ja selbst einen verschiedenen Sprachdialekt an. Indem die moderne Kunst dagegen den Schwerpunkt ganz in die Fülle der subjektiven Empfindung verlegte, war ihr eine strengere Sonderung der Formen des poetischen Schaffens nicht nur nicht mehr Bedürfnis), sondern sie bedurfte auch einer Form, deren charakteristisches Merkmal eben die Befreiung von jedem durch die bisherigen Formen bedingten Zwange, also nahezu die Formlosigkeit war.
*******************************************
*******************************************
Diese lose Form war der Roman, der sogar das bisherige Kennzeichen aller Poesie, das rhythmische Kleid, abstreifte und sich als ein neutrales Gebiet zwischen den beiden Hauptreichen aller Literaturen, der Poesie und der Prosa, auszubreiten anfing, indem er indessen beide weniger trennte als vielmehr vereinigte. Diese wunderbare, aller scharfen Begrenzung sich entziehende Schöpfung der modernen Poesie ist eine rechte Lieblingsgattung der europäischen Kulturvölker geworden, von keinem derselben aber mit größerer Vorliebe und mit größerem Erfolge behandelt worden, als von den Engländern, für deren Neigung zu subjektivster Ungebundenheit und zugleich grillenhafter Einseitigkeit keine bequemere Form erfunden werden konnte. Wir werden daher an dem englischen Roman am besten und vollständigsten den ganzen Umfang des Gebietes ausmessen können, über welches sich der Roman überhaupt, als der bunte Tummelplatz alles möglichen Inhalts und der kurze Inbegriff aller möglichen Gattungen der Poesie, ausbreitet.
Man unterscheidet bekanntlich drei Hauptgattungen der Poesie-Epos, Lyrik und Drama. Ohne auf die hinlänglich erörterten Merkmale dieser Unterscheidung hier weiter einzugehen, wollen wir nur daran erinnern, dass sich vorzugsweise im Drama, und zwar sowohl in der Tragödie als Komödie, in dem bewegten Verlaufe einer Handlung, die sich durch lebendige Menschen als unmittelbarste Gegenwart vor den Augen des Zuschauers abspinnt, die ganze Weltanschauung gerade des Zeitalters, dem das Dichterwerk angehört, vergegenwärtigt, während das objektivere Epos mit beschaulicher Ruhe sich in eine ferne Vergangenheit und deren Anschauungsweise versenkt, und die ganz subjektive Lyrik jedem, selbst dem grillenhaftesten und abnormsten, über die allgemeine Denkweise kühn hinausfliegenden Gefühle einen Ausdruck ermöglicht. Epos und Lyrik finden mithin in dem Drama, welches die subjektive Anschauungsweise einer bestimmten Zeit objektiv aussaßt oder verallgemeinert, ihren wahren Einigungs- und Mittelpunkt. Aus dem Gesagten ergibt sich nun leicht, dass man mit Unrecht den Roman als solchen das Epos der modernen Zeit genannt hat. Vielmehr dürfte man aus der Entwicklung, welche die englische Romanliteratur, als die reichste von allen, genommen hat, mit einigem Scheine zu folgern wagen, dass in dem Romane alle erwähnten Gattungen der Poesie ihre gemeinsame Vertretung finden.
Das wahre Epos der Romanliteratur ist der historische Roman, in England durch Walter Scott zu einer Vollendung erhoben, welche kein anderes europäisches Volk (mit Ausnahme vielleicht der Italiener, die in Manzonis Verlobten wenigstens Ein musterhaftes Werk dieser Art aufzuweisen haben) erreicht hat. In diesen Walter Scottschen Romanen finden wir die ganze Plastik des Epos in der Detailbeschreibung des Äußeren, der Waffen, Kleider u. s. w., die epische Ruhe und behagliche Breite und vor allen Dingen die epische Objektivität, die uns den Autor ganz vergessen lässt und uns selbst so zauberisch umspinnt, dass wir uns ohne Zwang in den wilden schottischen Hochlanden unter den kühnen Freibeutern ebenso zu Hause finden, wie am Hofe der Königin Elisabeth oder des tyrannischen Ludwigs XI. von Frankreich. Diese Manier, eine vergangene Zeit der Phantasie zu vergegenwärtigen, war so unterhaltend und bot so viel Abwechslung dar, dass der historische Roman bald die Lieblingslektüre des ganzen europäischen Publikums wurde. Aber Scott ist nur von Cooper einigermaßen erreicht worden, während z. B. in Bulwers historischen Romanen, wie in den meisten deutschen, der gelehrte Schweiß des Autors, mit dem er jede Seite seines Werkes bezeichnet, uns alle Illusion verdirbt, und wir uns aus der Halle der alten Sachsenkönige oder den Gassen von Pompeji immer wieder in die enge, mit Büchern erfüllte Studierstube des Verfassers versetzt sehen. Indessen dürfen wir den historischen Roman, insofern er das Epos der Romanliteratur repräsentieren soll, keineswegs auf einen zu engen Kreis beschränken. Ihm fallen nicht etwa bloß die Romane zu, die ihren Stoff aus der Weltgeschichte entlehnt haben, sondern alle diejenigen überhaupt, bei denen die Erzählung, die Begebenheit, das stoffliche Interesse die Hauptsache ist, und wir werden dieser Klasse nicht nur Miss Radcliffes Schauer erregende Geheimnisse Udolphos, die Robinsonaden und unsere zahlreichen Ritter- und Räuberromane, sondern auch Produktionen, wie Gellerts Leben der schwedischen Gräfin beizählen müssen. Die Form ist auch hier, wie in allen Zweigen der Romanliteratur, eine völlig freie und nur durch den Fortgang der Erzählung gebunden, und wir Deutschen besitzen historische Romane von Feßler und Meißner, welche dialogisiert, und andere (z. B. von der Pichler), welche in Briefform abgefasst sind.
Die Lyrik des Romans hat ihren vollständigsten Ausdruck in dem humoristischen Roman der Engländer gefunden, als dessen Hauptrepräsentant bekanntlich Sterne anzusehen ist. Hier befinden wir uns auf dem Boden der ungebundensten Subjektivität: die Erzählung ist Nebensache, der Einfall ist Alles. Die Formlosigkeit hat hier ihre höchste Höhe erreicht, und die Erzählung wird nicht nur beliebig durch Reflexionen über die fern liegendsten Dinge unterbrochen, sondern auch absichtlich (z. B. durch Versetzung der Kapitel) verwirrt und verschoben. Der Stoff ist hier fast gleichgültig, das Subjekt des Autors tritt völlig in den Vordergrund, tyrannisiert mit seinen Einfällen den Leser und trotzt in grillenhaftem Eigensinn den Überzeugungen wie den Vorurteilen seiner Zeit. Es ist diese Art des Romans wie geschaffen für die Sonderlingslaunen des Engländers und wird diesem daher immer lieb bleiben, während der systematischere Deutsche der formlosen Produktionen seiner Humoristen, seiner Hippel und großen und kleinen Jean Paule, bald überdrüssig geworden ist. Übrigens ist nur die subjektive Willkür, die Herrschaft des Autors über den Stoff das Charakteristische dieser Gattung von Romanen, nicht aber der Humor, denn der Humor, dieses „Lächeln unter Tränen“ ist eine allgemeine Weltanschauung, die an keine bestimmte Form der Poesie gebunden ist und sich daher ebensowohl im Drama oder im lyrischen Gedicht manifestieren kann. Aus diesem Grunde haben wir das Recht, dieser Klasse des Romans überhaupt alle diejenigen Romane zuzuweisen, in welchen das Gefühl, die Gesinnung, die Ansicht des Verfassers die Hauptsache, die Erzählung aber Nebensache ist. Hiermit gelangen wir denn auf das Feld, auf welchem sich von je her der deutsche Roman vorzugsweise und am liebsten bewegt hat. Denn konnte sich der Deutsche auch auf die Länge mit den tollen Sprüngen einer regellosen Subjektivität nicht befreunden, so liebte er es doch, seine Gefühle und die Resultate seines Denkens in ungestörter Redseligkeit zu exponieren, und wie hätte er dies besser vermocht, ohne sich doch persönlich bloß zu stellen, als indem er sie seinen Helden in den Mund legte? So folgen sich denn in unserer Literatur die Reflexionsromane in ununterbrochener Reihe von den sentimentalen Romanen à la Werther und den Künstlerromanen nach Wilhelm Meisters Zuschnitt an bis zu den Emanzipationsromanen des jungen Deutschlands. Diese Art von Romanen, die teilweise gänzlich der Didaktik anheimfallen, finden wir in der englischen Literatur weniger, weil es dem Engländer in seinem egoistischen Streben nach subjektiver Ungebundenheit eben gar nicht um das Belehren oder überhaupt um den Inhalt, sondern rein um die formelle Freiheit zu tun ist, an deren ungezügeltem Gebrauche sich Autor wie Leser erfreuen.
Dem Drama, insofern es vorzugsweise die Weltanschauung der Zeit, welcher es seine Entstehung verdankt, vergegenwärtigt, ist der Sittenroman zu vergleichen, welcher seinen Stoff aus den Zuständen der realen Gegenwart entnimmt, und bei dem es weder aus die Begebenheit noch aus die subjektive Ansicht, sondern auf die Charakteristik ankommt. Der Sittenroman lässt sich zwar auch auf alle Eigenheiten und Sonderbarkeiten der Individualität ein, aber er fasst sie zugleich objektiv, sie sind ihm Typen, Verkörperungen gewisser gesellschaftlicher Zustände, ganzer Stände, der Sitte und Sittlichkeit seiner Zeit überhaupt. Auch er liebt die Begebenheit, die lebhafte Handlung, die kühne und überraschende Tat, aber er verhält sich nicht naiv, nicht bloß berichtend dazu, sondern dies Alles sind ihm nur Symptome innerer aufzudeckender Zustände. Auch er überliefert Ansichten, enthält Resultate des Nachdenkens und der Beobachtung, aber sie werden nicht desultorisch und in launenhafter Unordnung mitgeteilt, sondern stützen sich auf Tatsachen und reale Grundlagen. Mit Einem Wort, nicht die bleibende Tat ist ihm das Wichtigste, noch die vergängliche Meinung, sondern das Bleibende in dem Vergänglichen oder der Charakter, die Sitte der Zeit. Allerdings gibt auch der historische Roman charakteristische Gemälde einer fernen Zeit, aber sie dienen nur der Erzählung zur Staffage, sie erklären uns nur die Begebenheit, sie sind Nichts für sich selbst; und der subjektive Roman charakterisiert zwar auch, aber vorzugsweise doch mir das eitle Subjekt des Autors. Wenn im historischen Roman der Autor uns gänzlich verschwindet, im lyrischen Roman wiederum fast allein das Feld behauptet, so tritt er uns im Sittenroman, wie im Drama, nur als allgemeines, über den auftretenden Personen schwebendes Bewusstsein der eigenen Zeit entgegen, wie z. B. im Don Quixote der Held, indem er ganz in seinem Charakter handelt, zugleich das Werkzeug einer vernichtenden Kritik der literarischen und sittlichen Zustände zur Zeit des Cervantes ist, oder wie Schillers „Jungfrau von Orleans“ zwar nicht die Gedanken des Individuums Schiller ausspricht, aber ebenso wenig im Sinne der historischen Jeanne d'Arc handelt und redet, sondern ein Produkt einer bestimmten Zeitrichtung, der Romantik, ist, welcher Schiller sich damals zuneigte. Dieser Sittenroman nun ist von den Engländern vorzugsweise und mit dem glänzendsten Erfolge angebaut worden, wozu die auf das Praktische gerichtete, selbstbewusste Natur des Volkes, so wie der durch scharf ausgeprägte staatliche Zustände und den großartigsten Weltverkehr geschärfte Blick desselben das Ihrige beigetragen haben, während wir Deutschen, bisher zu sehr auf die Welt des Inneren angewiesen, mit unserm blöden Auge kaum über die Studierstube oder höchstens den Salon hinaus zu schweifen wagten und noch nicht begriffen haben, welche Schätze der Poesie da draußen in dem bunten Leben des Volkes, welches uns auf allen Straßen umgibt, zu heben seien. Dieser Zweig der Romanliteratur konnte freilich in der faulen Ruhe des achtzehnten Jahrhunderts, in welches die Blüte unserer Literatur fällt, nicht gedeihen, obwohl wir in dem alten Simplicissimus schon einen vortrefflichen Ansatz dazu besaßen. Indessen ist auch der englische Sittenroman nur das Resultat einer allmählichen Entwicklung gewesen und in den ersten Versuchen finden wir ihn noch unausgebildet, teils mit subjektiven Zutaten des Autors versetzt, teils beinahe in das stoffliche Interesse ausgehend. Der Erste, welcher es unternahm, die lebende Mitwelt im Romane darzustellen oder die reale Gegenwart in unverfälschter Wahrheit in einer erfundenen Erzählung wiederzuspiegeln, war Richarden, aber er hat den Sittenroman noch nicht zur Höhe freier Objektivität zu erheben vermocht, er war noch zu ängstlich um die Wirkung besorgt, er ist daher noch zu absichtlich, zu sehr subjektiv raisonnierend und moralisierend. Weil er des Stoffes nicht Herr zu werden vermochte, weil er nicht über ihm schwebte, so schien es ihm nicht genug, unbefangen zu beobachten und das Gesehene und Erlebte nur künstlerisch zu gestalten und dann frei auf den Leser wirken zu lassen, sondern er glaubte erläuternd hinzutreten zu müssen, er wollte sogleich die Quintessenz seiner Beobachtungen mitteilen, verfiel dadurch in einen falschen Idealismus und gab Abstraktionen statt lebender Menschen. So sind denn seine Tugendmuster, seine Pamelen und Clarissen und sein „fehlerfreies Ungeheuer“ Grandison von seinen Zeitgenossen zwar bewundert, von der Nachwelt aber verlacht worden, denn man fand diese Zeichnung ohne Schatten mit Recht nüchtern und leblos, und eine solche skizzenhafte Darstellung durfte weder ein allgemeines psychologisches, noch selbst ein rein historisches Interesse in Anspruch nehmen, da sie höchstens des Verfassers eigenen, in der Luft schwebenden Idealismus dokumentierte. — Im Gegensätze zu dem in Richardsons Werken vorherrschenden Subjektivismus finden wir in Smolletts Romanen wiederum das stoffliche Interesse zu überwiegend hervortreten. Hier reiht sich Abenteuer an Abenteuer, und die ewig wechselnden, ruhelos durch einander wirbelnden Begebenheiten werden gewöhnlich nur durch den schwachen Faden einer Lebensgeschichte verbunden. Es ist nicht schwer, in diesem Aventurier-Roman den Typus der spanischen Schelmenromane zu erkennen, welche durch Lesage auch nach Frankreich verpflanzt waren. Obgleich nun der atomistische Zuschnitt dieser Produktionen jeder künstlerischen Gestaltung des Ganzen notwendig in den Weg treten muss, so ist es aus der andern Seite nicht zu leugnen, dass diese lose Form für den Sittenroman sehr bequem ist, indem sie Gelegenheit gibt, in den ewig wechselnden Szenen die verschiedensten Verhältnisse und die mannigfaltigsten Charaktere vor dem Auge des Lesers vorübergehen zu lassen, die dann freilich gewöhnlich eben so plötzlich, wie sie aufgetaucht sind, wieder verschwinden und die Phantasie des Lesers nicht selten fast ohne Eindruck zurücklassen. Um das Schattenhafte und Unstäte, welches dieser Art von Darstellungen eigen ist, vollständig zu machen, lieben diese Romane noch vorzugsweise die Episode, welche oft in beträchtlicher Breite und mit großer Selbstständigkeit darin auftritt und den Zusammenhang der Erzählung gänzlich unterbricht. Smollett gibt uns indessen in seinen Romanen schon viel konkretere Lebenszustände als Richardson. Fern von Sentimentalität und falschem Idealismus ist er vielmehr überaus derb und natürlich und gibt die Verhältnisse wieder, wie sie nach seiner Meinung waren, wobei er freilich eine gewisse politische Färbung und einen Trieb seiner praktischen Natur, durch Schilderung des Schlechten und Mangelhaften auf Abstellung desselben hinzuwirken, nicht unterdrücken kann. In seinem ersten Werke, dem Roderick Random, tritt daher z. B. unter den wechselnden Abenteuern des Helden sein Dienst in der Marine und sein müßiges Leben in London, wo er den Stutzer und Glücksjäger spielt, besonders hervor, weil diese Situationen nur geschildert zu werden brauchten, um zur Satire zu werden, ohne dass der Verfasser nötig gehabt hätte, direkt moralisierend einzugreifen. Besonders die Schilderung der Missbräuche in dem Marinedienst, die Smollett aus eigener Erfahrung während seines Dienstes als Schiffsarzt kennen gelernt hatte, und die uns jetzt fast unglaublich klingen, wenn wir bald barbarische Halbmenschen, bald lächerlich verzärtelte, des Dienstes völlig unkundige Weichlinge als Seehelden auftreten und überall die Protektion und Bestechlichkeit am Ruder sehen, trägt im Ganzen dennoch den Stempel der inneren Wahrheit an sich und bleibt von psychologischem wie historischem Interesse, obgleich auch hier die politische Parteiansicht etwas ins Schwarze gemalt haben mag. So fehlt es Smolletts Romanen nicht an einzelnen scharfen Charakteristiken, aber der Stoff ist roh zusammengehäuft, es fehlt die verbindende Einheit, und das Ganze fällt aus einander.
Der eigentliche Schöpfer des englischen Sittenromans ist Fielding. Sein Tom Jones ist vortrefflich komponiert und bildet ein geschlossenes Ganzes, und die Sittenschilderung darin ist nach aller Zeitgenossen Zeugnis so wahr und treffend, dass sich noch jetzt Historiker, wie Mac Aulay, darauf berufen dürfen. Fielding selbst gibt die Naturwahrheit als das Ziel seines Strebens an, hat aber auch zugleich für Mannigfaltigkeit und Abwechslung, also nicht bloß für die Belehrung, sondern auch für die Unterhaltung seiner Leser gesorgt, indem er geschickt die verschiedensten Charaktere in die Handlung zu verflechten und sie in die verschiedensten Situationen zu bringen gewusst hat, ohne der Einheit des Ganzen wesentlichen Eintrag zu tun. Bei ihm sehen wir denn auch zuerst die eigentliche Bedeutung des Sittenromans hervortreten, dass er nämlich wesentlich national ist, dass er danach strebt, das ganze volle Leben der Nation, der er angehört, wiederzugeben. In unfern sogenannten klassischen Romanen, im Wilhelm Meister z. B., gibt es gar keine Nation; die Handlung verläuft sich in den Salons zwischen einigen adligen Kunstmäzenen und den von ihnen protegierten Künstlern. Die Straße ist für den Dichter nicht vorhanden; was sich dort regt und bewegt, ist höchstens Staffage und wird vornehm aus der Vogelperspektive beobachtet, wenn etwa der eilig Reisende aus dem bequemen Reisewagen einen Blick auf das „gewerbefleißige Gebirgsstädtchen“ wirft. Wie tummelt sich dagegen das volle Leben in Fieldings Roman! Da gehen der Landedelmann, der Geistliche, der Soldat, der Schulmeister, der Höfling in buntem Zuge an uns vorüber; Wirtshausszenen wechseln mit Jagden, das Boudoir macht dem Gefängnis Platz, kurz, wir sehen ein höchst mannigfaltiges äußeres Leben in voller Anschaulichkeit sich vor uns entfalten. Der Verfasser hat ohne Zweifel auch dem inneren Leben seiner Gestalten alle Sorgfalt gewidmet, aber hier können wir uns nicht mehr so ruhig beschaulich verhalten, wir sehen mit Erstaunen, dass nicht bloß Kleid und Sitte, sondern auch die Sittlichkeit eine andere geworden ist, denn seine Begriffe von Tugend, Anstand, Zartheit u. s. w. scheinen beim ersten Anblick von dem, was wir jetzt mit diesen Ausdrücken bezeichnen, so himmelweit verschieden zu sein, dass wir oft erröten, wo er lacht, und lachen, wo er gerührt ist. Sein liebenswürdiger und gutmütiger Allworthy erscheint uns als ein pedantischer Schwachkopf, sein Tom Jones denn doch bei aller Herzensgüte und trotz seines einnehmenden chevaleresken Wesens als ein unverantwortlicher Zyniker im Punkt der Liebe, und dessen Geliebte, Sophie, will uns bei ihrer über alle Maßen gütigen Nachsicht gegen die „bloß fleischliche“ Untreue ihres Ritters durchaus nicht den beabsichtigten Eindruck zartester Jungfräulichkeit machen. Wir dürfen aber vermuten, dass hier nicht bloß die laxe Sitte des vorigen Jahrhunderts, sondern auch eine vom Verfasser verschuldete schwache Motivierung dieser Charaktere im Spiele ist, denn Sophiens Vater, der halbbarbarische Landjunker Western, dieser unermüdliche Fuchsjäger und grandiose Säufer, der gleich dem Bauer spricht und fühlt, ist zwar auch ein Portrait aus einer längst entschwundenen Zeit, zu welchem es keine Originale mehr gibt, aber so wenig wir mit dem Mann und seiner ewig beweglichen Hetzpeitsche in Berührung kommen möchten, so erweckt uns doch diese Rohheit, die durch große Gutmütigkeit gemildert wird, keinen sittlichen Ekel, ja dieser halbwilde Nimrod wird einigermaßen unser Liebling. Auch die übrigen Hauptfiguren: der heuchlerische Bösewicht Blifil, seine und Tom Jones Erzieher, der starr orthodoxe, dickköpfige Pfaffe Thwackum und der freigeisterische Tugendphilosoph Square, ferner der fast immer als Stallmeister und Courier beschäftigte Geistliche Westerns, Mrs. Honour, Sophiens ewig schwatzende, eitle und auf ihren eigenen Vorteil spekulierende Kammerzofe u. s. w., sie alle erscheinen uns jetzt als kaum noch so vorkommende Originale, aber durchaus in der sittlichen Würdigung, welche wir noch jetzt ihnen würden angedeihen lassen. Die allgemeinen Begriffe von dem, was sittlich edel und sittlich verwerflich ist, sind ja zu Homers Zeiten beinahe dieselben gewesen, wie heut zu Tage, wie sollten sie sich denn in dem kurzen Zeitraum eines Jahrhunderts so wesentlich geändert haben! Der Grund, weshalb Fieldings Menschen uns dennoch häufig so fremd und altfränkisch erscheinen, scheint uns darin zu liegen, dass Fielding nur ein Abschreiber der Natur, aber kein Dichter war. Er beobachtet die Handlungen der Menschen genau und kopiert vortrefflich, weiß uns auch in der einzelnen Figur, so individuell sie auftritt, eine gewisse Gattung zu seiner Zeit lebender Menschen anschaulich zu machen, aber das tiefere Seelenleben, die inneren, feineren Regungen des menschlichen Herzens überhaupt bleiben ihm verschlossen. Er sieht einen aus Kraftfülle sündigenden, sonst vortrefflichen jungen Mann, eine weiche, zarte, stets zum Vergeben geneigte Mädchenseele, denn beide Charaktere hat es zu allen Zeiten gegeben; — gut! er bringt sie zusammen, lässt recht derb und recht oft sündigen und recht oft vergeben und glaubt seine Aufgabe gelöst zu haben, aber eigentlich hat er seine beiden Hauptcharaktere nicht verstanden, denn es fehlt ihm die wahre Vermittlung, die dichterische Intuition.
Unter den vielen Nachahmungen, die Fieldings Roman, gleich jeder bedeutenden Erscheinung, hervorrief, wollen wir nur Goldsmiths „Landprediger von Wakefield“ erwähnen, weil wir in diesem Buche einen Fortschritt des Sittenromans erkennen. Goldsmith ist mehr Dichter als Fielding, er mildert das Herbe des Welttreibens, ohne es zu verwischen, und über seiner lieblichen Idylle schwebt ein höherer, versöhnender Geist, der die kleine Erzählung zu einer beinahe erbaulichen Theodicee umgestaltet. Aber gerade dies erbauliche Element tritt auch mit zu anspruchsvoller Bewusstheit hervor, und eine gewisse Pastorale Salbung, die zwar zum Teil durch den Hauptcharakter entschuldigt wird, sich aber doch ungebührlich breit macht und selbst bis zur Mitteilung einer vollständigen Predigt steigert, drückt dem Ganzen den Charakter einer didaktischen Absichtlichkeit auf, welche dem allgemeinen poetischen Eindruck nicht selten Abbruch tut.
Zur wahren Höhe der Poesie ist der englische Sittenroman erst in der neuern Zeit durch Boz erhoben worden, dem wir dann endlich noch die neueste bedeutende Erscheinung auf diesem Gebiete, Thackerays „Vanity Fair“ (Markt der Eitelkeit) zur Seite stellen wollen. Wir finden zunächst in Boz’ Romanen eine Fülle der Anschauung, einen Reichtum des äußern Lebens, dass er selbst hierin, in diesem praktischen Blick, diesem den Engländern überhaupt eigenen Beobachtungstalent seine Vorgänger sämtlich übertrifft. Man kann ohne Übertreibung behaupten, dass in diesen Romanen, ja in dem Pickwick allein, die Eigentümlichkeit des englischen Volks mit einer Lebendigkeit zur Anschauung gebracht wird, die dem Leser fast die Autopsie zu ersetzen vermag. Welche Fülle des Lebens breitet sich ungezwungen vor uns aus, während wir Herrn Pickwick auf seinen Kreuz- und Querzügen begleiten, die er zur Bereicherung seiner Welt- und Menschenkenntnis unternimmt! Bald drängen wir uns durch die Straßen von London, bald sitzen wir behaglich oder unbehaglich im Postwagen und machen zweideutige Bekanntschaften; dann wieder befinden wir uns in dem Getümmel der Gasthöfe oder in der freundlichen Stille eines englischen Landsitzes, wo es ein englisches Weihnachtsfest zu feiern oder eine Jagd oder eine Hochzeit mitzumachen gibt; oder wir tun auch einen Blick in das politische und religiöse Leben des Volks, wohnen einer Parlamentswahl oder einer Gerichtssitzung bei, durchwandern das Elend des Fleetgefängnisses oder besehen uns das Treiben eines pietistischen Konventikels. Und je mehr wir uns in Boz’ Romane vertiefen, desto mehr Seiten des englischen Volkslebens treten uns mit unvergleichlicher Plastik entgegen, desto unerschöpflicher erscheint uns dieser Stoff, wenn auch keiner der späteren Romane den Pickwick an Frische erreicht. Aber Boz ist selbst in den Schilderungen des Toten und Unbeweglichen ein Meister, er weiß auch diese zu kunstreichen Gemälden zu gruppieren und oft mit einer ihm ganz eigentümlichen Phantastik zu beleben. Die Meubles und Gerüche der Zimmer gewinnen unter seinen Händen Charakter und Individualität: ein großer morscher Lehnstuhl wird ein alter gichtbrüchiger Herr mit Tuchpantalons und Pantoffeln; ein Kronleuchter in einem unbewohnten Zimmer, den eine Decke umhüllt, erscheint ihm wie eine ungeheure Träne; einige alte, ausgediente Kutschen genügen, ihm ihre ehemaligen Bewohner mit Perücke und Galanteriedegen oder mit stattlichem Reifrock herbeizuzaubern und veranlassen ihn, eine Entführungsgeschichte aus der guten alten Zeit der Galanterie auszuspinnen. Wie köstlich versteht er es, dumpfe, alte Kirchen mit den gespenstischen verlassenen Kirchstühlen und den vermoderten Grabmälern zu schildern, so dass man die feuchte, ungesunde Luft zu atmen glaubt! Und wie friert uns, wenn er uns an die strotzenden und doch so unbehaglichen Tafeln herzloser Geldmenschen führt oder im Chuzzlewit in die Küche des Speisehauses für Herren vom Handelsstande blicken lässt, wo der Dienstbursche bei der Tranlampe mit erstarrten Händen die Stiefeln putzt! Wir erstaunen, wenn er uns in „Dombey und Sohn“ eine Erdrevolution schildert, aufgehäuften Schutt, durch einander geworfene Geräte, rauchende Brandstätten an einer Stelle, wo früher Straßen standen, aber es hat Nichts auf sich, es wird nur eine Eisenbahn gebaut. Wie weiß er überhaupt die Gewerbetätigkeit fast unseren Sinnen wahrnehmbar zu machen! Wir fühlen die Glut der Hochöfen, sehen das Treiben der trägen Ruderknechte auf den langsam dahin gleitenden Flussfahrzeugen vor uns und riechen den Wasserduft, wenn wir das Schifferviertel von London betreten, wo sich an jedem Fenster Waren zum Schiffsgebrauch oder Kapitäne in Hemdsärmeln zeigen.
Aber diese so lebendig geschilderte Außenwelt ist doch immer nur Nebensache, immer nur der Schauplatz, auf welchem Boz sich seine Menschen, die echten Kinder seiner Phantasie und seines Herzens, bewegen lässt. Die Seelenmalerei ist sein eigentliches Handwerk, jede Regung des Menschenherzens zu beobachten, seine erste und wichtigste Aufgabe. Und hier geht es uns seltsam: seine Gestalten erscheinen uns fast immer originell, ja oft bizarr und dennoch so bekannt und vertraut, als wären wir diesen oder ganz ähnlichen Menschen schon häufig auf unserm Lebenswege begegnet. Und so ist es auch, denn es sind Menschen von der entwickeltsten Individualität, so und so gebildete Engländer des neunzehnten Jahrhunderts, aus dem oder dem Stande, von den und den Lebensschicksalen, aber es sind immer zugleich wahrhafte Menschen, mit wahrhaft menschlichen Gefühlen und Seelenkämpfen, und dies allgemein Menschliche macht sie uns vertraut, macht sie zu Typen, so dass sie nie, wie Fieldings Gestalten, uns fremd werden und veralten können. Hier sehen wir den Unterschied des Dichters von dem bloßen Charakteristiker. Der Letztere erfasst nur die für die jedesmalige Zeit und die jedesmaligen Umstände charakteristischen Besonderheiten der Individuen, aber er weiß sie nicht zu einer lebendigen Einheit zu verbinden, er lebt und fühlt nicht mit seinen Menschen. Das tiefere, sich ewig gleich bleibende Seelenleben der Menschheit entweicht unter seiner sezierenden Hand und er vergisst, dass die Menschen in ihren Trieben, im Glück und Unglück, in Liebe und Hass, in Freundschaft und Feindschaft immer, auch unter den verschiedensten Formen, dieselben geblieben sind. Aber Boz hat die Menschheit nicht nur mit dem Auge des Dichters beobachtet, er liebt sie auch mit der ganzen Fülle eines warmen Herzens, eines kindlichen, unverbitterten Gemütes. Daher gelingt ihm Nichts vortrefflicher, als die Schilderung wirklicher Kinder oder solcher Erwachsener, welche sich die kindliche Unschuld und Einfalt unberührt von den Stürmen der Welt bewahrt haben. In dreien seiner Romane sind Kinder die Hauptfiguren, die eigentlichen Helden der Erzählung, alle drei sehr gute, sehr innerliche und sehr unglückliche Kinder, aber dennoch alle drei wie himmelweit verschieden! Der arme Waisenknabe Oliver Twist ist das schüchterne, sanfte, immer geduldige Kind des Elends, bleich und verkommen, früh niedergetreten und daher ängstlich und blöde, aber desto dankbarer für den geringsten Beweis von Liebe, die ihm von der Geburt an gefehlt hat, und nach der seine Seele doch dürstet. Ein weibliches Gegenstück zu ihm ist die unvergleichliche kleine Nell in dem „Raritätenladen“, diese lieblichste aller Bozischen Gestalten, die ihren von dämonischer Spielwut zerrütteten, geistesschwachen Großvater, gleich einem Schutzengel, geleitet und behütet. Dies kleine, engelreine, lebensheitere Kind, welches, in eine ihm fremde Welt des Lasters und der Gefahren versetzt, an einer über seine Jahre und Kräfte hinausgehenden Aufgabe scheitert und endlich am gebrochenen Herzen stirbt, erinnert unwillkürlich an Eugen Sues ähnliche Gestalt, die Fleur de Marie in den „Mysterien von Paris“, aber welch ein Unterschied! Wie hat der Franzose hier alles vergröbert und die ganze Erscheinung dadurch, dass er sie in dem Kloak des Lasters um- und umkehrt, teils unserer Teilnahme beraubt, teils als solche innerlich unmöglich gemacht! — Das dritte jener Bozischen Kinder, der kleine Paul Dombey, ist der Erbe ungeheuren Reichtums, die Hoffnung eines alten Hauses, aber noch unglücklicher als die beiden erwähnten Kinder, denn er trägt von der Geburt an den Keim eines frühen Todes in sich, hat keine Freude an kindlichen Spielen, wird immer altkluger und ernster und siecht vor der Zeit dahin. Aber einen Zug hat er mit jenen andern Kindern gemein, ein liebebedürftiges Herz, eine unendliche Innigkeit und Wärme der Empfindung, die bei diesem trotz seines Reichtums verlassenen, von der Krankheit zu einem jugendlichen Sonderling verbildeten, stillen und träumerischen Knaben desto rührender hervortritt. Diese liebewarmen, vor der Zeit dahinwelkenden Kinderherzen sind die schönsten und reinsten Triumphe der Bozischen Kunst; diese Figuren sind naturwahr, individuell, Kinder ihrer Zeit und ihrer Verhältnisse, aber dennoch ewig, denn sie sind von der Poesie vergeistigt, sie werden verstanden werden, so lange es Menschen gibt, welche ihre Kinder lieben, und welche es schmerzt, wenn sie die Blüte verwelken sehen, ehe sie zur Frucht gereift ist. — An diese Kindergestalten des Dichters schließen sich seine erwachsenen Kinder an, diese Menschen mit dem ewig heitern, liebewarmen Kinderherzen, welche arglos mit den Blumen auf ihrem Lebenswege spielen und die Schlangen darunter nicht fürchten, weil sie sie nicht kennen. Der Prototypus dieser Bozischen Figuren ist sein berühmter Herr Pickwick, dieser unsterbliche alte Herr mit Brille und Gamaschen, der von seinem Comtoirtisch in das bunte Leben einer ihm bisher fremden Welt eintritt, um die Menschen zu beobachten, und in dem glücklichen Wahne, eine besonders praktische Natur zu sein, sich und Andre fortwährend in die ergötzlichsten Verlegenheiten verwickelt. Ein solcher Mensch könnte sehr lästig werden, aber über Herrn Pickwick können wir höchstens lachen, müssen ihn aber dabei von Herzen lieben, denn er ist unschuldig, wie ein Kind, von der liebenswürdigsten Gutmütigkeit und der unverwüstlichsten heitern Laune, und macht schließlich Alle glücklich, mit denen er in Berührung kommt. An ihn schließt sich eine lange Reihe ähnlicher Bozischer Charaktere, lauter „Seelen von Menschen“, wie man zu sagen pflegt: die beiden Brüder Wohlgemuth im „Nicholas Nickleby“, auch zwei alte Herren, voll von Liebe und Güte, die sich gegenseitig und ihren alten Buchhalter und alle Welt mit Freundlichkeiten überschütten; dann Tom Pinch im „Chuzzlewit“, ein Kindergemüt mit einem Taubenherzen, unfähig zum Zorn; der sanfte Schulmeister im „Raritätenladen“, welcher nur mit Kindern Umgang sucht und die arme Neil bis zu ihrem Tode pflegt und hegt; der Kapitän Cuttle im „Dombey“, ein alter rauer Seemann, aber von dem weichsten Herzen, immer beschäftigt mit Plänen und immer bereit zu Opfern für das Glück seines Pflegesohns Walter; endlich der alte Peggotty im „Copperfield“, auch ein Eichenherz in der Seemannsjacke, aber von noch feinerem und edlerem Gefühl, sich hingebend für das, was er liebt, ohne ein Wort zu verlieren oder nur den Gedanken aufkommen zu lassen, als könnte es anders sein. Wiederum dieser Reihe verwandt ist eine andere unter den Bozischen Romangestalten: gleichfalls erzgutmütige, seelengute Menschen, aber über die Kinderunschuld lange hinweg, vielmehr haben diese recht tüchtig in den Apfel der Erkenntnis gebissen und sich umgesehen in der Welt und kennen das Laster und alle Schliche und Schlupfwinkel desselben auf das genaueste, ja sie haben wohl gar von diesem gefährlichen Studium der Welt einen oft nicht ganz unbedeutenden Beigeschmack eigener lasterhafter Neigung davon getragen, aber ihr innerer Kern ist unangefressen geblieben, sie sind doch immer ehrliche Kerle und die entschiedensten Feinde aller prämeditierten Schlechtigkeit. An der Spitze dieser Reihe steht Herr Sam. Weller, Herrn Pickwicks vortrefflicher Bedienter und der passendste Sancho dieses modernen Don Quixote, der in seinem derben Realismus den ergötzlichsten Gegensatz zu seines Herren weltverschönerndem und verkennendem Idealismus bildet. Er ist durch und durch praktisch, so zu sagen, mit allen Hunden gehetzt; weit entfernt, sich irgend einer Illusion hinzugeben oder sich durch irgend Jemand imponieren zu lassen, verlässt er sich, ein echter Sohn John Bulls, in allen Lebenslagen auf seinen gesunden Witz und seine tüchtigen Fäuste. Aber er hat auch seine weiche Stelle, die ihn eben den oben erwähnten Charakteren anreiht und ihn selbst unserm Herzen teuer macht: das ist seine unerschütterliche Anhänglichkeit an seinen Herrn, dessen der Welt gegenüber wehrlose Herzensgüte er ganz erkennt, und den er daher stets mit der aufopferndsten Liebe zu schützen und nötigenfalls auch etwas zu bevormunden bereit ist. Ähnliche durch die harte Schule des Lebens gewitzigte, zum Teil auch verbogene, aber doch innerlich gesunde Charaktere sind: der schweigsame Schreiber des Wucherers Ralph Nickleby, ein heruntergekommener Gentleman, äußerlich sehr gesunken und in düstern Momenten selbst dem Trünke ergeben, aber innerlich noch warm erglühend für alles Edle und Gute; ferner der lustige Swiveller im „Raritätenladen“, welcher ziemlich verliederlicht ist, aber bei allem Leichtsinn, aller seiner Eitelkeit und Nichtsnutzigkeit sich doch seine unverwüstliche Gutmütigkeit erhalten hat, die uns ihm immer wieder geneigt macht; dann der humoristische Mark Tapley im „Chuzzlewit“, dessen sonst unzerstörbare gute Laune nur durch die Betrachtung getrübt wird, dass sie eigentlich kein Verdienst sei, da es ihm, selbst in Situationen, welche andere Leute unglückliche zu nennen pflegen, ganz behaglich zu Mute ist; endlich der schwungvolle Micawber im „Copperfield“, welcher trotz seiner zahlreichen Familie und noch zahlreicheren pekuniären Verlegenheiten nie den Anstand aufgibt oder den Mut verliert, sondern stets der Hoffnung lebt, dass er endlich dennoch „einen seinen Talenten angemessenen Wirkungskreis“ finden werde. Alle diese bisher erwähnten Charaktere werden sich, mit den durch die Zeit bedingten Nuancen, zu allen Zeiten finden, aber dass sie in den Bozischen Romanen so auffallend in den Vordergrund treten, legt teils ein gutes Zeugnis ab für die englische Nation des neunzehnten Jahrhunderts, welche die Originale zu so erfreulichen Bildern lieferte und die Bilder selbst so zu würdigen wusste, teils erlaubt es einen ehrenvollen Rückschluss auf den Charakter des Autors, der diese Gestalten schuf. In der Tat erscheint uns Boz überall als ein weiches Gemüt, welches ein ganz besonderes Verständnis für die Freuden guter Menschen besitzt, daher er auch auf Feste, namentlich auf das behagliche englische Weihnachtsfest mit seinen nicht zu verschmähenden materiellen Genüssen, dem Puterbraten, dem Pudding u. s. w. wiederholt in seinen Romanen zurückkommt und gern bei ihnen verweilt. Aber eben weil er den Guten sein ganzes Herz zuwendet und ihnen alles mögliche Gute gönnt, so begegnet es ihm nicht selten, dass er sich in seine eigenen Gestalten verliebt, dass er sie selbst mit Wohlwollen überhäuft, mit ihnen tändelt und liebäugelt und des Lesers ganz vergisst. Dadurch wird er breit und wiederholt sich, er ist wie ein Kind, welches ohne zu ermüden mit seiner Puppe immer wieder und wieder dasselbe Spiel treibt. Daneben ist er aber auch ein Schalk; allen diesen Gestalten, so sehr er sie auch liebt, hat er doch ihr lächerliches Haarbeutelchen angeheftet, und er freut sich wiederum wie ein Kind, wenn er sie in Situationen geraten lässt, wo es ihnen recht lustig um den Kopf fliegt. Seine Kunst, so wie die Kunst jedes Humoristen, besteht eben darin, dies lächerliche und ernst sittliche Moment in den Menschen und oft in den Situationen so unauflöslich zu verknüpfen, dass man über dieselben lachen muss und sich doch häufig zu gleicher Zeit innerlich erweicht fühlt; es ist dies das berühmte, wohl nur dem Nordländer verständliche „Lächeln unter Tränen“, man lacht diese Menschen aus und möchte ihnen doch zugleich um den Hals fallen und ihnen einen recht herzlichen und innigen Kuss geben, denn man muss sie lieben, wie seltsam, ja wie unschön sie auch oft erscheinen mögen. — Diese vorherrschende Weichheit in Boz’ Charakteristik, diese Vertiefung in die edle und sittliche Seite der menschlichen Natur macht es erklärlich, dass ihm die Bösewichter nicht recht gelingen wollen. Er bedarf gleichsam eines Anlaufes zu ihrer Schilderung, er muss sich gewissermaßen dazu zwingen, sich in diesen Abgrund des Menschenherzens zu versenken und deshalb fürchtet er, auch Andern nicht verständlich zu werden und verschwendet seine Farben; er will recht deutlich sein, recht scharf charakterisieren und wird überladen, wird Karikatur-Maler, wird oft unwahr. Man gehe nur die Reihe seiner allerdings oft originellen, oft tief angelegten Bösewichter durch, man wird fast immer Schatten ohne Licht, ganz verwilderte, verkommene, fast vertierte, kurz solche Charaktere finden, die beinahe nichts Menschliches mehr an sich haben und sich daher selten oder nie in der wirklichen Welt nachweisen lassen. Da erscheinen sogleich im „Nickleby“ neben dem noch gemäßigten, harten Wucherer Ralph Nickleby seine unmenschlichen Spießgesellen, der teuflische Pensionshalter Squeers, welcher die Kinder in seiner Schule methodisch misshandelt, dumm prügelt, beraubt, aushungert und ihnen allwöchentlich eine Mischung von Schwefel und Sirup eingeben lässt, um ihnen den Appetit zu nehmen und sie so wohlfeiler erhalten zu können, und der schäbige, zur Mumie eingetrocknete Geizhals Arthur Gride; dann im „Raritätenladen“ der aus Prinzip boshafte Quilp, ein koboldartiger Zwerg mit einem ungeheuren Kopf, der gern auf hohe Tische oder die Lehnen der Stühle klettert und dort mit gekreuzten Beinen sitzt, unmäßig Tabak raucht, viele Gläser kochenden Branntweins verschlingen kann und gewöhnlich in einem Schuppen auf seinem Holzhofe residiert, wo er einsam sein Wesen treibt, obgleich er verheiratet ist und eine ordentliche menschliche Wohnung besitzt. Wir übergehen die verschiedenen Räuber und Spitzbuben im „Oliver Twist“, und erinnern nur noch an den unmenschlichen Geizhals und wüsten Mörder Jonas Chuzzlewit im „Chuzzlewit“, an den eleganten, aber nicht minder dunkel gefärbten Carker im „Dombey“, dessen tigerartige weiße Zähne und schneeweiße Wäsche in einem fast grauenhaften Kontrast zu seinem lichtlosen Innern stehen, endlich an den schlangenartigen Heuchler Uriah Heep im „Copperfield“ mit seinem glatten, schaumartigen Gesicht und den dürren, im Sitzen hoch hinaufgezogenen Knien: sie alle sind ohne alle Beimischung des Guten oder auch nur eine unschuldige Liebhaberei, wodurch sie sich uns als wirkliche Menschen auswiesen, vollendete Bösewichter oder vielmehr das vollendete Böse selbst, mit allen seinen Konsequenzen, denn gewöhnlich sind sie böse, nicht aus menschlicher Leidenschaft oder sonstigen selbstsüchtigen Motiven, aus Genusssucht, Ehrgeiz u. s. w., sondern aus reiner, dämonischer Lust am Bösen. Boz vermenschlicht diese teuflischen Geschöpfe erst wieder, wenn er sie dem Untergange entgegenführt; dann, wenn das Gericht herannaht, wenn die Regungen des so lange unterdrückten, des scheinbar gänzlich verhärteten Gewissens in ihnen erwachen, wendet er ihnen sein Mitleid, sein menschliches Interesse zu und zeigt wieder seine ganze Meisterschaft in der Seelenmalerei. Besonders weiß er uns jene traumartigen Zustände anschaulich zu machen, in welche die verdüsterte, kranke Seele versinkt, wenn sie vergeblich gegen die überlegene Macht der nur scheinbar erstickten sittlichen Naturanlage ringt. Diese unbeschreibliche Angst, dies sich Anklammern an irgend einen beliebigen sinnlichen Gegenstand, um nur loszukommen von dem quälenden Gewoge der Gedanken, diese wüste Verwirrung und Unruhe des Innen, weiß Keiner besser zu schildern als Boz, und Szenen, wie die, wo Jonas Chuzzlewit mit dem zerrüttenden Bewusstsein des vollbrachten Mordes von seinem Fenster aus seine harmlosen Nachbarn beobachtet und aus ihren Bewegungen mit immer steigender Unruhe die Gewissheit zu gewinnen glaubt, dass sie von ihm und seiner Tat sprechen, oder jene andere, wie Carker im „Dombey“ mit gescheiterten Hoffnungen in rasender Eile aus Frankreich in die Heimat zurückkehrt und sich in seinen wüsten Träumen Wirkliches und Gedachtes, Gegenwart und Vergangenheit wild vermischen, gehören zu den grauenhaftesten, aber naturwahrsten Gemälden des Bozischen Pinsels. — So sehen wir, dass in der Charakteristik überall der Schwerpunkt der Bozischen Romane liegt, daher die Komposition in denselben zur Nebensache wird und höchst einfach, ja beinahe vernachlässigt erscheint. Die älteren, wie Pickwick und Nickelby, sind in der losen Form den Aventürier-Romanen der älteren Zeit sehr ähnlich. Oliver Twist ist eine jener ziemlich gewöhnlich angelegten Kriminalgeschichten, wie sie das englische Publikum liebt, welches, durch seine Zeitungen an kriminalistische Artikel so wie an Berichte aus den höheren Gesellschaftskreisen gewöhnt, in seinen Sittenromanen daher auch Schilderungen des Verbrechertreibens und des high life allen andern vorzieht. Die späteren Bozischen Romane sind etwas komplizierter, doch gruppieren sich auch hier die Begebenheiten und Gestalten leicht um die Lebensschicksale einer gewöhnlich jugendlichen Hauptperson. Nur im „Barnaby Rudge“, mit welchem Boz einen Versuch im historischen Roman gemacht hat, ist dem gemäß der Plan mit größerer Sorgfalt angelegt und auf Spannung und Überraschung des Lesers berechnet.
Wir übergehen die zahlreichen, weniger bedeutenden Nebenbuhler und Nachahmer der Bozischen Charakteristiken und werfen zum Schluss noch einen flüchtigen Blick auf die neueste Entwickelung des englischen Sittenromans. Thackerays „Markt der Eitelkeit“ ist ohne Zweifel das namhafteste Erzeugnis dieser neuesten Zeit, und der düstere Ernst dieses jüngsten Sittenmalers bildet ebensowohl einen starken Kontrast wie eine notwendige Ergänzung zu Boz’ lebensheiteren Gemälden. Beide zusammen geben erst das vollständige Bild des scharf ausgeprägten Charakters einer Nationalität, die, wie keine, eine Einheit schroffer Gegensätze in sich schließt. Wenn Boz die innerliche Wärme, ja Weichheit des britischen Seelenlebens, die heitere Gemütlichkeit und Heimlichkeit des englischen Herdes repräsentiert, so vergegenwärtigt uns Thackeray das kalte, beobachtende Wesen des Engländers, wenn er in die Außenwelt hinaustritt, seinen bitteren Sarkasmus über alles Fremde, seine düstere, weltverachtende Lebensansicht, die er in seiner stolzen Abgeschlossenheit gern nach außen zur Schau trägt. Thackerays Schilderungen aus dem Leben der Mittelklassen (denn auf diese, besonders die Sphäre des Kaufmanns- und Soldatenstandes, beschränkt sich sein Gesichtskreis) übertreffen noch die Boziscken an Objektivität und Naturwahrheit, denn ihn beim weder Liebe noch Hass, er malt mit eisernem Pinsel Nichts als die Wahrheit, d. h. die menschliche Schwäche, wie sie wirklich ist, er schmeichelt nicht, er schont nicht, er ist unerbittlich, wie der Spiegel. Er ist daher häufig prosaisch, wie Fielding, aber das über seinem ganzen Werke schwebende Bewusstsein der Nichtigkeit alles menschlichen Treibens macht ihn bisweilen erhaben, er wird dann poetisch, ein Marius auf den Trümmern von Karthago, ein Jeremias auf den Ruinen von Jerusalem. Aber die Kunst der höheren poetischen Versöhnung, die innere Harmonie, welche alle Dissonanzen des Welttreibens aufzulösen versteht und uns mit nur gesteigertem Glauben an die Menschheit aus dem Schauspiele entlässt, welches uns den ewigen Kampf des Guten mit dem Bösen von neuem vor Augen führte, die Gewissheit des Sieges, welcher allem Guten und Edlen in großen wie kleinen Verhältnissen seinem Wesen nach, wenigstens innerlich, werden muss, dies Alles, was Boz die wahre Dichterweihe gibt, ist in dem trostlosen Bilde, welches Thackeray von dem ruhelosen, nie das Ziel erreichenden Ringelrennen der Menschheit nach Glück entwirft, nicht zu finden. Und so hat uns der Rundgang durch das reiche Gebiet des englischen Sittenromans mit Thackeray wieder auf die praktische, der Satire sich annähernde Richtung zurückgeführt, von der er ausgegangen, denn sie wurzelt in dem englischen Wesen und wird sich daher über immer weitere Lebenskreise verbreiten, wie denn aus ihr z. B. auch Warrens feine Beobachtungen von dem Standpunkt gewisser Stände aus und d'Israelis soziale Tendenzromane hervorgegangen sind.
Man unterscheidet bekanntlich drei Hauptgattungen der Poesie-Epos, Lyrik und Drama. Ohne auf die hinlänglich erörterten Merkmale dieser Unterscheidung hier weiter einzugehen, wollen wir nur daran erinnern, dass sich vorzugsweise im Drama, und zwar sowohl in der Tragödie als Komödie, in dem bewegten Verlaufe einer Handlung, die sich durch lebendige Menschen als unmittelbarste Gegenwart vor den Augen des Zuschauers abspinnt, die ganze Weltanschauung gerade des Zeitalters, dem das Dichterwerk angehört, vergegenwärtigt, während das objektivere Epos mit beschaulicher Ruhe sich in eine ferne Vergangenheit und deren Anschauungsweise versenkt, und die ganz subjektive Lyrik jedem, selbst dem grillenhaftesten und abnormsten, über die allgemeine Denkweise kühn hinausfliegenden Gefühle einen Ausdruck ermöglicht. Epos und Lyrik finden mithin in dem Drama, welches die subjektive Anschauungsweise einer bestimmten Zeit objektiv aussaßt oder verallgemeinert, ihren wahren Einigungs- und Mittelpunkt. Aus dem Gesagten ergibt sich nun leicht, dass man mit Unrecht den Roman als solchen das Epos der modernen Zeit genannt hat. Vielmehr dürfte man aus der Entwicklung, welche die englische Romanliteratur, als die reichste von allen, genommen hat, mit einigem Scheine zu folgern wagen, dass in dem Romane alle erwähnten Gattungen der Poesie ihre gemeinsame Vertretung finden.
Das wahre Epos der Romanliteratur ist der historische Roman, in England durch Walter Scott zu einer Vollendung erhoben, welche kein anderes europäisches Volk (mit Ausnahme vielleicht der Italiener, die in Manzonis Verlobten wenigstens Ein musterhaftes Werk dieser Art aufzuweisen haben) erreicht hat. In diesen Walter Scottschen Romanen finden wir die ganze Plastik des Epos in der Detailbeschreibung des Äußeren, der Waffen, Kleider u. s. w., die epische Ruhe und behagliche Breite und vor allen Dingen die epische Objektivität, die uns den Autor ganz vergessen lässt und uns selbst so zauberisch umspinnt, dass wir uns ohne Zwang in den wilden schottischen Hochlanden unter den kühnen Freibeutern ebenso zu Hause finden, wie am Hofe der Königin Elisabeth oder des tyrannischen Ludwigs XI. von Frankreich. Diese Manier, eine vergangene Zeit der Phantasie zu vergegenwärtigen, war so unterhaltend und bot so viel Abwechslung dar, dass der historische Roman bald die Lieblingslektüre des ganzen europäischen Publikums wurde. Aber Scott ist nur von Cooper einigermaßen erreicht worden, während z. B. in Bulwers historischen Romanen, wie in den meisten deutschen, der gelehrte Schweiß des Autors, mit dem er jede Seite seines Werkes bezeichnet, uns alle Illusion verdirbt, und wir uns aus der Halle der alten Sachsenkönige oder den Gassen von Pompeji immer wieder in die enge, mit Büchern erfüllte Studierstube des Verfassers versetzt sehen. Indessen dürfen wir den historischen Roman, insofern er das Epos der Romanliteratur repräsentieren soll, keineswegs auf einen zu engen Kreis beschränken. Ihm fallen nicht etwa bloß die Romane zu, die ihren Stoff aus der Weltgeschichte entlehnt haben, sondern alle diejenigen überhaupt, bei denen die Erzählung, die Begebenheit, das stoffliche Interesse die Hauptsache ist, und wir werden dieser Klasse nicht nur Miss Radcliffes Schauer erregende Geheimnisse Udolphos, die Robinsonaden und unsere zahlreichen Ritter- und Räuberromane, sondern auch Produktionen, wie Gellerts Leben der schwedischen Gräfin beizählen müssen. Die Form ist auch hier, wie in allen Zweigen der Romanliteratur, eine völlig freie und nur durch den Fortgang der Erzählung gebunden, und wir Deutschen besitzen historische Romane von Feßler und Meißner, welche dialogisiert, und andere (z. B. von der Pichler), welche in Briefform abgefasst sind.
Die Lyrik des Romans hat ihren vollständigsten Ausdruck in dem humoristischen Roman der Engländer gefunden, als dessen Hauptrepräsentant bekanntlich Sterne anzusehen ist. Hier befinden wir uns auf dem Boden der ungebundensten Subjektivität: die Erzählung ist Nebensache, der Einfall ist Alles. Die Formlosigkeit hat hier ihre höchste Höhe erreicht, und die Erzählung wird nicht nur beliebig durch Reflexionen über die fern liegendsten Dinge unterbrochen, sondern auch absichtlich (z. B. durch Versetzung der Kapitel) verwirrt und verschoben. Der Stoff ist hier fast gleichgültig, das Subjekt des Autors tritt völlig in den Vordergrund, tyrannisiert mit seinen Einfällen den Leser und trotzt in grillenhaftem Eigensinn den Überzeugungen wie den Vorurteilen seiner Zeit. Es ist diese Art des Romans wie geschaffen für die Sonderlingslaunen des Engländers und wird diesem daher immer lieb bleiben, während der systematischere Deutsche der formlosen Produktionen seiner Humoristen, seiner Hippel und großen und kleinen Jean Paule, bald überdrüssig geworden ist. Übrigens ist nur die subjektive Willkür, die Herrschaft des Autors über den Stoff das Charakteristische dieser Gattung von Romanen, nicht aber der Humor, denn der Humor, dieses „Lächeln unter Tränen“ ist eine allgemeine Weltanschauung, die an keine bestimmte Form der Poesie gebunden ist und sich daher ebensowohl im Drama oder im lyrischen Gedicht manifestieren kann. Aus diesem Grunde haben wir das Recht, dieser Klasse des Romans überhaupt alle diejenigen Romane zuzuweisen, in welchen das Gefühl, die Gesinnung, die Ansicht des Verfassers die Hauptsache, die Erzählung aber Nebensache ist. Hiermit gelangen wir denn auf das Feld, auf welchem sich von je her der deutsche Roman vorzugsweise und am liebsten bewegt hat. Denn konnte sich der Deutsche auch auf die Länge mit den tollen Sprüngen einer regellosen Subjektivität nicht befreunden, so liebte er es doch, seine Gefühle und die Resultate seines Denkens in ungestörter Redseligkeit zu exponieren, und wie hätte er dies besser vermocht, ohne sich doch persönlich bloß zu stellen, als indem er sie seinen Helden in den Mund legte? So folgen sich denn in unserer Literatur die Reflexionsromane in ununterbrochener Reihe von den sentimentalen Romanen à la Werther und den Künstlerromanen nach Wilhelm Meisters Zuschnitt an bis zu den Emanzipationsromanen des jungen Deutschlands. Diese Art von Romanen, die teilweise gänzlich der Didaktik anheimfallen, finden wir in der englischen Literatur weniger, weil es dem Engländer in seinem egoistischen Streben nach subjektiver Ungebundenheit eben gar nicht um das Belehren oder überhaupt um den Inhalt, sondern rein um die formelle Freiheit zu tun ist, an deren ungezügeltem Gebrauche sich Autor wie Leser erfreuen.
Dem Drama, insofern es vorzugsweise die Weltanschauung der Zeit, welcher es seine Entstehung verdankt, vergegenwärtigt, ist der Sittenroman zu vergleichen, welcher seinen Stoff aus den Zuständen der realen Gegenwart entnimmt, und bei dem es weder aus die Begebenheit noch aus die subjektive Ansicht, sondern auf die Charakteristik ankommt. Der Sittenroman lässt sich zwar auch auf alle Eigenheiten und Sonderbarkeiten der Individualität ein, aber er fasst sie zugleich objektiv, sie sind ihm Typen, Verkörperungen gewisser gesellschaftlicher Zustände, ganzer Stände, der Sitte und Sittlichkeit seiner Zeit überhaupt. Auch er liebt die Begebenheit, die lebhafte Handlung, die kühne und überraschende Tat, aber er verhält sich nicht naiv, nicht bloß berichtend dazu, sondern dies Alles sind ihm nur Symptome innerer aufzudeckender Zustände. Auch er überliefert Ansichten, enthält Resultate des Nachdenkens und der Beobachtung, aber sie werden nicht desultorisch und in launenhafter Unordnung mitgeteilt, sondern stützen sich auf Tatsachen und reale Grundlagen. Mit Einem Wort, nicht die bleibende Tat ist ihm das Wichtigste, noch die vergängliche Meinung, sondern das Bleibende in dem Vergänglichen oder der Charakter, die Sitte der Zeit. Allerdings gibt auch der historische Roman charakteristische Gemälde einer fernen Zeit, aber sie dienen nur der Erzählung zur Staffage, sie erklären uns nur die Begebenheit, sie sind Nichts für sich selbst; und der subjektive Roman charakterisiert zwar auch, aber vorzugsweise doch mir das eitle Subjekt des Autors. Wenn im historischen Roman der Autor uns gänzlich verschwindet, im lyrischen Roman wiederum fast allein das Feld behauptet, so tritt er uns im Sittenroman, wie im Drama, nur als allgemeines, über den auftretenden Personen schwebendes Bewusstsein der eigenen Zeit entgegen, wie z. B. im Don Quixote der Held, indem er ganz in seinem Charakter handelt, zugleich das Werkzeug einer vernichtenden Kritik der literarischen und sittlichen Zustände zur Zeit des Cervantes ist, oder wie Schillers „Jungfrau von Orleans“ zwar nicht die Gedanken des Individuums Schiller ausspricht, aber ebenso wenig im Sinne der historischen Jeanne d'Arc handelt und redet, sondern ein Produkt einer bestimmten Zeitrichtung, der Romantik, ist, welcher Schiller sich damals zuneigte. Dieser Sittenroman nun ist von den Engländern vorzugsweise und mit dem glänzendsten Erfolge angebaut worden, wozu die auf das Praktische gerichtete, selbstbewusste Natur des Volkes, so wie der durch scharf ausgeprägte staatliche Zustände und den großartigsten Weltverkehr geschärfte Blick desselben das Ihrige beigetragen haben, während wir Deutschen, bisher zu sehr auf die Welt des Inneren angewiesen, mit unserm blöden Auge kaum über die Studierstube oder höchstens den Salon hinaus zu schweifen wagten und noch nicht begriffen haben, welche Schätze der Poesie da draußen in dem bunten Leben des Volkes, welches uns auf allen Straßen umgibt, zu heben seien. Dieser Zweig der Romanliteratur konnte freilich in der faulen Ruhe des achtzehnten Jahrhunderts, in welches die Blüte unserer Literatur fällt, nicht gedeihen, obwohl wir in dem alten Simplicissimus schon einen vortrefflichen Ansatz dazu besaßen. Indessen ist auch der englische Sittenroman nur das Resultat einer allmählichen Entwicklung gewesen und in den ersten Versuchen finden wir ihn noch unausgebildet, teils mit subjektiven Zutaten des Autors versetzt, teils beinahe in das stoffliche Interesse ausgehend. Der Erste, welcher es unternahm, die lebende Mitwelt im Romane darzustellen oder die reale Gegenwart in unverfälschter Wahrheit in einer erfundenen Erzählung wiederzuspiegeln, war Richarden, aber er hat den Sittenroman noch nicht zur Höhe freier Objektivität zu erheben vermocht, er war noch zu ängstlich um die Wirkung besorgt, er ist daher noch zu absichtlich, zu sehr subjektiv raisonnierend und moralisierend. Weil er des Stoffes nicht Herr zu werden vermochte, weil er nicht über ihm schwebte, so schien es ihm nicht genug, unbefangen zu beobachten und das Gesehene und Erlebte nur künstlerisch zu gestalten und dann frei auf den Leser wirken zu lassen, sondern er glaubte erläuternd hinzutreten zu müssen, er wollte sogleich die Quintessenz seiner Beobachtungen mitteilen, verfiel dadurch in einen falschen Idealismus und gab Abstraktionen statt lebender Menschen. So sind denn seine Tugendmuster, seine Pamelen und Clarissen und sein „fehlerfreies Ungeheuer“ Grandison von seinen Zeitgenossen zwar bewundert, von der Nachwelt aber verlacht worden, denn man fand diese Zeichnung ohne Schatten mit Recht nüchtern und leblos, und eine solche skizzenhafte Darstellung durfte weder ein allgemeines psychologisches, noch selbst ein rein historisches Interesse in Anspruch nehmen, da sie höchstens des Verfassers eigenen, in der Luft schwebenden Idealismus dokumentierte. — Im Gegensätze zu dem in Richardsons Werken vorherrschenden Subjektivismus finden wir in Smolletts Romanen wiederum das stoffliche Interesse zu überwiegend hervortreten. Hier reiht sich Abenteuer an Abenteuer, und die ewig wechselnden, ruhelos durch einander wirbelnden Begebenheiten werden gewöhnlich nur durch den schwachen Faden einer Lebensgeschichte verbunden. Es ist nicht schwer, in diesem Aventurier-Roman den Typus der spanischen Schelmenromane zu erkennen, welche durch Lesage auch nach Frankreich verpflanzt waren. Obgleich nun der atomistische Zuschnitt dieser Produktionen jeder künstlerischen Gestaltung des Ganzen notwendig in den Weg treten muss, so ist es aus der andern Seite nicht zu leugnen, dass diese lose Form für den Sittenroman sehr bequem ist, indem sie Gelegenheit gibt, in den ewig wechselnden Szenen die verschiedensten Verhältnisse und die mannigfaltigsten Charaktere vor dem Auge des Lesers vorübergehen zu lassen, die dann freilich gewöhnlich eben so plötzlich, wie sie aufgetaucht sind, wieder verschwinden und die Phantasie des Lesers nicht selten fast ohne Eindruck zurücklassen. Um das Schattenhafte und Unstäte, welches dieser Art von Darstellungen eigen ist, vollständig zu machen, lieben diese Romane noch vorzugsweise die Episode, welche oft in beträchtlicher Breite und mit großer Selbstständigkeit darin auftritt und den Zusammenhang der Erzählung gänzlich unterbricht. Smollett gibt uns indessen in seinen Romanen schon viel konkretere Lebenszustände als Richardson. Fern von Sentimentalität und falschem Idealismus ist er vielmehr überaus derb und natürlich und gibt die Verhältnisse wieder, wie sie nach seiner Meinung waren, wobei er freilich eine gewisse politische Färbung und einen Trieb seiner praktischen Natur, durch Schilderung des Schlechten und Mangelhaften auf Abstellung desselben hinzuwirken, nicht unterdrücken kann. In seinem ersten Werke, dem Roderick Random, tritt daher z. B. unter den wechselnden Abenteuern des Helden sein Dienst in der Marine und sein müßiges Leben in London, wo er den Stutzer und Glücksjäger spielt, besonders hervor, weil diese Situationen nur geschildert zu werden brauchten, um zur Satire zu werden, ohne dass der Verfasser nötig gehabt hätte, direkt moralisierend einzugreifen. Besonders die Schilderung der Missbräuche in dem Marinedienst, die Smollett aus eigener Erfahrung während seines Dienstes als Schiffsarzt kennen gelernt hatte, und die uns jetzt fast unglaublich klingen, wenn wir bald barbarische Halbmenschen, bald lächerlich verzärtelte, des Dienstes völlig unkundige Weichlinge als Seehelden auftreten und überall die Protektion und Bestechlichkeit am Ruder sehen, trägt im Ganzen dennoch den Stempel der inneren Wahrheit an sich und bleibt von psychologischem wie historischem Interesse, obgleich auch hier die politische Parteiansicht etwas ins Schwarze gemalt haben mag. So fehlt es Smolletts Romanen nicht an einzelnen scharfen Charakteristiken, aber der Stoff ist roh zusammengehäuft, es fehlt die verbindende Einheit, und das Ganze fällt aus einander.
Der eigentliche Schöpfer des englischen Sittenromans ist Fielding. Sein Tom Jones ist vortrefflich komponiert und bildet ein geschlossenes Ganzes, und die Sittenschilderung darin ist nach aller Zeitgenossen Zeugnis so wahr und treffend, dass sich noch jetzt Historiker, wie Mac Aulay, darauf berufen dürfen. Fielding selbst gibt die Naturwahrheit als das Ziel seines Strebens an, hat aber auch zugleich für Mannigfaltigkeit und Abwechslung, also nicht bloß für die Belehrung, sondern auch für die Unterhaltung seiner Leser gesorgt, indem er geschickt die verschiedensten Charaktere in die Handlung zu verflechten und sie in die verschiedensten Situationen zu bringen gewusst hat, ohne der Einheit des Ganzen wesentlichen Eintrag zu tun. Bei ihm sehen wir denn auch zuerst die eigentliche Bedeutung des Sittenromans hervortreten, dass er nämlich wesentlich national ist, dass er danach strebt, das ganze volle Leben der Nation, der er angehört, wiederzugeben. In unfern sogenannten klassischen Romanen, im Wilhelm Meister z. B., gibt es gar keine Nation; die Handlung verläuft sich in den Salons zwischen einigen adligen Kunstmäzenen und den von ihnen protegierten Künstlern. Die Straße ist für den Dichter nicht vorhanden; was sich dort regt und bewegt, ist höchstens Staffage und wird vornehm aus der Vogelperspektive beobachtet, wenn etwa der eilig Reisende aus dem bequemen Reisewagen einen Blick auf das „gewerbefleißige Gebirgsstädtchen“ wirft. Wie tummelt sich dagegen das volle Leben in Fieldings Roman! Da gehen der Landedelmann, der Geistliche, der Soldat, der Schulmeister, der Höfling in buntem Zuge an uns vorüber; Wirtshausszenen wechseln mit Jagden, das Boudoir macht dem Gefängnis Platz, kurz, wir sehen ein höchst mannigfaltiges äußeres Leben in voller Anschaulichkeit sich vor uns entfalten. Der Verfasser hat ohne Zweifel auch dem inneren Leben seiner Gestalten alle Sorgfalt gewidmet, aber hier können wir uns nicht mehr so ruhig beschaulich verhalten, wir sehen mit Erstaunen, dass nicht bloß Kleid und Sitte, sondern auch die Sittlichkeit eine andere geworden ist, denn seine Begriffe von Tugend, Anstand, Zartheit u. s. w. scheinen beim ersten Anblick von dem, was wir jetzt mit diesen Ausdrücken bezeichnen, so himmelweit verschieden zu sein, dass wir oft erröten, wo er lacht, und lachen, wo er gerührt ist. Sein liebenswürdiger und gutmütiger Allworthy erscheint uns als ein pedantischer Schwachkopf, sein Tom Jones denn doch bei aller Herzensgüte und trotz seines einnehmenden chevaleresken Wesens als ein unverantwortlicher Zyniker im Punkt der Liebe, und dessen Geliebte, Sophie, will uns bei ihrer über alle Maßen gütigen Nachsicht gegen die „bloß fleischliche“ Untreue ihres Ritters durchaus nicht den beabsichtigten Eindruck zartester Jungfräulichkeit machen. Wir dürfen aber vermuten, dass hier nicht bloß die laxe Sitte des vorigen Jahrhunderts, sondern auch eine vom Verfasser verschuldete schwache Motivierung dieser Charaktere im Spiele ist, denn Sophiens Vater, der halbbarbarische Landjunker Western, dieser unermüdliche Fuchsjäger und grandiose Säufer, der gleich dem Bauer spricht und fühlt, ist zwar auch ein Portrait aus einer längst entschwundenen Zeit, zu welchem es keine Originale mehr gibt, aber so wenig wir mit dem Mann und seiner ewig beweglichen Hetzpeitsche in Berührung kommen möchten, so erweckt uns doch diese Rohheit, die durch große Gutmütigkeit gemildert wird, keinen sittlichen Ekel, ja dieser halbwilde Nimrod wird einigermaßen unser Liebling. Auch die übrigen Hauptfiguren: der heuchlerische Bösewicht Blifil, seine und Tom Jones Erzieher, der starr orthodoxe, dickköpfige Pfaffe Thwackum und der freigeisterische Tugendphilosoph Square, ferner der fast immer als Stallmeister und Courier beschäftigte Geistliche Westerns, Mrs. Honour, Sophiens ewig schwatzende, eitle und auf ihren eigenen Vorteil spekulierende Kammerzofe u. s. w., sie alle erscheinen uns jetzt als kaum noch so vorkommende Originale, aber durchaus in der sittlichen Würdigung, welche wir noch jetzt ihnen würden angedeihen lassen. Die allgemeinen Begriffe von dem, was sittlich edel und sittlich verwerflich ist, sind ja zu Homers Zeiten beinahe dieselben gewesen, wie heut zu Tage, wie sollten sie sich denn in dem kurzen Zeitraum eines Jahrhunderts so wesentlich geändert haben! Der Grund, weshalb Fieldings Menschen uns dennoch häufig so fremd und altfränkisch erscheinen, scheint uns darin zu liegen, dass Fielding nur ein Abschreiber der Natur, aber kein Dichter war. Er beobachtet die Handlungen der Menschen genau und kopiert vortrefflich, weiß uns auch in der einzelnen Figur, so individuell sie auftritt, eine gewisse Gattung zu seiner Zeit lebender Menschen anschaulich zu machen, aber das tiefere Seelenleben, die inneren, feineren Regungen des menschlichen Herzens überhaupt bleiben ihm verschlossen. Er sieht einen aus Kraftfülle sündigenden, sonst vortrefflichen jungen Mann, eine weiche, zarte, stets zum Vergeben geneigte Mädchenseele, denn beide Charaktere hat es zu allen Zeiten gegeben; — gut! er bringt sie zusammen, lässt recht derb und recht oft sündigen und recht oft vergeben und glaubt seine Aufgabe gelöst zu haben, aber eigentlich hat er seine beiden Hauptcharaktere nicht verstanden, denn es fehlt ihm die wahre Vermittlung, die dichterische Intuition.
Unter den vielen Nachahmungen, die Fieldings Roman, gleich jeder bedeutenden Erscheinung, hervorrief, wollen wir nur Goldsmiths „Landprediger von Wakefield“ erwähnen, weil wir in diesem Buche einen Fortschritt des Sittenromans erkennen. Goldsmith ist mehr Dichter als Fielding, er mildert das Herbe des Welttreibens, ohne es zu verwischen, und über seiner lieblichen Idylle schwebt ein höherer, versöhnender Geist, der die kleine Erzählung zu einer beinahe erbaulichen Theodicee umgestaltet. Aber gerade dies erbauliche Element tritt auch mit zu anspruchsvoller Bewusstheit hervor, und eine gewisse Pastorale Salbung, die zwar zum Teil durch den Hauptcharakter entschuldigt wird, sich aber doch ungebührlich breit macht und selbst bis zur Mitteilung einer vollständigen Predigt steigert, drückt dem Ganzen den Charakter einer didaktischen Absichtlichkeit auf, welche dem allgemeinen poetischen Eindruck nicht selten Abbruch tut.
Zur wahren Höhe der Poesie ist der englische Sittenroman erst in der neuern Zeit durch Boz erhoben worden, dem wir dann endlich noch die neueste bedeutende Erscheinung auf diesem Gebiete, Thackerays „Vanity Fair“ (Markt der Eitelkeit) zur Seite stellen wollen. Wir finden zunächst in Boz’ Romanen eine Fülle der Anschauung, einen Reichtum des äußern Lebens, dass er selbst hierin, in diesem praktischen Blick, diesem den Engländern überhaupt eigenen Beobachtungstalent seine Vorgänger sämtlich übertrifft. Man kann ohne Übertreibung behaupten, dass in diesen Romanen, ja in dem Pickwick allein, die Eigentümlichkeit des englischen Volks mit einer Lebendigkeit zur Anschauung gebracht wird, die dem Leser fast die Autopsie zu ersetzen vermag. Welche Fülle des Lebens breitet sich ungezwungen vor uns aus, während wir Herrn Pickwick auf seinen Kreuz- und Querzügen begleiten, die er zur Bereicherung seiner Welt- und Menschenkenntnis unternimmt! Bald drängen wir uns durch die Straßen von London, bald sitzen wir behaglich oder unbehaglich im Postwagen und machen zweideutige Bekanntschaften; dann wieder befinden wir uns in dem Getümmel der Gasthöfe oder in der freundlichen Stille eines englischen Landsitzes, wo es ein englisches Weihnachtsfest zu feiern oder eine Jagd oder eine Hochzeit mitzumachen gibt; oder wir tun auch einen Blick in das politische und religiöse Leben des Volks, wohnen einer Parlamentswahl oder einer Gerichtssitzung bei, durchwandern das Elend des Fleetgefängnisses oder besehen uns das Treiben eines pietistischen Konventikels. Und je mehr wir uns in Boz’ Romane vertiefen, desto mehr Seiten des englischen Volkslebens treten uns mit unvergleichlicher Plastik entgegen, desto unerschöpflicher erscheint uns dieser Stoff, wenn auch keiner der späteren Romane den Pickwick an Frische erreicht. Aber Boz ist selbst in den Schilderungen des Toten und Unbeweglichen ein Meister, er weiß auch diese zu kunstreichen Gemälden zu gruppieren und oft mit einer ihm ganz eigentümlichen Phantastik zu beleben. Die Meubles und Gerüche der Zimmer gewinnen unter seinen Händen Charakter und Individualität: ein großer morscher Lehnstuhl wird ein alter gichtbrüchiger Herr mit Tuchpantalons und Pantoffeln; ein Kronleuchter in einem unbewohnten Zimmer, den eine Decke umhüllt, erscheint ihm wie eine ungeheure Träne; einige alte, ausgediente Kutschen genügen, ihm ihre ehemaligen Bewohner mit Perücke und Galanteriedegen oder mit stattlichem Reifrock herbeizuzaubern und veranlassen ihn, eine Entführungsgeschichte aus der guten alten Zeit der Galanterie auszuspinnen. Wie köstlich versteht er es, dumpfe, alte Kirchen mit den gespenstischen verlassenen Kirchstühlen und den vermoderten Grabmälern zu schildern, so dass man die feuchte, ungesunde Luft zu atmen glaubt! Und wie friert uns, wenn er uns an die strotzenden und doch so unbehaglichen Tafeln herzloser Geldmenschen führt oder im Chuzzlewit in die Küche des Speisehauses für Herren vom Handelsstande blicken lässt, wo der Dienstbursche bei der Tranlampe mit erstarrten Händen die Stiefeln putzt! Wir erstaunen, wenn er uns in „Dombey und Sohn“ eine Erdrevolution schildert, aufgehäuften Schutt, durch einander geworfene Geräte, rauchende Brandstätten an einer Stelle, wo früher Straßen standen, aber es hat Nichts auf sich, es wird nur eine Eisenbahn gebaut. Wie weiß er überhaupt die Gewerbetätigkeit fast unseren Sinnen wahrnehmbar zu machen! Wir fühlen die Glut der Hochöfen, sehen das Treiben der trägen Ruderknechte auf den langsam dahin gleitenden Flussfahrzeugen vor uns und riechen den Wasserduft, wenn wir das Schifferviertel von London betreten, wo sich an jedem Fenster Waren zum Schiffsgebrauch oder Kapitäne in Hemdsärmeln zeigen.
Aber diese so lebendig geschilderte Außenwelt ist doch immer nur Nebensache, immer nur der Schauplatz, auf welchem Boz sich seine Menschen, die echten Kinder seiner Phantasie und seines Herzens, bewegen lässt. Die Seelenmalerei ist sein eigentliches Handwerk, jede Regung des Menschenherzens zu beobachten, seine erste und wichtigste Aufgabe. Und hier geht es uns seltsam: seine Gestalten erscheinen uns fast immer originell, ja oft bizarr und dennoch so bekannt und vertraut, als wären wir diesen oder ganz ähnlichen Menschen schon häufig auf unserm Lebenswege begegnet. Und so ist es auch, denn es sind Menschen von der entwickeltsten Individualität, so und so gebildete Engländer des neunzehnten Jahrhunderts, aus dem oder dem Stande, von den und den Lebensschicksalen, aber es sind immer zugleich wahrhafte Menschen, mit wahrhaft menschlichen Gefühlen und Seelenkämpfen, und dies allgemein Menschliche macht sie uns vertraut, macht sie zu Typen, so dass sie nie, wie Fieldings Gestalten, uns fremd werden und veralten können. Hier sehen wir den Unterschied des Dichters von dem bloßen Charakteristiker. Der Letztere erfasst nur die für die jedesmalige Zeit und die jedesmaligen Umstände charakteristischen Besonderheiten der Individuen, aber er weiß sie nicht zu einer lebendigen Einheit zu verbinden, er lebt und fühlt nicht mit seinen Menschen. Das tiefere, sich ewig gleich bleibende Seelenleben der Menschheit entweicht unter seiner sezierenden Hand und er vergisst, dass die Menschen in ihren Trieben, im Glück und Unglück, in Liebe und Hass, in Freundschaft und Feindschaft immer, auch unter den verschiedensten Formen, dieselben geblieben sind. Aber Boz hat die Menschheit nicht nur mit dem Auge des Dichters beobachtet, er liebt sie auch mit der ganzen Fülle eines warmen Herzens, eines kindlichen, unverbitterten Gemütes. Daher gelingt ihm Nichts vortrefflicher, als die Schilderung wirklicher Kinder oder solcher Erwachsener, welche sich die kindliche Unschuld und Einfalt unberührt von den Stürmen der Welt bewahrt haben. In dreien seiner Romane sind Kinder die Hauptfiguren, die eigentlichen Helden der Erzählung, alle drei sehr gute, sehr innerliche und sehr unglückliche Kinder, aber dennoch alle drei wie himmelweit verschieden! Der arme Waisenknabe Oliver Twist ist das schüchterne, sanfte, immer geduldige Kind des Elends, bleich und verkommen, früh niedergetreten und daher ängstlich und blöde, aber desto dankbarer für den geringsten Beweis von Liebe, die ihm von der Geburt an gefehlt hat, und nach der seine Seele doch dürstet. Ein weibliches Gegenstück zu ihm ist die unvergleichliche kleine Nell in dem „Raritätenladen“, diese lieblichste aller Bozischen Gestalten, die ihren von dämonischer Spielwut zerrütteten, geistesschwachen Großvater, gleich einem Schutzengel, geleitet und behütet. Dies kleine, engelreine, lebensheitere Kind, welches, in eine ihm fremde Welt des Lasters und der Gefahren versetzt, an einer über seine Jahre und Kräfte hinausgehenden Aufgabe scheitert und endlich am gebrochenen Herzen stirbt, erinnert unwillkürlich an Eugen Sues ähnliche Gestalt, die Fleur de Marie in den „Mysterien von Paris“, aber welch ein Unterschied! Wie hat der Franzose hier alles vergröbert und die ganze Erscheinung dadurch, dass er sie in dem Kloak des Lasters um- und umkehrt, teils unserer Teilnahme beraubt, teils als solche innerlich unmöglich gemacht! — Das dritte jener Bozischen Kinder, der kleine Paul Dombey, ist der Erbe ungeheuren Reichtums, die Hoffnung eines alten Hauses, aber noch unglücklicher als die beiden erwähnten Kinder, denn er trägt von der Geburt an den Keim eines frühen Todes in sich, hat keine Freude an kindlichen Spielen, wird immer altkluger und ernster und siecht vor der Zeit dahin. Aber einen Zug hat er mit jenen andern Kindern gemein, ein liebebedürftiges Herz, eine unendliche Innigkeit und Wärme der Empfindung, die bei diesem trotz seines Reichtums verlassenen, von der Krankheit zu einem jugendlichen Sonderling verbildeten, stillen und träumerischen Knaben desto rührender hervortritt. Diese liebewarmen, vor der Zeit dahinwelkenden Kinderherzen sind die schönsten und reinsten Triumphe der Bozischen Kunst; diese Figuren sind naturwahr, individuell, Kinder ihrer Zeit und ihrer Verhältnisse, aber dennoch ewig, denn sie sind von der Poesie vergeistigt, sie werden verstanden werden, so lange es Menschen gibt, welche ihre Kinder lieben, und welche es schmerzt, wenn sie die Blüte verwelken sehen, ehe sie zur Frucht gereift ist. — An diese Kindergestalten des Dichters schließen sich seine erwachsenen Kinder an, diese Menschen mit dem ewig heitern, liebewarmen Kinderherzen, welche arglos mit den Blumen auf ihrem Lebenswege spielen und die Schlangen darunter nicht fürchten, weil sie sie nicht kennen. Der Prototypus dieser Bozischen Figuren ist sein berühmter Herr Pickwick, dieser unsterbliche alte Herr mit Brille und Gamaschen, der von seinem Comtoirtisch in das bunte Leben einer ihm bisher fremden Welt eintritt, um die Menschen zu beobachten, und in dem glücklichen Wahne, eine besonders praktische Natur zu sein, sich und Andre fortwährend in die ergötzlichsten Verlegenheiten verwickelt. Ein solcher Mensch könnte sehr lästig werden, aber über Herrn Pickwick können wir höchstens lachen, müssen ihn aber dabei von Herzen lieben, denn er ist unschuldig, wie ein Kind, von der liebenswürdigsten Gutmütigkeit und der unverwüstlichsten heitern Laune, und macht schließlich Alle glücklich, mit denen er in Berührung kommt. An ihn schließt sich eine lange Reihe ähnlicher Bozischer Charaktere, lauter „Seelen von Menschen“, wie man zu sagen pflegt: die beiden Brüder Wohlgemuth im „Nicholas Nickleby“, auch zwei alte Herren, voll von Liebe und Güte, die sich gegenseitig und ihren alten Buchhalter und alle Welt mit Freundlichkeiten überschütten; dann Tom Pinch im „Chuzzlewit“, ein Kindergemüt mit einem Taubenherzen, unfähig zum Zorn; der sanfte Schulmeister im „Raritätenladen“, welcher nur mit Kindern Umgang sucht und die arme Neil bis zu ihrem Tode pflegt und hegt; der Kapitän Cuttle im „Dombey“, ein alter rauer Seemann, aber von dem weichsten Herzen, immer beschäftigt mit Plänen und immer bereit zu Opfern für das Glück seines Pflegesohns Walter; endlich der alte Peggotty im „Copperfield“, auch ein Eichenherz in der Seemannsjacke, aber von noch feinerem und edlerem Gefühl, sich hingebend für das, was er liebt, ohne ein Wort zu verlieren oder nur den Gedanken aufkommen zu lassen, als könnte es anders sein. Wiederum dieser Reihe verwandt ist eine andere unter den Bozischen Romangestalten: gleichfalls erzgutmütige, seelengute Menschen, aber über die Kinderunschuld lange hinweg, vielmehr haben diese recht tüchtig in den Apfel der Erkenntnis gebissen und sich umgesehen in der Welt und kennen das Laster und alle Schliche und Schlupfwinkel desselben auf das genaueste, ja sie haben wohl gar von diesem gefährlichen Studium der Welt einen oft nicht ganz unbedeutenden Beigeschmack eigener lasterhafter Neigung davon getragen, aber ihr innerer Kern ist unangefressen geblieben, sie sind doch immer ehrliche Kerle und die entschiedensten Feinde aller prämeditierten Schlechtigkeit. An der Spitze dieser Reihe steht Herr Sam. Weller, Herrn Pickwicks vortrefflicher Bedienter und der passendste Sancho dieses modernen Don Quixote, der in seinem derben Realismus den ergötzlichsten Gegensatz zu seines Herren weltverschönerndem und verkennendem Idealismus bildet. Er ist durch und durch praktisch, so zu sagen, mit allen Hunden gehetzt; weit entfernt, sich irgend einer Illusion hinzugeben oder sich durch irgend Jemand imponieren zu lassen, verlässt er sich, ein echter Sohn John Bulls, in allen Lebenslagen auf seinen gesunden Witz und seine tüchtigen Fäuste. Aber er hat auch seine weiche Stelle, die ihn eben den oben erwähnten Charakteren anreiht und ihn selbst unserm Herzen teuer macht: das ist seine unerschütterliche Anhänglichkeit an seinen Herrn, dessen der Welt gegenüber wehrlose Herzensgüte er ganz erkennt, und den er daher stets mit der aufopferndsten Liebe zu schützen und nötigenfalls auch etwas zu bevormunden bereit ist. Ähnliche durch die harte Schule des Lebens gewitzigte, zum Teil auch verbogene, aber doch innerlich gesunde Charaktere sind: der schweigsame Schreiber des Wucherers Ralph Nickleby, ein heruntergekommener Gentleman, äußerlich sehr gesunken und in düstern Momenten selbst dem Trünke ergeben, aber innerlich noch warm erglühend für alles Edle und Gute; ferner der lustige Swiveller im „Raritätenladen“, welcher ziemlich verliederlicht ist, aber bei allem Leichtsinn, aller seiner Eitelkeit und Nichtsnutzigkeit sich doch seine unverwüstliche Gutmütigkeit erhalten hat, die uns ihm immer wieder geneigt macht; dann der humoristische Mark Tapley im „Chuzzlewit“, dessen sonst unzerstörbare gute Laune nur durch die Betrachtung getrübt wird, dass sie eigentlich kein Verdienst sei, da es ihm, selbst in Situationen, welche andere Leute unglückliche zu nennen pflegen, ganz behaglich zu Mute ist; endlich der schwungvolle Micawber im „Copperfield“, welcher trotz seiner zahlreichen Familie und noch zahlreicheren pekuniären Verlegenheiten nie den Anstand aufgibt oder den Mut verliert, sondern stets der Hoffnung lebt, dass er endlich dennoch „einen seinen Talenten angemessenen Wirkungskreis“ finden werde. Alle diese bisher erwähnten Charaktere werden sich, mit den durch die Zeit bedingten Nuancen, zu allen Zeiten finden, aber dass sie in den Bozischen Romanen so auffallend in den Vordergrund treten, legt teils ein gutes Zeugnis ab für die englische Nation des neunzehnten Jahrhunderts, welche die Originale zu so erfreulichen Bildern lieferte und die Bilder selbst so zu würdigen wusste, teils erlaubt es einen ehrenvollen Rückschluss auf den Charakter des Autors, der diese Gestalten schuf. In der Tat erscheint uns Boz überall als ein weiches Gemüt, welches ein ganz besonderes Verständnis für die Freuden guter Menschen besitzt, daher er auch auf Feste, namentlich auf das behagliche englische Weihnachtsfest mit seinen nicht zu verschmähenden materiellen Genüssen, dem Puterbraten, dem Pudding u. s. w. wiederholt in seinen Romanen zurückkommt und gern bei ihnen verweilt. Aber eben weil er den Guten sein ganzes Herz zuwendet und ihnen alles mögliche Gute gönnt, so begegnet es ihm nicht selten, dass er sich in seine eigenen Gestalten verliebt, dass er sie selbst mit Wohlwollen überhäuft, mit ihnen tändelt und liebäugelt und des Lesers ganz vergisst. Dadurch wird er breit und wiederholt sich, er ist wie ein Kind, welches ohne zu ermüden mit seiner Puppe immer wieder und wieder dasselbe Spiel treibt. Daneben ist er aber auch ein Schalk; allen diesen Gestalten, so sehr er sie auch liebt, hat er doch ihr lächerliches Haarbeutelchen angeheftet, und er freut sich wiederum wie ein Kind, wenn er sie in Situationen geraten lässt, wo es ihnen recht lustig um den Kopf fliegt. Seine Kunst, so wie die Kunst jedes Humoristen, besteht eben darin, dies lächerliche und ernst sittliche Moment in den Menschen und oft in den Situationen so unauflöslich zu verknüpfen, dass man über dieselben lachen muss und sich doch häufig zu gleicher Zeit innerlich erweicht fühlt; es ist dies das berühmte, wohl nur dem Nordländer verständliche „Lächeln unter Tränen“, man lacht diese Menschen aus und möchte ihnen doch zugleich um den Hals fallen und ihnen einen recht herzlichen und innigen Kuss geben, denn man muss sie lieben, wie seltsam, ja wie unschön sie auch oft erscheinen mögen. — Diese vorherrschende Weichheit in Boz’ Charakteristik, diese Vertiefung in die edle und sittliche Seite der menschlichen Natur macht es erklärlich, dass ihm die Bösewichter nicht recht gelingen wollen. Er bedarf gleichsam eines Anlaufes zu ihrer Schilderung, er muss sich gewissermaßen dazu zwingen, sich in diesen Abgrund des Menschenherzens zu versenken und deshalb fürchtet er, auch Andern nicht verständlich zu werden und verschwendet seine Farben; er will recht deutlich sein, recht scharf charakterisieren und wird überladen, wird Karikatur-Maler, wird oft unwahr. Man gehe nur die Reihe seiner allerdings oft originellen, oft tief angelegten Bösewichter durch, man wird fast immer Schatten ohne Licht, ganz verwilderte, verkommene, fast vertierte, kurz solche Charaktere finden, die beinahe nichts Menschliches mehr an sich haben und sich daher selten oder nie in der wirklichen Welt nachweisen lassen. Da erscheinen sogleich im „Nickleby“ neben dem noch gemäßigten, harten Wucherer Ralph Nickleby seine unmenschlichen Spießgesellen, der teuflische Pensionshalter Squeers, welcher die Kinder in seiner Schule methodisch misshandelt, dumm prügelt, beraubt, aushungert und ihnen allwöchentlich eine Mischung von Schwefel und Sirup eingeben lässt, um ihnen den Appetit zu nehmen und sie so wohlfeiler erhalten zu können, und der schäbige, zur Mumie eingetrocknete Geizhals Arthur Gride; dann im „Raritätenladen“ der aus Prinzip boshafte Quilp, ein koboldartiger Zwerg mit einem ungeheuren Kopf, der gern auf hohe Tische oder die Lehnen der Stühle klettert und dort mit gekreuzten Beinen sitzt, unmäßig Tabak raucht, viele Gläser kochenden Branntweins verschlingen kann und gewöhnlich in einem Schuppen auf seinem Holzhofe residiert, wo er einsam sein Wesen treibt, obgleich er verheiratet ist und eine ordentliche menschliche Wohnung besitzt. Wir übergehen die verschiedenen Räuber und Spitzbuben im „Oliver Twist“, und erinnern nur noch an den unmenschlichen Geizhals und wüsten Mörder Jonas Chuzzlewit im „Chuzzlewit“, an den eleganten, aber nicht minder dunkel gefärbten Carker im „Dombey“, dessen tigerartige weiße Zähne und schneeweiße Wäsche in einem fast grauenhaften Kontrast zu seinem lichtlosen Innern stehen, endlich an den schlangenartigen Heuchler Uriah Heep im „Copperfield“ mit seinem glatten, schaumartigen Gesicht und den dürren, im Sitzen hoch hinaufgezogenen Knien: sie alle sind ohne alle Beimischung des Guten oder auch nur eine unschuldige Liebhaberei, wodurch sie sich uns als wirkliche Menschen auswiesen, vollendete Bösewichter oder vielmehr das vollendete Böse selbst, mit allen seinen Konsequenzen, denn gewöhnlich sind sie böse, nicht aus menschlicher Leidenschaft oder sonstigen selbstsüchtigen Motiven, aus Genusssucht, Ehrgeiz u. s. w., sondern aus reiner, dämonischer Lust am Bösen. Boz vermenschlicht diese teuflischen Geschöpfe erst wieder, wenn er sie dem Untergange entgegenführt; dann, wenn das Gericht herannaht, wenn die Regungen des so lange unterdrückten, des scheinbar gänzlich verhärteten Gewissens in ihnen erwachen, wendet er ihnen sein Mitleid, sein menschliches Interesse zu und zeigt wieder seine ganze Meisterschaft in der Seelenmalerei. Besonders weiß er uns jene traumartigen Zustände anschaulich zu machen, in welche die verdüsterte, kranke Seele versinkt, wenn sie vergeblich gegen die überlegene Macht der nur scheinbar erstickten sittlichen Naturanlage ringt. Diese unbeschreibliche Angst, dies sich Anklammern an irgend einen beliebigen sinnlichen Gegenstand, um nur loszukommen von dem quälenden Gewoge der Gedanken, diese wüste Verwirrung und Unruhe des Innen, weiß Keiner besser zu schildern als Boz, und Szenen, wie die, wo Jonas Chuzzlewit mit dem zerrüttenden Bewusstsein des vollbrachten Mordes von seinem Fenster aus seine harmlosen Nachbarn beobachtet und aus ihren Bewegungen mit immer steigender Unruhe die Gewissheit zu gewinnen glaubt, dass sie von ihm und seiner Tat sprechen, oder jene andere, wie Carker im „Dombey“ mit gescheiterten Hoffnungen in rasender Eile aus Frankreich in die Heimat zurückkehrt und sich in seinen wüsten Träumen Wirkliches und Gedachtes, Gegenwart und Vergangenheit wild vermischen, gehören zu den grauenhaftesten, aber naturwahrsten Gemälden des Bozischen Pinsels. — So sehen wir, dass in der Charakteristik überall der Schwerpunkt der Bozischen Romane liegt, daher die Komposition in denselben zur Nebensache wird und höchst einfach, ja beinahe vernachlässigt erscheint. Die älteren, wie Pickwick und Nickelby, sind in der losen Form den Aventürier-Romanen der älteren Zeit sehr ähnlich. Oliver Twist ist eine jener ziemlich gewöhnlich angelegten Kriminalgeschichten, wie sie das englische Publikum liebt, welches, durch seine Zeitungen an kriminalistische Artikel so wie an Berichte aus den höheren Gesellschaftskreisen gewöhnt, in seinen Sittenromanen daher auch Schilderungen des Verbrechertreibens und des high life allen andern vorzieht. Die späteren Bozischen Romane sind etwas komplizierter, doch gruppieren sich auch hier die Begebenheiten und Gestalten leicht um die Lebensschicksale einer gewöhnlich jugendlichen Hauptperson. Nur im „Barnaby Rudge“, mit welchem Boz einen Versuch im historischen Roman gemacht hat, ist dem gemäß der Plan mit größerer Sorgfalt angelegt und auf Spannung und Überraschung des Lesers berechnet.
Wir übergehen die zahlreichen, weniger bedeutenden Nebenbuhler und Nachahmer der Bozischen Charakteristiken und werfen zum Schluss noch einen flüchtigen Blick auf die neueste Entwickelung des englischen Sittenromans. Thackerays „Markt der Eitelkeit“ ist ohne Zweifel das namhafteste Erzeugnis dieser neuesten Zeit, und der düstere Ernst dieses jüngsten Sittenmalers bildet ebensowohl einen starken Kontrast wie eine notwendige Ergänzung zu Boz’ lebensheiteren Gemälden. Beide zusammen geben erst das vollständige Bild des scharf ausgeprägten Charakters einer Nationalität, die, wie keine, eine Einheit schroffer Gegensätze in sich schließt. Wenn Boz die innerliche Wärme, ja Weichheit des britischen Seelenlebens, die heitere Gemütlichkeit und Heimlichkeit des englischen Herdes repräsentiert, so vergegenwärtigt uns Thackeray das kalte, beobachtende Wesen des Engländers, wenn er in die Außenwelt hinaustritt, seinen bitteren Sarkasmus über alles Fremde, seine düstere, weltverachtende Lebensansicht, die er in seiner stolzen Abgeschlossenheit gern nach außen zur Schau trägt. Thackerays Schilderungen aus dem Leben der Mittelklassen (denn auf diese, besonders die Sphäre des Kaufmanns- und Soldatenstandes, beschränkt sich sein Gesichtskreis) übertreffen noch die Boziscken an Objektivität und Naturwahrheit, denn ihn beim weder Liebe noch Hass, er malt mit eisernem Pinsel Nichts als die Wahrheit, d. h. die menschliche Schwäche, wie sie wirklich ist, er schmeichelt nicht, er schont nicht, er ist unerbittlich, wie der Spiegel. Er ist daher häufig prosaisch, wie Fielding, aber das über seinem ganzen Werke schwebende Bewusstsein der Nichtigkeit alles menschlichen Treibens macht ihn bisweilen erhaben, er wird dann poetisch, ein Marius auf den Trümmern von Karthago, ein Jeremias auf den Ruinen von Jerusalem. Aber die Kunst der höheren poetischen Versöhnung, die innere Harmonie, welche alle Dissonanzen des Welttreibens aufzulösen versteht und uns mit nur gesteigertem Glauben an die Menschheit aus dem Schauspiele entlässt, welches uns den ewigen Kampf des Guten mit dem Bösen von neuem vor Augen führte, die Gewissheit des Sieges, welcher allem Guten und Edlen in großen wie kleinen Verhältnissen seinem Wesen nach, wenigstens innerlich, werden muss, dies Alles, was Boz die wahre Dichterweihe gibt, ist in dem trostlosen Bilde, welches Thackeray von dem ruhelosen, nie das Ziel erreichenden Ringelrennen der Menschheit nach Glück entwirft, nicht zu finden. Und so hat uns der Rundgang durch das reiche Gebiet des englischen Sittenromans mit Thackeray wieder auf die praktische, der Satire sich annähernde Richtung zurückgeführt, von der er ausgegangen, denn sie wurzelt in dem englischen Wesen und wird sich daher über immer weitere Lebenskreise verbreiten, wie denn aus ihr z. B. auch Warrens feine Beobachtungen von dem Standpunkt gewisser Stände aus und d'Israelis soziale Tendenzromane hervorgegangen sind.