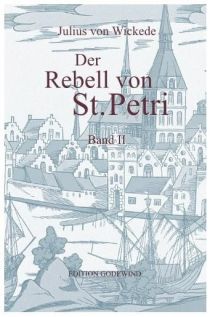Der Rebell von St. Petri - Band 2
Joachim Slüter oder Die Einführung der Reformation in Mecklenburg
Autor: Wickede, Julius v. (1819-1896) Offizier und Schriftsteller, Erscheinungsjahr: 1869
Neuaufgelegt: 2013
ISBN: 978-3-940206-48-0
bei Amazon bestellen
Neuaufgelegt: 2013
ISBN: 978-3-940206-48-0
bei Amazon bestellen
Themenbereiche
Enthaltene Themen: Reformation, Reformationsgeschichte, Reformationszeit, Reformatoren, Kirchenreformation, Mecklenburg, Luther, Joachim Slüter Rostock, St. Petri-Kirche, Magnus II Herzog zu Mecklenburg, Herzog Heinrich, Herzog Albrecht, Politik
Ein Roman aus der Reformationszeit von Julius von Wickede, in einer Bearbeitung von Carola Herbst.
Warnemünde im Jahre des Herrn 1525.
Der Winter ist ungewöhnlich früh über die mecklenburgische Ostseeküste hereingebrochen. Bereits im November treiben auf der Warnow Eisschollen in Richtung der Hansestadt Rostock. Sturmböen rütteln an den dürftigen Hütten der Strandbewohner. Wieder bricht ein eisiger Tag an, der so recht geschaffen ist für einen gemütlichen Plausch am warmen Herdfeuer, aber die Fischer und Lotsen stehen unter freiem Himmel und lauschen der Predigt des Reformators Joachim Slüter. Die Festlichkeiten zu Ehren des seltenen Gastes werden jäh unterbrochen, als ein Kanonenschuss das Brausen der See übertönt: Ein Schiff ist in Not!
Die Fischertochter Gundula Wegner befällt eine seltsame Unruhe, als ahnte ihr Herz, das kämpfende Schiff da draußen könnte mit dem Kostbarsten, was sie jemals besessen, untergehen.
„Mit dem mehrteiligen Roman ,Der Rebell von St. Petri‘ setzte … Julius v. Wickede dem Rostocker Prediger und Reformator Joachim Slüter … ein literarisches Denkmal eindrücklicher Art.“
Mecklenburgische & Pommersche Kirchenzeitung
*****************************
Warnemünde im Jahre des Herrn 1525.
Der Winter ist ungewöhnlich früh über die mecklenburgische Ostseeküste hereingebrochen. Bereits im November treiben auf der Warnow Eisschollen in Richtung der Hansestadt Rostock. Sturmböen rütteln an den dürftigen Hütten der Strandbewohner. Wieder bricht ein eisiger Tag an, der so recht geschaffen ist für einen gemütlichen Plausch am warmen Herdfeuer, aber die Fischer und Lotsen stehen unter freiem Himmel und lauschen der Predigt des Reformators Joachim Slüter. Die Festlichkeiten zu Ehren des seltenen Gastes werden jäh unterbrochen, als ein Kanonenschuss das Brausen der See übertönt: Ein Schiff ist in Not!
Die Fischertochter Gundula Wegner befällt eine seltsame Unruhe, als ahnte ihr Herz, das kämpfende Schiff da draußen könnte mit dem Kostbarsten, was sie jemals besessen, untergehen.
„Mit dem mehrteiligen Roman ,Der Rebell von St. Petri‘ setzte … Julius v. Wickede dem Rostocker Prediger und Reformator Joachim Slüter … ein literarisches Denkmal eindrücklicher Art.“
Mecklenburgische & Pommersche Kirchenzeitung
*****************************
Slüter in Güstrow. - Die Anhänger der neuen Lehre in Mecklenburg.
Die fanatisch-päpstliche Partei der Stadt Rostock glaubte, mit Slüters Weggang sei das verruchte Ketzertum vollständig ausgerottet. Doch ihre Anhänger mussten sich bald davon überzeugen, dass man sich hierin geirrt habe. Die Samenkörner, die der Vertriebene ausgesät hatte, fanden einen zu günstigen Boden, als dass sie hätten verdorren können. Die Gesinnung des Bürgertums an der deutschen Ostseeküste ließ sich in der einmal gefassten Überzeugung nicht so leicht wankend machen. Fast alle, die sich zu der neuen Lehre Luthers hingewandt hatten, blieben ihr auch nach der Entfernung ihres Lehrers mit unerschütterlicher Festigkeit treu. Zwar suchten die eifrigen Papisten, unter denen sich Pater Rothstein vom Dominikanerkloster St. Johannis und auch Ratsherr Cordes durch ihren unangemessenen Eifer besonders hervortaten, die Anhänger der neuen Lehre auf jegliche Weise zu verfolgen, aber nur in den seltensten Fällen hatte ihr Bestreben Erfolg. Die unleugbare Rednergabe des Paters füllte zwar stets die Kirche. Die Zahl seiner treuen Verehrer, zumal unter den Frauen und Töchtern der angesehenen Geschlechter, war immer noch groß, doch auf der anderen Seite erbitterte sein Fanatismus, sein zornwütiger Eifer vermochte nicht zu überzeugen oder gar zu versöhnen. Er begann seine Predigten regelmäßig damit, dass er die neue Lehre und deren Gründer, Dr. Martin Luther, feierlich verfluchte und seine Zuhörer mit heftigen Worten ermahnte, sie möchten ihre Gebete zu Gott wenden, dass Luther und alle seine Jünger, besonders der verruchte Slüter, ebenso öffentlich verbrannt würden, wie Huß zu Konstanz und manche andere Ketzer, die diese wohlverdiente Strafe glücklicherweise getroffen habe. Sowie der Pater bemerkte, dass einer seiner Zuhörer kein Paternoster oder keinen Rosenkranz in der Hand hielt, sondern ein Buch, worin er die verpönte lutherische Bibelübersetzung argwöhnte, verleitete ihn sein Glaubenseifer dazu, den angeblichen Frevler von der Kanzel herab zu schmähen und häufig in plattdeutscher Mundart, der man sich in Mecklenburg allgemein bediente, ihm die drohenden Worte zuzurufen: „Ick seh Di woll achter den Piler stehn, Du hest een lutherisches Bökchen in de Hand, dat ward Di in dat höllische Fuer bringen.“ Solche und ähnliche Drohungen in der Kirche vermochten nur die Gemüter zu erbittern und die Ausbreitung der neuen reinen Lehre wurde dadurch eher befördert als verhindert. Auch die weltlichen Verfolgungen des Ratsherrn Cordes und seiner Helfer und Helfershelfer, unter denen sich Rottmeister Horwath durch seine Brutalität und Gehässigkeit hervortat, verfehlten ihren Zweck. Zwar wurden Dutzende von Knechten, Gesellen und anderen Leuten niederen Standes, die als Lutheraner bekannt waren, oft mit der größten Härte aus der Stadt verjagt, auch vorher körperlich gezüchtigt oder unter nichtigen Vorwänden Wochen und Monate lang in harter Haft auf der Frohnerei gefangen gehalten, jedoch deren Zahl nahm deshalb nicht ab. Im Gegenteil, für jeden derartig vertriebenen Lutheraner fanden sich immer neue Männer aus den unteren Ständen, die der Lehre Luthers anhingen, und so mehrte sich deren Zahl immer mehr. Hauptsächlich unter den in Rostock so zahlreichen und wichtigen Seefahrern fand der neue gereinigte Glaube in überraschend kurzer Zeit die zahlreichsten und treuesten Freunde. Diese trotzigen, starken, im steten Kampf mit den wilden Elementen abgehärteten Männer wollten sich die vielen Hudeleien der ohnehin verhassten Scharwache nicht gutwillig gefallen lassen. Gerade am Hafen und in den Strandstraßen, wo das Seevolk vorzugsweise sein Wesen trieb, kam es jetzt häufiger denn je zu argen Schlägereien zwischen den Matrosen und den Söldnern der Scharwache. Die schweren, kurzen Enterschwerter der Seemänner kreuzten sich mit den wuchtigen Hellebarden der Söldner und nicht selten floss Blut, waren gefährliche Verwundungen, ja selbst Todesfälle zu beklagen. Des Abends wagten sich die Scharwächter nur noch in starken Haufen in diese Gegenden und Rottmeister Horwath, so mutig und streitgewohnt er auch sonst war, durfte ohne eine Bedeckung von sechs bis acht schwerbewaffneten Söldnern keine Verhaftung im Hafenviertel vornehmen, da er sicher sein konnte, den hartnäckigsten Widerstand vorzufinden. Aber auch die Rostocker Schifffahrt, dieser Lebensnerv der ganzen Stadt, fing an, unter den religiösen Zwistigkeiten zu leiden. Viele lutherisch gesinnte junge Steuerleute und Matrosen gingen nach Lübeck, wo man toleranter gegen ihren Glauben verfuhr. Sie wurden mit Freuden von den dortigen Schiffern aufgenommen, während die einheimische Reederei mitunter Mangel an einer tüchtigen Mannschaft litt.
Hatte doch ein Hoher Rat diese Angelegenheit einer besonderen Sitzung gewürdigt, in der es zu heftigen Reden und manchen inneren Streitigkeiten gekommen war. Der erste Bürgermeister der Stadt, Herr Heinrich Gerdes, ein wohlgesinnter und weiser Mann, der im Innern seines Herzens dem neuen Glauben gar nicht so feindselig gegenüberstand, wie dies bei vielen der Ratsherren der Fall war, riet zur Schonung und Milde und wollte nicht, dass man gegen die lutherisch Gesinnten so hart auftrete, wie es in den letzten Monaten häufig geschehen war. Seine Ansicht drang aber in der Ratsversammlung noch nicht durch, denn Ratsherr Cordes mit seiner gewandten und beredten Zunge wusste die große Mehrheit der Anwesenden dahin zu bewegen, dass man in den bisherigen Maßregeln nicht nachlassen und gerade jetzt das ketzerische Luthertum mit Stumpf und Stiel ausrotten müsse. Sei das schöne Ziel erst erreicht, so hörten auch die gegenwärtigen Reibereien im Innern der Stadt von selbst auf, worauf die Seefahrer sehr bald wiederkommen und sich der guten alten Ordnung fügen würden. Diese Meinung gab in der Versammlung des Hohen Rats auch den Ausschlag und mit ansehnlicher Mehrheit der Stimmen wurde beschlossen, in der bisherigen Weise der Strenge gegen alle Ketzer fortzufahren. Missbilligend sein graues Haupt schüttelnd, verließ Bürgermeister Heinrich Gerdes das Rathaus. Sein Faktotum, der alte Bürgermeisterdiener Mohl, der in seiner roten Amtstracht unmittelbar hinter ihm her schritt, musste wiederholt an der bürgermeisterlichen Samtschaube zupfen, damit der Erste der Stadt die ehrfurchtsvollen Grüße angesehener Bürger nicht unerwidert lasse, so vertieft war der alte Herr in seinen schweren Gedanken.
Auch wenn man die nicht angesessenen bekannten Lutheraner mit schonungslosem Eifer aus der Stadt und deren Gebiet zu vertreiben suchte, so ließ sich gegen die ansässigen Bürger nicht Gleiches tun. Bader Peter Schmidt, Schiffer Bradhering, Schiffsbaumeister Willgaß, Schmied Roloff und andere Bürger mehr, die als Häupter der Lutheraner unter der eigentlichen Bürgerschaft galten, konnte man nicht unter fadenscheinigen Gründen vertreiben, aber gequält und molestiert wurden sie auf jegliche Weise. Ja, als Cordes’ Eifer es schon durchgesetzt hatte, dass diese Männer gefangen genommen und wegen sträflicher Ketzerei vor ein peinliches Gericht gestellt werden sollten, wäre es fast zum Aufstand in der Stadt gekommen. Ein Teil der Quartiere waffnete sich und stellte sich auf, die zahlreichen Zünfte der Schiffszimmerleute, Huf- und Waffenschmiede, Grobbäcker und Knochenhauer erklärten, sie würden es unter keinen Umständen dulden, dass hochangesehene Meister ihrer Gewerke, ihres Glaubens wegen, gefangen gesetzt werden. So war denn eine Volkserhebung zu befürchten und der Bürgerkrieg, der leider oft innerhalb der Mauern der alten Stadt Rostock gewütet hatte, schien abermals emporflammen zu wollen. So weit mochte es jedoch ein Hoher Rat nicht kommen lassen, denn er fühlte sich zu schwach, um gegen die Drohung eines so großen Teils der Zünfte mit offener Gewalt einschreiten zu können. Zwar gab es Fanatiker, die es lieber zum Äußersten treiben wollten, als jetzt schwächlich nachzugeben, allein die gemäßigte Stimme des Bürgermeisters Heinrich Gerdes, der mit beredter Sprache darzulegen wusste, welch unermessliches Unheil der Stadt drohe, wenn es jetzt abermals zu offenen Zwistigkeiten unter ihren Bürgern komme, wusste sich diesmal Gehör zu verschaffen. Besonders seine Ansicht, dass die auf Rostocks Macht und Ansehen stets eifersüchtigen Herzöge von Mecklenburg diese Gelegenheit höchstwahrscheinlich benutzen würden, um unter dem Vorwande, die Ruhe wiederherzustellen, sich in diese Händel zu mischen und eine Besatzung in die Stadt zu werfen, war hierbei von großem Gewicht. So wurde von allen offenen Gewaltmaßregeln abgesehen und den Lutheranern unter der Hand eröffnet, dass sie im Innern ihrer Wohnungen und im engen Kreise unter sich so viele religiöse Handlungen treiben könnten, wie sie nur wollten, ohne dass ein Hoher Rat sich darum bekümmern werde. Das war der erste günstige Erfolg, dessen die Lutheraner sich rühmen durften, seit es dem Eifer der papistischen Partei gelungen war, Magister Joachim Slüter aus der Stadt zu vertreiben.
In der Vorderstadt Güstrow, im Geheimen geschützt von Herzog Heinrich von Mecklenburg, führte Slüter inzwischen ein stilles, zurückgezogenes Leben. Soviel es in seinen Kräften stand, suchte er auch in seinem neuen Umfeld Anhänger für die reine Lehre Luthers zu werben. Seinen unablässigen Bestrebungen gelang es auch, sowohl in Güstrow selbst, wie in dessen näherer und fernerer Umgebung, manch tüchtigen Streiter für den neuen Glauben zu gewinnen.
In der Stille bekannte sich Herzog Heinrich auch zum Luthertum, allerdings bewog ihn in erster Linie eine eigennützige Politik dazu. Er wünschte dessen Ausbreitung im Lande, damit er bei dieser Gelegenheit reiche Klöster und geistliche Stiftungen einziehen und mit deren Erträgen seine stets leere Kasse füllen könne. Doch aus Furcht, den Zorn des mächtigen Kaisers von Deutschland, Carl V., auf sich zu lenken, wagte er es nicht, ein öffentliches Bekenntnis abzugeben.
Solch politisches Intrigenspiel widerstrebte dem reinen Charakter Slüters auf das Äußerste. Er wäre gern aus Güstrow und der Nähe des fürstlichen Hoflagers fortgegangen, wenn er nicht gefühlt hätte, dass ihm der Schutz des Herzogs für jetzt noch unentbehrlich wäre. Unter diesen Umständen sehnte er sich nach seinem geliebten Rostock und in den Kreis seiner dortigen treuen Freunde zurück. Mit Inbrunst wartete er auf die Stunde, in der es ihm abermals vergönnt sei, die Kanzel in der altehrwürdigen Kirche zu St. Petri zu besteigen und von dort mit begeisterten Worten als Priester des Herrn seiner andächtigen Gemeinde die reine Lehre des Evangeliums zu verkünden.
Slüter hatte sich bereits einige Male nach Rostock hineingewagt, allerdings im Schutze einer Verkleidung. Dort, im gastlichen Hause des Baders Peter Schmidt, seines treuesten Verehrers, hatte er einen Kreis seiner Glaubensgenossen um sich versammelt. Aber der unermüdlichen Wachsamkeit der vielen Mönche in der Stadt, deren Zahl selten unter 300 Köpfe sank, entgingen die heimlichen Besuche nicht. Den Klosterbrüdern, egal welchem Orden sie angehörten, gelang es stets, den so bitter gehassten Reformator zu erspähen. Sie hatten im Haus des Baders und derer anderer Bürger, die als Lutheraner bekannt waren, eine Menge von ihren Spionen. Von denen erfuhren sie alles, was in den Stuben der sogenannten Ketzer vorging. So war denn Slüters Leben in Rostock wiederholt gefährdet gewesen. Die papistische Partei hatte einen Haufen Pöbel aufgehetzt, das Haus Peter Schmidts zu umringen und die Auslieferung des verruchten Ketzers zu verlangen. Klimpernde Münzen und eine reichliche Spende von dem beliebten starken Rostocker Bier waren imstande, ein tobendes Geschrei zu entfachen. Die Wortführer des Pöbels tönten gar, Slüter werde den Zorn Gottes und den Bannfluch des hohen Stellvertreters Christi auf die Stadt herbeiführen. Es war zu wilden Szenen gekommen und da die Scharwache, deren Pflicht es eigentlich gewesen wäre, das Haus jedes Bürgers vor ähnlichem Unfug zu schützen, sich wohlweislich nicht blicken ließ, so hätte nicht viel gefehlt, dass die tobenden Kerle in die Wohnung des Baders eingedrungen wären, um dort die ärgsten Exzesse zu verüben. Nur das beherzte Eingreifen des Schiffsbaumeisters Willgaß, der mit einem tüchtigen Haufen schnell gesammelter Schiffszimmergesellen und Matrosen auf den Mob eindrang und mit derben Knüttelhieben auseinanderjagte, rettete im letzten Augenblick die Wohnung des Baders und die darin vereinigten Anhänger der lutherischen Lehre. An jenem Abend fanden in verschiedenen Teilen der Stadt noch einige heftige Prügeleien zwischen den lutherisch gesinnten Arbeitern und dem aufgehetzten Pöbel statt.
Auch Rottmeister Horwath hatte das eine oder andere Mal Slüters Anwesenheit in Rostock aufgespürt und war mit einigen Söldnern der Scharwache ausgezogen, um nach ihm zu fahnden und ihn als Störer der öffentlichen Ruhe festzusetzen. Es hatte viele Mühe gekostet, den Reformator den Nachforschungen des eifrigen Rottmeisters zu entziehen, und manche Bekenner der neuen Lehre waren dadurch in sehr böse Verdrießlichkeiten geraten. So hatte Slüter den schweren Entschluss gefasst, auf den Besuch von Rostock, wenigstens für die nächste Zeit, bis dort wieder bessere Verhältnisse eintraten, zu verzichten. Auch das Vorhaben, auf dem flachen Lande, in einem zwischen Rostock und Güstrow passend gelegenen Dorfe, größere Zusammenkünfte seiner früheren Zuhörer zu veranstalten, um mit ihnen gemeinsamen Gottesdienst zu halten, musste leider unterbleiben. Der größte Teil der mecklenburgischen Ritter, denen die meisten Dörfer gehörten, waren noch der Römisch-Katholischen Kirche blind ergeben und schenkten den Einflüsterungen der Geistlichen, die sich als Pfarrer in den Landkirchen oder auch als Hauskaplan in den Hauskapellen auf den großen Rittergütern befanden, unwidersprochen Gehör. So konnte Slüter nicht daran denken, dass ihm ein Rittergutsbesitzer die Genehmigung erteile, auf seinem Gut eine derartige Versammlung abzuhalten. Er musste sogar befürchten, dass ein Gottesdienst von den Gutsuntertänigen gewaltsam gestört werde, er, wie auch seine Anhänger, am Leben oder doch an ihrer Freiheit bedroht wären, wenn er es wagte, ohne eine derartige Erlaubnis eine solche Zusammenkunft auf irgendeinem ritterschaftlichen Gute abzuhalten. Ein gleich ungünstiges Verhältnis herrschte aber auch auf den zur Stadt Rostock gehörigen sogenannten Kämmereigütern. Die Predigerstellen waren mit fanatischen Papisten besetzt und das rohe hörige Landvolk befand sich in deren Abhängigkeit.
Somit hatte Magister Joachim Slüter im Jahre 1524 leider nur wenig Gelegenheit, mit seinen Freunden und Anhängern in Rostock zu verkehren und dort für die weitere Ausbreitung seiner Lehre zu wirken. Das bereitete Slüter tiefen Kummer, seine Gedanken weilten unablässig bei seinen lieben Freunden und Anhängern in der alten Hansastadt. War er doch von der Hoffnung beseelt, gerade diese gute Stadt werde nicht allein im mecklenburgischen Lande die Wiege der Reformation, sondern weit hinauf an den Gestaden der deutschen Ostseeküste; ihre berühmte Hochschule sei berufen, die Jünger zu bilden, die als Apostel der neuen Lehre hinaus in ferne Länder zögen, Luthers Satzungen zu predigen und das Volk von dem harten Druck des damaligen Papismus zu erlösen.
Außer in der Stadt Rostock selbst hatte Joachim Slüter in Warnemünde eifrige Anhänger gefunden. Die einfachen Seeleute dort, deren Leben ein beständiges Ringen mit dem wilden Meer war, hatten das Luthertum mit offenen Ohren und warmer innerer Begeisterung aufgenommen. Schon als Slüter noch als Lehrer an der Schule der Kirche zu St. Petri weilte, war es ihm liebe Gewohnheit gewesen, an schönen Tagen in raschem Boote auf der Warnow nach Warnemünde zu segeln und dort seine Augen an dem Anblick des unendlichen Meeres zu erfreuen. In Gesprächen mit den älteren Fischern und Lotsen und deren Familien suchte er die neuen Lehren Luthers zu verbreiten. Manch goldenes Körnchen der Wahrheit, was auf empfänglichen Boden fiel, war bei diesen Besuchen ausgestreut worden. Die Warnemünder gehörten einem eingewanderten friesischen Volksstamm an, ihre Charaktereigentümlichkeit trat damals noch scharf hervor und gerade der Drang nach Freiheit, Wahrheit und Recht, der den friesischen Stamm während des Mittelalters so vorteilhaft ausgezeichnet, bewirkte, dass vorzugsweise die Friesen sich überall sehr schnell und mit besonderem Eifer der Reformation anschlossen. Hinzu kam, dass die Pfarrstelle an der Kirche zu Warnemünde schlecht besetzt war. Die Gemeinde war klein und ärmlich, die Stelle daher gering dotiert. Auch der Aufenthalt in dem rauen, unwirtlich gelegenen, im Winter von heftigen Seestürmen umbrausten Ort war überaus unangenehm, und so fanden sich schwerlich Bewerber um so eine geringe, so wenig gewährende Pfarre. In den letzten Jahren hatte man dem Dominikanerkloster zu St. Johannis die Besetzung dieser Stelle überlassen. Den Brüdern aus dem behäbigen Kloster zu Rostock, wo sich die Insassen eines besonders vergnüglichen Wohllebens erfreuen durften, erschien es als Strafe, in das dürftige, einsame Pfarrhaus in Warnemünde versetzt zu werden. Auch der Prior des Klosters betrachtete diese Bestimmung nicht anders. Er sandte gewöhnlich nur Mönche dorthin, mit deren Betragen er nicht zufrieden war, oder die aus irgendeinem Grunde eine Bestrafung erhalten sollten. So weilte seit einigen Jahren ein Pater in Warnemünde, der sich einen schlechten Ruf als roher, unwissender, dem Trunke ergebener Mensch erworben hatte. Er las jeden Morgen gewohnheitsmäßig die Messe, besorgte die übrigen, ihm unumgänglich obliegenden geistlichen Pflichten ganz mechanisch, bekümmerte sich aber im Übrigen nicht im Allermindesten um sein geistliches Amt und um das Seelenheil der Gemeinde, die ihm anvertraut worden war. Der Genuss starker geistiger Getränke war seine Hauptfreude und Beschäftigung. Und wenn er keine andere Gesellschaft zum Trinken bekommen konnte, so verschmähte er selbst die sechs bis acht Söldner der Stadt nicht, welche die Besatzung des festen Turmes bildeten, der unweit der Warnow zur Beherrschung der Schifffahrt erbaut worden war. Solch ein Seelsorger konnte dem frommen Sinn der Warnemünder, der nach innerer Erbauung verlangte, nicht genügen, auch deshalb wandten sie sich weit schneller dem Luthertum zu, als es sonst vielleicht geschehen sein dürfte.
Daher war es auch für die Warnemünder ein Freudentag gewesen, als sich die Kunde verbreitet hatte, Magister Slüter sei zum Prediger der Kirche zu St. Petri in Rostock erwählt worden. So diente der hohe Turm von St. Petri den Seeleuten und Fischern nicht nur als Landmarke, nach der sie sicher steuern können, um die richtige Fahrt zu finden, sondern den Frommen dünkte es eine gute Vorbedeutung zu sein, dass von nun an unter dem schützenden Dach dieser Kirche ein Prediger das Wort Gottes verkünden werde, der ihre Seelen in das richtige Fahrwasser des reinen Glaubens leite und sie dem sicheren Hafen der wahren inneren Ruhe entgegenführe. Von Slüters Ernennung an war die Petrikirche an jedem Sonntag von vielen Warnemündern, Jung und Alt, Weib und Mann, die nur irgendwie abkommen konnten, besucht. Mochte die Witterung auch noch so rau sein, die abgehärteten, an stetes Ungemach des Lebens gewöhnten Menschen machten sich nichts daraus, wenn sie nur die Predigt ihres verehrten Slüters hören konnten. In ihren Booten segelten sie die Warnow herauf. War der Wind zum Segeln ungünstig, so legten sich Männer wie Frauen in die Riemen und ruderten die leichten Fahrzeuge beinahe ebenso geschwind die zwei Meilen nach Rostock hinauf, wie es geblähte Segel vermocht hätten. Mindestens ein Dutzend, oft aber noch eine größere Zahl solcher Boote fuhren Sonntag für Sonntag gen Rostock. Magister Slüter konnte keine andächtigeren Zuhörer, als deren Insassen, unter allen, die den weiten Raum seiner Kirche füllten, zählen. Daher war es für alle Bewohner des Fischerdorfes eine Unglücksbotschaft, als Slüter nach kaum Jahresfrist seine Predigerstelle zu St. Petri wieder aufgeben, ja selbst die Stadt Rostock notgedrungen verlassen musste, um den allzu heftigen Nachstellungen seiner Feinde zu entgehen. Von nun an fuhr kein Boot mit Warnemünder Kirchgängern mehr den breiten Strom hinauf. Da ihr Gottesdienst daheim ihnen jetzt noch weniger denn je behagte, enthielten sich die meisten gänzlich der Teilnahme. Zu Hause hielten sie dafür umso fleißiger religiöse Versammlungen ab, wobei sie fromme Lieder sangen oder sich aus der einzigen Bibel, einem Geschenk Slüters für das Warnemünder Kirchspiel, vorlasen. Gewiss gewährten ihnen die stillen Andachten innere Erbauung, weit mehr Erbauung, als ihnen der Besuch der Messe in ihrer Kirche, die mechanisch von einem angetrunkenen Pfaffen abgeleiert wurde, eingebracht hätte, aber Slüters Predigten wurden dadurch lange nicht ersetzt. Nach so langer Pause verlangte es alle Warnemünder wieder eine solche Predigt zu hören und sich an ihrem reinen Inhalt zu erquicken.
Der katholischen Partei in Rostock war der dem Luthertum zugeneigte Sinn fast aller Warnemünder sehr wohl bekannt, der hatte hier auch wiederholt heftigsten Zorn erregt, allerdings unterließ man es, gewaltsam dagegen einzuschreiten. Warnemünde wurde in jeder Hinsicht hart von der Stadt bedrückt, so dass man es nicht wagte, seinen Bewohnern auch noch in Glaubensdingen Vorschriften zu machen. Wegen der strengen Herrschaft Rostocks hatte sich unter den Warnemündern ohnehin große Unzufriedenheit breitgemacht. Einige Male hatten sie bereits erklärt, wenn man sie fernerhin so gängle, so würden sie ihre kleinen Häuschen verlassen und auf ihren Booten mitsamt ihren Familien nach dem benachbarten Holstein segeln, wo man sie als tüchtige Seeleute gewiss mit offenen Armen aufnehme. Den Rostockern jedoch waren die Warnemünder als verlässliche Lotsen, tüchtige Matrosen und fleißige Versorger der städtischen Haushaltungen mit Seefischen und weißem Seesand unentbehrlich. Ihr Wegzug hätte der Stadt großen Schaden zugefügt und viele Interessen benachteiligt und so beschloss ein Hoher Rat wohlweislich, alles aufzubieten, damit die Drohung nicht in die Tat umgesetzt werde. In einer hitzig geführten Ratsversammlung hatten die eifrigsten Papisten zwar den Antrag gestellt, man möge gegen die aufsässigen Warnemünder mit aller Strenge einschreiten, ihnen ihre häuslichen Andachten verbieten und sie nötigenfalls mit Gewalt in den Schoß der allein seligmachenden Römisch-Katholischen Kirche zurückzuführen, doch waren diese Vorschläge mit großer Stimmenmehrheit abgelehnt worden. Selbst der alte Rats- und Handelsherr Niclas Wulf, so eifrig er auch sonst in jeder Hinsicht der papistischen Partei zugetan war, hatte sich mit Entschiedenheit gegen alle derartigen Gewaltmaßregeln ausgesprochen und den Untergang Warnemündes verkündet, wenn so etwas geschehen sollte. So ließ denn ein Hoher Rat die kirchlichen Zustände so fortbestehen, ohne sich eben allzu viel darum zu bekümmern und dies war denn auch das Beste, was er unter den obwaltenden Verhältnissen tun konnte.
Der Winter des Jahres 1525 begann mit einer ungewöhnlich frühzeitigen Strenge hereinzubrechen. Schon Mitte November bedeckte tiefer Schnee alle Felder, die Warnow fing an, in Eis zu gehen, und die Schifffahrt konnte als geschlossen angesehen werden. An den sicheren Pfählen des Hafens zu Rostock lagen in langen Reihen die abgetakelten Schiffe nebeneinander, die sonst in kühner Fahrt die verschiedenen Meere durchkreuzten. Müßiges Seevolk trieb sich überall umher. In Warnemünde zeigten sich alle Hütten so angefüllt, wie es während der guten Jahreszeit niemals der Fall war. Kräftige Männer, junge Burschen bis hin zu den Halbwüchsigen, die schon als Schiffsjungen weit hinaus in die See mussten, kamen von den abgetakelten Fahrzeugen zurück in die Heimat, um dort auf wenige Monate die schwer verdiente Ruhe zu genießen. Der Fischfang in der See konnte bei dieser rauen Witterungszeit nur an vereinzelten, besonders günstigen Tagen betrieben werden und auch die Fahrt mit den Booten den Fluss hinauf nach der Stadt war wegen des vielen Treibeises so beschwerlich, ja gefährlich, dass sie nur in Ausnahmefällen unternommen wurde. Da saßen denn die Menschen in den kleinen niedrigen Stuben eng um den warmen Ofen zusammengedrängt, um, so gut es gehen wollte, die verschiedenen Arbeiten für den Fischfang herzurichten. Die Frauen spannen am Kunkel Flachs und Heede zu Garnen für die vielen Netze, oder Wolle zu Strümpfen und warmen Unterwämsern, indessen die Männer sich mit dem Knüppern der Netze oder auch mit allerlei Holzschnitzereien für häusliche Zwecke beschäftigten. Glasscheiben waren in den Wohnungen der Warnemünder nirgends zu finden, das Tageslicht fiel durch getrocknete ausgespannte Fischblasen, und wo es an diesem schlichten Mittel fehlte, vertraten Holzläden deren Stelle. So herrschte denn den ganzen Tag Finsternis in den niederen Stuben mit den kleinen Fensterluken. Kienholzspäne oder mit Tran gefüllte Lampen brannten bei der häuslichen Arbeit ununterbrochen. Und während draußen ein Nordoststurm nach dem anderen mit ungebrochener Gewalt über das Meer brauste und an den räucherigen Hütten rüttelte, fühlten sich deren Bewohner trotz der groben Nahrung, die zumeist aus getrockneten Fischen und Grütze bestand, recht traulich und behaglich. Schon das Gefühl, in ruhiger Sicherheit auf festem Boden weilen zu dürfen, statt draußen auf schwankendem Schiff ein Spielball der wild empörten Elemente zu sein, verlieh den Seeleuten und Fischern ein seltenes Behagen. Dazu der Genuss des lange entbehrten Familienlebens, dem sie sich im Winter wenigstens auf Wochen in ungestörter Ruhe hingeben durften! Die Mehrzahl der Männer war ja den größten Teil des Jahres auf der wogenden See beschäftigt gewesen, da hatte die Gattin den Gatten, die Mutter den Sohn, die Braut den Verlobten häufig auf lange Monate entbehren müssen, ohne zu wissen, auf welchem Meere er inzwischen segelte. Mit banger Sorge waren alle um die Abwesenden erfüllt gewesen, wenn gewaltige Stürme tobten oder eine unsichere Kunde in den Ort drang, in diesem oder jenem fernen Meere sei eine ganze Flottille hansischer Kauffahrer untergegangen, oder die frechen Seeräuber hätten viele Schiffe gekapert, oder auch die Kämpfe, die zu jener Zeit in Dänemark und Skandinavien das Land zerrütteten, hätten auch manchen fremden Fahrzeugen Verderben bereitet. Die Briefbeförderung war im Verkehr nach überseeischen Ländern in der Regel nur vom Zufall abhängig. Nur durch gerade absegelnde Schiffe wurden etwaige Briefe befördert, mussten oft die größten Umwege von Hafen zu Hafen nehmen, um ihr Ziel zu erreichen. Oft konnten Wochen, ja selbst Monate vergehen, bevor der Rostocker Kaufherr die Kunde erhielt, dass sein Schiff oder seine Fracht in Drontheim oder Riga, oder in einem hispanischen oder englischen Hafen eingelaufen sei. Die Warnemünder, ohnehin der schweren Kunst des Schreibens allzu oft unkundig, erfuhren vom Schicksal der Ihrigen selten früher etwas, als bis das Schiff, das den Angehörigen an Bord genommen, glücklich in den Hafen einlief. Aber gerade diese Ungewissheit während der langen Trennungszeit erhöhte jetzt die Freude bei dem kurzen Beisammensein. Zur Zeit der Wintermonate war es allen Familiengliedern vergönnt im engen Verein miteinander zu leben, bis dann die ersten Frühlingstage die Männer wieder hinaus auf das wogende Meer trieben, nur zu oft auf Nimmerwiedersehen.
Bei aller Rauheit und Festigkeit des äußeren Auftretens, wie es der Seemannsberuf mit sich bringt, herrschte aber bei den Warnemündern ein vortreffliches Familienleben und besonders beim weiblichen Geschlecht eine seltene Reinheit der Sitten. Jetzt während des Winters wurden auch Verlobungen gefeiert und Hochzeiten ausgerichtet. Unter den ledigen Töchtern des Fleckens zeichnete sich Gundula Wegner, die einzige Tochter des alten Seefischers und Lotsen Wegner, in jeder Hinsicht aus. Sie galt nicht nur als das stattlichste und hübscheste, sondern auch fleißigste und tüchtigste Mädchen im ganzen Ort und wenn auch unter deren Bewohnern nicht viel von Vermögen die Rede sein konnte, so wurde doch angenommen, dass der Alte seiner Tochter einen guten Hausstand einrichten und ein festes Boot zur Aussteuer mitgeben könne.
So hatte es Gundula nicht an Bewerbern gefehlt und auch beim Beginn dieses Winters näherte sich ihr ein junger Matrose mit der unverkennbaren Absicht, um ihre Hand anzuhalten. Fritz Ohlsen, der Sohn des Nachbars rechts von Wegner, war ein hübscher, stattlicher Bursche, so kräftig und kühn, wie nur je ein Matrose auf einem hansischen Schiffe gefahren sein mochte. Nach Warnemünder Art war er bereits mit dem 14. Lebensjahr auf die See gegangen, seitdem nur selten zum kurzen Besuch heimgekehrt. Er fuhr größtenteils auf hamburgischen Schiffen, die in das Mittelmeer segelten und hatte manche gefährliche Fahrt und manch verzweifelten Kampf mit raublustigen Barbaresken bestanden. Wohl an die fünf Jahre war er nicht in seiner Heimat gewesen, als er jetzt plötzlich beim Beginn des Winters unerwartet in seinem Geburtsort erschien. Seine Ankunft erregte nicht allein im Elternhause, wo man ihn schon längst verloren geglaubt hatte, die lebhafteste Freude, in Warnemünde wohnten einige, die an der Heimkehr des stattlichen Burschen Anteil nahmen. War er doch ein Seemann, der seinem Vaterlande zum Stolz gereichte. Seine Haut hatte den bronzenen Ton angenommen, der sich bei langem Aufenthalt unter südlicher Sonne einstellt. Auch seine Tracht mit der bunten Seidenschärpe, worin ein krummer, reich blitzender Türkensäbel steckte, den er einst im Enterkampf von einem algerischen Korsaren erbeutet hatte, trug dazu bei, das Fremdländische seiner Erscheinung zu betonen. Die Warnemünder Mädchen freuten sich, wenn sie des Abends in den Spinnstuben zusammenkamen, dort auf den munteren Fritz trafen und seinen lustigen oder auch grausigen Erzählungen über Abenteuer lauschten, die er unter Heiden und Türken erlebt hatte. Und als bekannt wurde, Fritz Ohlsen habe einen großen Lederbeutel voll blanker, spanischer Dublonen aus der Fremde mitgebracht und erklärt, er sei des Umherschwärmens in der Ferne überdrüssig, wolle sich ein Häuschen in der Heimat bauen, ein Leichterschiff kaufen, eine hübsche wirtliche Jungfer zum Eheweib nehmen und sich häuslich niederlassen, da war keine, die sich nicht im Stillen wünschte, seine Wahl möge gerade auf sie fallen. Aber der Gerngesehene schien sich um die Andeutungen, er solle mit einem Heiratsantrag nur an diese oder jene Tür klopfen, die werde ihm gewiss bereitwillig aufgetan, wenig zu kümmern. Nur die Nachbarstochter, Gundula Wegner, schien er besonders gerne zu sehen, sonst war er gegen alle Mädchen gleich freundlich und lustig und zeichnete keine mehr oder weniger aus. Gundula jedoch war diejenige, die sich gegen ihn weit spröder und zurückhaltender benahm als jede andere; die, als sie die sichtbare Annäherung bemerkte, seine Nähe offenbar floh. Die Nachbarn Wegner und Ohlsen hätten es zwar gern gesehen, wenn ihre Kinder einen Ehebund miteinander schlössen, die beiden Alten hatten sogar wiederholt darüber gesprochen, allein Gundula schien dazu nicht die mindeste Neigung zu fühlen.
Seit jenem Aprilabend im Jahre 1523, wo der junge Schiffer Hinrich Wulf Gundula gestanden hatte, wie sehr sie sein Herz berühre, war mit dem früher so unbefangenen Mädchen eine Veränderung vor sich gegangen. Mit dem Geständnis hatte sich Gundulas Welt gewandelt, denn auch sie liebte Hinrich aus vollem Herzen und sie war entschlossen, ihm diese Liebe für alle Zeit ihres Lebens mit unverbrüchlicher Treue zu halten. Zwar war sie sich bewusst, wie gewaltig die Hindernisse waren, die sich der Verbindung zwischen ihr und dem Geliebten entgegenstellten, denn es wäre ein bisher unerhörter, ja kaum denkbarer Fall gewesen, dass der Sohn eines angesehenen, reich begüterten Rostocker Geschlechtes, wie das Wulf’sche, eine niedere Warnemünder Fischertochter als sein Eheweib heimführe. Aber auch hierdurch wurde sie nicht im Geringsten in ihren Gefühlen erschüttert. Sollte Hinrich Wulf ihre Hand nicht erhalten dürfen oder können, dann werde sie unvermählt bleiben und bei der Festigkeit ihres Charakters war nicht davon auszugehen, dass sie diesen Entschluss zurücknehme.
Aber nicht allein die Hoffnungslosigkeit ihrer Liebe, auch die Ungewissheit über das Schicksal des Geliebten trübte jetzt Gundulas Sinn. In den langen Jahren ihrer Trennung war ihr keine direkte Nachricht über Hinrich Wulfs Schicksal zugekommen und was auf Umwegen zu ihr gelangt war, hatte ihr tiefen Kummer bereitet. Vor zwei Jahren war in Rostock, auf der Wulf’schen Schreibstube, die Hiobsbotschaft eingelaufen, dass der junge Hinrich im Kampfe mit einem Raubschiff schwer verwundet worden sei und mit dem Tode ringe. Die geschwätzige Fama brachte die böse Kunde von Rostock nach Warnemünde und träufelte ihre Neuigkeiten, gewürzt mit allerhand schauerlichen Mutmaßungen, in Gundulas Herz. Das junge Mädchen musste alle Kraft aufbieten, seinen Schmerz, seine tiefe Trauer zu verbergen.
Es bat die Mutter, den Fischverkauf in Rostock selbst besorgen zu dürfen, um sich unter dem Vorwand, beste und frischeste Ware feilzubieten, Zutritt zum Wulf’schen Hause zu verschaffen. Über dessen Schwelle zu gelangen, war jedoch einfacher als gedacht, denn die eichenen Torflügel standen sperrangelweit offen. Gundula musste nur achtgeben, nicht unter die Räder der Fuhrwerke zu geraten, die über die Diele des stattlichen Kaufherrensitzes rumpelten. Bei den Hausgenossen fragte sie schüchtern, ob die Näheres über den Vorfall wüssten und zu ihrem Schrecken erfuhr sie sehr viel mehr als erwartet: Alle Einzelheiten der Verwundung wurden vor ihr ausgebreitet, außerdem trafen noch andere traurige Nachrichten ihr Ohr. Es kostete die Arme Kraft, die Tränen im Wulf’schen Hause zu unterdrücken. Für ihre Blässe und ihre schwankende Haltung machte sie notgedrungen ein plötzliches Unwohlsein verantwortlich. Anna, die Tochter des Kaufherrn Niclas Wulf, brachte dem hübschen, bescheidenen Fischermädchen zur Stärkung einen Becher voll Würzwein, ohne im Entferntesten zu ahnen, was der eigentliche Grund der augenblicklichen Erkrankung sei.
Gundula eilte, so schnell ihre Füße sie nur tragen konnten, aus dem Wulf’schen Hause fort hinüber in die nahe Kirche zu St. Marien. Dort warf sie sich vor dem Altar auf die Knie. Sie erflehte im inbrünstigen Gebet vom höchsten Lenker des Schicksals aller Menschen die Heilung des Geliebten und dessen ferneres Wohl. Die ständige Wiederholung ihrer Fürbitte vermochte es, sie ein wenig zu beruhigen. So erhob sie sich und verließ das Gotteshaus gestärkt, zumindest mit Hoffnung im Herzen. Ihre Wangen waren etwas bleicher, der Glanz ihrer Augen schwächer als gewöhnlich, doch hätte niemand geahnt, welch tiefer Schmerz dem einfachen Fischermädchen zusetze, so aufrecht war seine Haltung und so kräftig seine Schritte.
Auch wenn Gundulas Herz aus tiefster Wunde blutete, so ging sie doch tagsüber der strengsten Arbeit nach. Nur wenn sie am Abend im stillen dürftigen Kämmerlein auf ihrem harten Seetanglager saß, gedachte sie ungestört des Geliebten, der im fernen Norden einsam und krank daniederlag. Dann sandte sie ihre Gebete für Hinrichs Genesung zum Himmel empor.
Im Laufe der Zeit erhielt Gundula noch schlimmere Nachrichten: Im Spätherbst 1523 kam plötzlich und unerwartet die „Greif von Rostock“ mit reicher Ladung von Drontheim zurück in den Warnowhafen. Was half es aber, wenn Gundula ungeachtet des eisigen Nordwindes dem in schneller Fahrt einsegelnden Schiff entgegenstürzte, ihre Augen entdeckten den so sehnlich Erwarteten nicht an Bord. Hinrich Wulfs schwere Wunde war noch nicht so weit geheilt, als dass es ihm möglich gewesen wäre, die Reise nach der Heimat mitzumachen. Einige Warnemünder, die auf der Greif als Matrosen dienten, erzählten später, ihr früherer Schiffer sei noch nicht von seinem Leiden genesen und müsse in der Ferne wohl noch lange auf dem Krankenlager ausharren. Das war eine traurige Kunde für das treu liebende Mädchen und es wurde ein weiteres Mal geprüft, als es im nächsten Frühjahr erfuhr, dass der Arzt in Drontheim dem Verwundeten eine längere Reise in ein wärmeres Klima empfohlen habe. Der alte Herr Niclas Wulf habe seinem Sohn eine Führerstelle auf dem Schiff eines Lübecker Reeders vermittelt, das von Norwegen aus mit Stockfischen nach Hispanien segle und ihr Hinrich befinde sich jetzt schon auf der Fahrt dorthin. So hatte Gundula selbst im günstigsten Falle keine Hoffnung, den Geliebten vor Jahresfrist wiederzusehen. Doch so sehr sie sich in der Stille sorgte und härmte, ihre Ausdauer in der Treue wurde dadurch nicht erschüttert. Ihre Standhaftigkeit blieb stets die gleiche.
So hatte denn Fritz Ohlsen auch nicht die mindeste Aussicht, Gundulas Herz und Hand zu erringen, und hätte er gewusst, welche Hindernisse ihm im Weg standen, er würde schwerlich sein Werben mit solchem Eifer fortgesetzt haben. Jedoch die große Sprödigkeit und ernste Zurückhaltung des hübschen jungen Mädchens reizte seinen Stolz und entflammte seine Leidenschaft mehr und mehr. Der lange Winter lag noch vor ihm, wo sich täglich die Gelegenheit ergab, stundenlang in Gundulas Gesellschaft zu verkehren, bevor der Frühling ihn wieder auf die See hinausrief. Deshalb hoffte er, es werde ihm während der Wintermonate gelingen, das kalte Eis, das ihre Brust zu umpanzern schien, durch die Wärme seiner Liebe fortzuschmelzen.
Die frommen Warnemünder fanden zwar während ihrer Hausandachten, die allmorgendlich in den meisten Familien abgehalten wurden, innere Erbauung, aber sie sehnten sich doch danach, wieder einmal eine Predigt ihres hochverehrten Slüters zu hören. Erst recht jetzt im Winter, wo so viele junge Seeleute, die während des Sommers auf ihren Fahrten jeden Gottesdienst entbehren mussten, daheim waren.
Der alte Fischer Wegner, Gundulas Vater, war unter den Warnemündern einer der eifrigsten Verehrer Slüters. Wegner war überhaupt eine gewaltige, alles mit Eifer erfassende Natur, und selbst seine grauen Haare hatten die Heftigkeit seines Blutes noch nicht abzukühlen vermocht. Hinzu kam, dass Wegner in seiner Jugend bei seinen wilden Kreuz- und Querfahrten als Matrose vielleicht kein allzu frommes, Gott wohlgefälliges Leben geführt haben mochte und dadurch umso mehr den inneren Drang fühlte, das früher Versäumte im späteren Lebensalter nachzuholen. So war denn in der Zeit, wo Slüter noch als Prediger in Rostock weilte, kein Sonntag vergangen, an dem Wegner nicht in seinem Boot die Warnow hinauffuhr, um dessen Predigten mit wahrer innerer Andacht beizuwohnen. Jedes Mal kehrte er geistig gestärkt zurück. Auch sein Nachbar Ohlsen war ein besonders eifriger Lutheraner geworden, und so ergab es sich fast von selbst, dass häufig, wenn die Alten in den langen Abendstunden des Novembers sich gegenseitig besuchten, um einige Stunden zu verplaudern, das Gespräch auf Slüter und dessen Predigten kam.
„Muss wirklich ein ganz seltener Mann sein, dieser schwarzröckige Magister Slüter. Wahrhaftig, wenn man euch beiden Alten so von ihm reden hört und vernimmt, dass ihr ein ebenso heißes Verlangen nach seinem Besuch habt, wie ein frischer Matrose nach einem Kuss von seinem Mädchen, steigt bei mir der Wunsch auf, solchem Wundermann einmal ins Auge zu sehen, obgleich ich sonst einem Pfaffen lieber aus dem Wege gehe, als ihn aufzusuchen“, rief der junge Olsen ungeduldig, als er sich bei einem ähnlichen Gespräch der beiden Alten zu langweilen begann.
„Magst an deinem Platze sein, Fritz, wenn es gilt, bei Sturm und dunkler Nacht auf die Spitze des Bugspriets hinaus zu müssen, um ein Segel zu bergen, aber über geistliche Dinge zu spotten, das ziemt dir nicht. Weißt du, Magister Slüter ist ein Mann, dem du und zehn deinesgleichen nicht wert seid, nur die Schuhriemen aufzulösen“, entgegnete Wegner in ernstem Ton auf die leichtfertig hingeworfenen Worte. Auch der Blick, den Gundula dem jungen Mann ob dieser Rede zuwarf, war nichts weniger als freundlich.
„Nehmt ’s nicht für ungut. Hab wahrlich nicht die Absicht gehabt, über euren Slüter zu spotten“, verwahrte sich Fritz betroffen über die Missbilligung seiner Worte. „Aber wenn euch so viel daran liegt, Slüter zu hören, warum ladet Ihr ihn nicht zu uns nach Warnemünde ein, uns eine Predigt zu halten. Von Güstrow bis nach Rostock ist es doch keine weite Fahrt, und von dort holen wir ihn in einem Boot sicher zu uns her. Wer sollte uns hier stören? Die wenigen Söldner des Rats dort im Turm doch gewiss nicht. Die Kerle sind froh, wenn wir sie selbst ungestört lassen. Sollten sie es wagen, sich im Geringsten mausig zu machen, sperren wir sie leicht in ihrem eigenen Turm ein. Aus der Stadt selbst kommt um diese Zeit so leicht niemand hierher, und wenn der Rat es wagen würde, uns seine Scharwache unter diesem Hallunken Horwath zu schicken, nun, dann sollen sie Hiebe kriegen, dass sie am Leben verzagen und so bald nicht wieder ihre Nase nach Warnemünde hereinstecken. Hier sind jetzt an 70 bis 80 Mann junges lediges Seevolk beisammen. Damit schlagen wir alle Pfaffenknechte aus dem Orte heraus, wenn sie sich wirklich bei uns blicken ließen“, rief Fritz Ohlsen, sichtlich bemüht, den schlechten Eindruck seiner früheren Worte bei Gundula und deren Vater vergessen zu machen.
„Der Junge hat wahrhaftig keinen schlechten Einfall! Ja, wenn es möglich wäre, den Herrn Magister zu einem öffentlichen Gottesdienst zu bewegen, das sollte für uns Warnemünder ein rechtes Fest sein, wie wir es seit Jahren nicht mehr erlebt haben“, rief der alte Wegner aus. Allein der Gedanke an ein solches Vorhaben erfreute ihn und verlieh seinem wettergegerbten Gesicht große Lebendigkeit.
„Ja, wenn es geschehen würde, wäre es freilich gut, aber es wird nicht so kommen. Wer soll den Herrn in Güstrow einladen, wie können wir ihm zumuten, jetzt in dieser rauen Jahreszeit den weiten Weg von dort bis zu uns armen Leuten nach Warnemünde zu machen“, meinte kopfschüttelnd und zweifelnd der bedächtige alte Ohlsen.
„O gewiss, der Magister kommt, wenn wir ihn nur dringend bitten. Er ist ein so guter, echt christlich gesinnter Mann, der auch dem Geringsten nichts abzuschlagen vermag“, mischte sich plötzlich Gundula in das Gespräch. Ihr bleiches Gesicht erhielt unter dem Gedanken, Slüter komme vielleicht in den bescheiden Fischer- und Lotsenort, ein wenig Farbe.
Der rosige Schimmer der Freude auf Gundulas Wangen war Fritz nicht verborgen geblieben und spornte seinen Eifer an, den unbekannten Prediger, der ihm im Grunde gleichgültig war, zu einem Besuch in Warnemünde zu bewegen.
„Wisst, lasst die Gundel, die ja schreiben kann, einen Brief an den Magister abfassen, worin er dringend zum Abhalten einer Predigt gebeten wird, und ihr alle unterzeichnet mit eurem Handzeichen. Mit diesem Brief machen wir uns: der Jochen Ohlmann, meine Wenigkeit und noch zwei andere kräftige Kumpane von mir, die ich schon aussuchen will, auf den Weg nach Güstrow. Bis Bramow fahren wir mit dem Boot, dort mieten wir uns einen Wagen von einem Bauern, fahren nach Güstrow und übergeben dem Magister eure Einladung und bitten ihn recht von Herzen, dass er sie annehmen möge. Unter unserm Schutze soll er sicher reisen, ebenso werden wir ihn wieder ungefährdet zurückgeleiten, und wenn die Rostocker Papisten es wagen sollten, ihm auch nur ein Haar auf dem Kopfe zu krümmen, stehen wir Seefahrer hier Mann für Mann zu seinem Schutze auf und wollen ihn schon verteidigen“, rief Fritz und seine Augen blitzten feurig.
Sein Vorschlag fand immer mehr Beifall. Noch am selben Abend gingen die beiden alten Männer zu mehreren angesehenen Lotsen und Fischern, um deren Meinungen über die Einladung Slüters nach Warnemünde, damit der hier eine öffentliche Predigt halte, einzuholen. Zwar gab es noch manches „Wenn“ und „Aber“ zu besiegen, der eine oder andere Einwand zu widerlegen, jedoch am andern Morgen war der Plan mit großer Mehrheit angenommen, eine eigene Deputation mit der dringenden Bitte an Slüter abzuschicken, auf einige Tage nach Warnemünde zu kommen und hier einen Gottesdienst zu feiern.
Weil auch Gundula sich voller Begeisterung für das Unternehmen aussprach, erklärte sich Fritz gern dazu bereit, die Stelle eines Abgesandten zu übernehmen. Nicht lange danach saß Gundula über einem Stück Papier, das eilig herbeigeschafft worden war, und mühte sich, einen halbwegs leserlichen Brief aufzusetzen. Gleichwohl sein Inhalt kurz und einfach ausfiel, hatte Gundula mit dem Abfassen einige Mühe gehabt und sie trug sich mit großer Sorge, ob er den Erwartungen der Warnemünder genüge. Aber es gab niemanden im ganzen Ort, der ihr die Schreibarbeit hätte abnehmen können oder annähernd über so viele Kenntnisse verfügte, ihren Brief zu bekritteln.
Ihr Vater erzählte lachend, er wolle in derselben Zeit, währenddessen seine Tochter ein kleines Blatt Papier mit schwarzen Krähenfüßen bekritzele, gern ein volles Sandboot hin und zurück nach Rostock rudern und würde dabei lange nicht so viel Schweißtropfen vergießen und Anstrengung haben wie Gundula bei ihrer Schreibarbeit.
Fritz Ohlsen fand unter den jüngeren Matrosen, die zu seinen Freunden zählten, vier rüstige, mit Wehr und Waffen versehene Begleiter, auf deren Zuverlässigkeit er sich unbedingt verlassen konnte, falls irgendwelche Papisten etwas gegen Magister Slüters Reise einzuwenden hätten. Geleitet von den besten Wünschen aller Einwohner fuhr die seltsame Deputation in einem raschen Boot nach dem Dorfe Bramow ab, um dort gegen Geld und gute Worte einen Bauern zu bewegen, einen vierspännigen, mit Strohsäcken versehenen Leiterwagen für eine Fahrt nach dem vier Meilen entfernten Güstrow herzugeben.
Magister Joachim Slüter war in seinem kleinen dürftigen Arbeitsstübchen zu Güstrow mit dem Studium theologischer Schriften beschäftigt. Sein Erstaunen über den unerwarteten Besuch von einem halben Dutzend Matrosen war groß. Zumal die wildbärtigen rauen Seefahrer einen Schreck erregenden Anblick boten. Vor allem ihre gewichtigen Harpunen in kräftigen Fäusten, Enterschwerter in schwarzen Lederscheiden und ihre langen Pistolen trugen zu diesem Eindruck bei.
Fritz Ohlsen machte den Sprecher, und obgleich anfänglich mit Verlegenheit, wusste er seine Bitte bald gewandt und beredt vorzutragen. Zu seiner Hilfe überreichte er gleich zu Anfang Gundulas Schreiben.
Slüter las gerührt die in eckigen, ungelenkigen Buchstaben auf grobem Papier geschriebenen Worte, die in einfacher, aber inniger und aus vollem Herzen kommender Sprache die dringende Bitte an ihn richteten, doch nach Warnemünde zu kommen und die dortige Gemeinde, die mit fester Treue zu ihm stehe, mit einen Gottesdienst zu erquicken und zu trösten. Bereits während seines Aufenthalts in Rostock war ihm das hübsche, sittsame Fischermädchen durch das Edle ihrer Erscheinung vorteilhaft aufgefallen, so dass er sich nach ihrem Namen erkundigt und wiederholt einige freundliche Worte mit ihr gesprochen hatte. Gundulas Brief entschied sogleich Slüters Entschluss, dem Wunsch zu entsprechen, in Gesellschaft der Matrosen nach Warnemünde zu fahren und dort eine gemeinsame Andacht zu feiern. Zwar war die Fahrt im rauen, eisigen Novembermonat bei grundlosen Wegen auf einem offenen Wagen und später die Warnow herunter im Boot ungemein beschwerlich, doch dies konnte Slüter nicht von seinem einmal gefassten Entschluss abbringen. Er war der einfache Sohn des Volkes, sein ganzes Leben bestand aus einer Kette von Entbehrungen und Einschränkungen, er war es von jeher gewöhnt, jeglichem Wetter zu trotzen und dessen Ungestüm nicht zu achten, sobald es eine Pflicht zu erfüllen galt. Auch die etwaige Gefahr dieser Reise und die Möglichkeit, dass seine zahlreichen Feinde in Rostock die günstige Gelegenheit seiner Anwesenheit in Warnemünde zu einem Angriff auf sein Leben benutzen mochten, schreckte ihn auch dieses Mal nicht im Geringsten. Gleich seinem Lehrer Luther kannte Slüter kein Bedenken und scheute auch nicht die größte persönliche Gefahr, wenn es galt, die reine Lehre zu verbreiten und ihr neue Anhänger zuzuführen.
Zum größten Jubel der Matrosen, der sich besonders bei Fritz Ohlsen laut und lebhaft Luft machte, nahm Slüter die Einladung an. Er gab den jungen Männern zu verstehen, er werde sie bereits am nächsten Morgen nach ihrem Heimatort begleiten, um dort eine Predigt zu halten.
Die Anwesenheit der so eigentümlich gekleideten, zudem stark bewaffneten Seeleute, ihr lautes, tobendes Wesen, konnte in Güstrow nicht unbemerkt bleiben. Auch erzählten die augenfällig Fremden ohne Scheu und Vorsicht, was sie herführe. Da konnte es gar nicht ausbleiben, dass die Kunde vom Ziel und Zweck der Reise des Reformators auch in die Ohren von Leuten drang, die Magister Joachim Slüter bitter hassten. Schnell wurde beschlossen, den Magister auf dieser Fahrt heimlich ermorden zu lassen. An wilden Strolchen und beutelustigen Kerlen, die einen offenen Überfall auf der Landstraße für ein billiges Handgeld übernahmen, fehlte es nicht, wo selbst ein Teil des niederen Adels vom Stegreif lebte und so seine besten Einkünfte bezog. So waren denn noch am Abend ein halbes Dutzend bekannte Schufte angeworben worden, sich am nächsten Morgen in einen Hinterhalt bei einem dichten Wald zwischen Güstrow und Schwaan zu legen, dort Slüter meuchlings zu überfallen und möglichst niederzumetzeln.
Die Gefahr nicht ahnend, fuhr Slüter mit seinen Begleitern auf dem großen Leiterwagen, gut verpackt gegen die strenge Kälte, in der grauenden Morgendämmerung aus den Toren Güstrows. Die Wege waren so schlecht, dass der Wagen nur langsam vorankam, und so war es fast neun Uhr morgens geworden, als eine dichte Waldstelle erreicht wurde. Plötzlich erhob sich wütendes Geschrei, die Büsche rechts und links des Hohlweges gerieten in Bewegung, vermummte Gestalten sprangen auf den Weg und die Erste feuerte in vorschnellem Eifer ihr Faustrohr ab.
Slüter, der auf dem vordersten Strohsack saß, griff sich an den Kopf, aber die Kugel war dem Magister nur durch die Mütze gefahren und hatte gottlob keinen weiteren Schaden angerichtet.
Die Warnemünder Seeleute schienen auf so eine Gelegenheit, ihre Kampfkünste unter Beweis zu stellen, nur gewartet zu haben. Mit lautem Zorngeschrei sprangen sie vom Wagen und auf die Angreifer zu. Die hatten mit so einem kräftigen Widerstand nicht gerechnet und liefen bald in wilder Flucht in das Dickicht zurück. Fritz Ohlsen setze dem Kerl nach, der den Schuss abgefeuert hatte, holte ihn ein und streckte ihn mit einem gewaltigen Hieb seiner Harpune zu Boden. Mit zertrümmertem Schädel lag der Schurke in seinem Blute und röchelte sein Leben aus. Wie es sich herausstellte, war er ein berüchtigter Strolch und Wegelagerer, der die Landstraßen lange Zeit unsicher gemacht hatte. Slüter musste gewahr werden, der Hass seiner Gegner sei bereits so groß, dass sie selbst die Gemeinschaft mit solchen Menschen nicht verschmähten, nur um ihn aus dem Weg zu räumen.
Auch ob des Sieges über die Wegelagerer wollte sich bei ihm keine Genugtuung einstellen, das schmähliche Ende des gedungenen Mordgesellen stimmte ihn nicht froh, sondern traurig, besonders der Umstand, dass seinetwegen ein Mensch getötet worden war, schmerzte ihn tief.
Seine Begleiter, die an raue Kämpfe gewöhnt waren, kannten solche Skrupel nicht. Der kleine Zwischenfall schien ganz nach ihrem Geschmack gewesen zu sein, sie spotteten über die Feigheit der Wegelagerer und bedauerten nur, dass es nicht zu einem längeren Kampf gekommen sei, bei dem sie noch mehr gewichtige Hiebe hätten austeilen können. Es wurde beschlossen, über das Gefecht vorläufig keine Anzeige zu machen und den Erschlagenen im Holze liegen zu lassen, wo Füchse und zahlreiche Wölfe seine Vertilgung schon besorgen würden.
Slüter und seine Begleiter gelangten ohne weitere Zwischenfälle nach Bramow, wo man sogleich das Boot bestieg und trotz der Dunkelheit und strengen Kälte die Segelfahrt nach Warnemünde antrat. Im Hause des alten Fischers und Lotsen Wegner fand der Gast ein einfaches und warmes Unterkommen. Die Herzlichkeit der Aufnahme von Seiten aller Hausgenossen musste all das ersetzen, was das Quartier an Annehmlichkeiten entbehrte. Besonders Gundula war hoch erfreut, Magister Slüter im elterlichen Hause bedienen und zu seinem Wohlergehen beitragen zu können. Ein warmer Dank aus ihrem Munde belohnte auch Fritz Ohlsen für die Geschäftigkeit und Umsicht, die er bei der Begleitung des Predigers bewiesen hatte.
Die fanatisch-päpstliche Partei der Stadt Rostock glaubte, mit Slüters Weggang sei das verruchte Ketzertum vollständig ausgerottet. Doch ihre Anhänger mussten sich bald davon überzeugen, dass man sich hierin geirrt habe. Die Samenkörner, die der Vertriebene ausgesät hatte, fanden einen zu günstigen Boden, als dass sie hätten verdorren können. Die Gesinnung des Bürgertums an der deutschen Ostseeküste ließ sich in der einmal gefassten Überzeugung nicht so leicht wankend machen. Fast alle, die sich zu der neuen Lehre Luthers hingewandt hatten, blieben ihr auch nach der Entfernung ihres Lehrers mit unerschütterlicher Festigkeit treu. Zwar suchten die eifrigen Papisten, unter denen sich Pater Rothstein vom Dominikanerkloster St. Johannis und auch Ratsherr Cordes durch ihren unangemessenen Eifer besonders hervortaten, die Anhänger der neuen Lehre auf jegliche Weise zu verfolgen, aber nur in den seltensten Fällen hatte ihr Bestreben Erfolg. Die unleugbare Rednergabe des Paters füllte zwar stets die Kirche. Die Zahl seiner treuen Verehrer, zumal unter den Frauen und Töchtern der angesehenen Geschlechter, war immer noch groß, doch auf der anderen Seite erbitterte sein Fanatismus, sein zornwütiger Eifer vermochte nicht zu überzeugen oder gar zu versöhnen. Er begann seine Predigten regelmäßig damit, dass er die neue Lehre und deren Gründer, Dr. Martin Luther, feierlich verfluchte und seine Zuhörer mit heftigen Worten ermahnte, sie möchten ihre Gebete zu Gott wenden, dass Luther und alle seine Jünger, besonders der verruchte Slüter, ebenso öffentlich verbrannt würden, wie Huß zu Konstanz und manche andere Ketzer, die diese wohlverdiente Strafe glücklicherweise getroffen habe. Sowie der Pater bemerkte, dass einer seiner Zuhörer kein Paternoster oder keinen Rosenkranz in der Hand hielt, sondern ein Buch, worin er die verpönte lutherische Bibelübersetzung argwöhnte, verleitete ihn sein Glaubenseifer dazu, den angeblichen Frevler von der Kanzel herab zu schmähen und häufig in plattdeutscher Mundart, der man sich in Mecklenburg allgemein bediente, ihm die drohenden Worte zuzurufen: „Ick seh Di woll achter den Piler stehn, Du hest een lutherisches Bökchen in de Hand, dat ward Di in dat höllische Fuer bringen.“ Solche und ähnliche Drohungen in der Kirche vermochten nur die Gemüter zu erbittern und die Ausbreitung der neuen reinen Lehre wurde dadurch eher befördert als verhindert. Auch die weltlichen Verfolgungen des Ratsherrn Cordes und seiner Helfer und Helfershelfer, unter denen sich Rottmeister Horwath durch seine Brutalität und Gehässigkeit hervortat, verfehlten ihren Zweck. Zwar wurden Dutzende von Knechten, Gesellen und anderen Leuten niederen Standes, die als Lutheraner bekannt waren, oft mit der größten Härte aus der Stadt verjagt, auch vorher körperlich gezüchtigt oder unter nichtigen Vorwänden Wochen und Monate lang in harter Haft auf der Frohnerei gefangen gehalten, jedoch deren Zahl nahm deshalb nicht ab. Im Gegenteil, für jeden derartig vertriebenen Lutheraner fanden sich immer neue Männer aus den unteren Ständen, die der Lehre Luthers anhingen, und so mehrte sich deren Zahl immer mehr. Hauptsächlich unter den in Rostock so zahlreichen und wichtigen Seefahrern fand der neue gereinigte Glaube in überraschend kurzer Zeit die zahlreichsten und treuesten Freunde. Diese trotzigen, starken, im steten Kampf mit den wilden Elementen abgehärteten Männer wollten sich die vielen Hudeleien der ohnehin verhassten Scharwache nicht gutwillig gefallen lassen. Gerade am Hafen und in den Strandstraßen, wo das Seevolk vorzugsweise sein Wesen trieb, kam es jetzt häufiger denn je zu argen Schlägereien zwischen den Matrosen und den Söldnern der Scharwache. Die schweren, kurzen Enterschwerter der Seemänner kreuzten sich mit den wuchtigen Hellebarden der Söldner und nicht selten floss Blut, waren gefährliche Verwundungen, ja selbst Todesfälle zu beklagen. Des Abends wagten sich die Scharwächter nur noch in starken Haufen in diese Gegenden und Rottmeister Horwath, so mutig und streitgewohnt er auch sonst war, durfte ohne eine Bedeckung von sechs bis acht schwerbewaffneten Söldnern keine Verhaftung im Hafenviertel vornehmen, da er sicher sein konnte, den hartnäckigsten Widerstand vorzufinden. Aber auch die Rostocker Schifffahrt, dieser Lebensnerv der ganzen Stadt, fing an, unter den religiösen Zwistigkeiten zu leiden. Viele lutherisch gesinnte junge Steuerleute und Matrosen gingen nach Lübeck, wo man toleranter gegen ihren Glauben verfuhr. Sie wurden mit Freuden von den dortigen Schiffern aufgenommen, während die einheimische Reederei mitunter Mangel an einer tüchtigen Mannschaft litt.
Hatte doch ein Hoher Rat diese Angelegenheit einer besonderen Sitzung gewürdigt, in der es zu heftigen Reden und manchen inneren Streitigkeiten gekommen war. Der erste Bürgermeister der Stadt, Herr Heinrich Gerdes, ein wohlgesinnter und weiser Mann, der im Innern seines Herzens dem neuen Glauben gar nicht so feindselig gegenüberstand, wie dies bei vielen der Ratsherren der Fall war, riet zur Schonung und Milde und wollte nicht, dass man gegen die lutherisch Gesinnten so hart auftrete, wie es in den letzten Monaten häufig geschehen war. Seine Ansicht drang aber in der Ratsversammlung noch nicht durch, denn Ratsherr Cordes mit seiner gewandten und beredten Zunge wusste die große Mehrheit der Anwesenden dahin zu bewegen, dass man in den bisherigen Maßregeln nicht nachlassen und gerade jetzt das ketzerische Luthertum mit Stumpf und Stiel ausrotten müsse. Sei das schöne Ziel erst erreicht, so hörten auch die gegenwärtigen Reibereien im Innern der Stadt von selbst auf, worauf die Seefahrer sehr bald wiederkommen und sich der guten alten Ordnung fügen würden. Diese Meinung gab in der Versammlung des Hohen Rats auch den Ausschlag und mit ansehnlicher Mehrheit der Stimmen wurde beschlossen, in der bisherigen Weise der Strenge gegen alle Ketzer fortzufahren. Missbilligend sein graues Haupt schüttelnd, verließ Bürgermeister Heinrich Gerdes das Rathaus. Sein Faktotum, der alte Bürgermeisterdiener Mohl, der in seiner roten Amtstracht unmittelbar hinter ihm her schritt, musste wiederholt an der bürgermeisterlichen Samtschaube zupfen, damit der Erste der Stadt die ehrfurchtsvollen Grüße angesehener Bürger nicht unerwidert lasse, so vertieft war der alte Herr in seinen schweren Gedanken.
Auch wenn man die nicht angesessenen bekannten Lutheraner mit schonungslosem Eifer aus der Stadt und deren Gebiet zu vertreiben suchte, so ließ sich gegen die ansässigen Bürger nicht Gleiches tun. Bader Peter Schmidt, Schiffer Bradhering, Schiffsbaumeister Willgaß, Schmied Roloff und andere Bürger mehr, die als Häupter der Lutheraner unter der eigentlichen Bürgerschaft galten, konnte man nicht unter fadenscheinigen Gründen vertreiben, aber gequält und molestiert wurden sie auf jegliche Weise. Ja, als Cordes’ Eifer es schon durchgesetzt hatte, dass diese Männer gefangen genommen und wegen sträflicher Ketzerei vor ein peinliches Gericht gestellt werden sollten, wäre es fast zum Aufstand in der Stadt gekommen. Ein Teil der Quartiere waffnete sich und stellte sich auf, die zahlreichen Zünfte der Schiffszimmerleute, Huf- und Waffenschmiede, Grobbäcker und Knochenhauer erklärten, sie würden es unter keinen Umständen dulden, dass hochangesehene Meister ihrer Gewerke, ihres Glaubens wegen, gefangen gesetzt werden. So war denn eine Volkserhebung zu befürchten und der Bürgerkrieg, der leider oft innerhalb der Mauern der alten Stadt Rostock gewütet hatte, schien abermals emporflammen zu wollen. So weit mochte es jedoch ein Hoher Rat nicht kommen lassen, denn er fühlte sich zu schwach, um gegen die Drohung eines so großen Teils der Zünfte mit offener Gewalt einschreiten zu können. Zwar gab es Fanatiker, die es lieber zum Äußersten treiben wollten, als jetzt schwächlich nachzugeben, allein die gemäßigte Stimme des Bürgermeisters Heinrich Gerdes, der mit beredter Sprache darzulegen wusste, welch unermessliches Unheil der Stadt drohe, wenn es jetzt abermals zu offenen Zwistigkeiten unter ihren Bürgern komme, wusste sich diesmal Gehör zu verschaffen. Besonders seine Ansicht, dass die auf Rostocks Macht und Ansehen stets eifersüchtigen Herzöge von Mecklenburg diese Gelegenheit höchstwahrscheinlich benutzen würden, um unter dem Vorwande, die Ruhe wiederherzustellen, sich in diese Händel zu mischen und eine Besatzung in die Stadt zu werfen, war hierbei von großem Gewicht. So wurde von allen offenen Gewaltmaßregeln abgesehen und den Lutheranern unter der Hand eröffnet, dass sie im Innern ihrer Wohnungen und im engen Kreise unter sich so viele religiöse Handlungen treiben könnten, wie sie nur wollten, ohne dass ein Hoher Rat sich darum bekümmern werde. Das war der erste günstige Erfolg, dessen die Lutheraner sich rühmen durften, seit es dem Eifer der papistischen Partei gelungen war, Magister Joachim Slüter aus der Stadt zu vertreiben.
In der Vorderstadt Güstrow, im Geheimen geschützt von Herzog Heinrich von Mecklenburg, führte Slüter inzwischen ein stilles, zurückgezogenes Leben. Soviel es in seinen Kräften stand, suchte er auch in seinem neuen Umfeld Anhänger für die reine Lehre Luthers zu werben. Seinen unablässigen Bestrebungen gelang es auch, sowohl in Güstrow selbst, wie in dessen näherer und fernerer Umgebung, manch tüchtigen Streiter für den neuen Glauben zu gewinnen.
In der Stille bekannte sich Herzog Heinrich auch zum Luthertum, allerdings bewog ihn in erster Linie eine eigennützige Politik dazu. Er wünschte dessen Ausbreitung im Lande, damit er bei dieser Gelegenheit reiche Klöster und geistliche Stiftungen einziehen und mit deren Erträgen seine stets leere Kasse füllen könne. Doch aus Furcht, den Zorn des mächtigen Kaisers von Deutschland, Carl V., auf sich zu lenken, wagte er es nicht, ein öffentliches Bekenntnis abzugeben.
Solch politisches Intrigenspiel widerstrebte dem reinen Charakter Slüters auf das Äußerste. Er wäre gern aus Güstrow und der Nähe des fürstlichen Hoflagers fortgegangen, wenn er nicht gefühlt hätte, dass ihm der Schutz des Herzogs für jetzt noch unentbehrlich wäre. Unter diesen Umständen sehnte er sich nach seinem geliebten Rostock und in den Kreis seiner dortigen treuen Freunde zurück. Mit Inbrunst wartete er auf die Stunde, in der es ihm abermals vergönnt sei, die Kanzel in der altehrwürdigen Kirche zu St. Petri zu besteigen und von dort mit begeisterten Worten als Priester des Herrn seiner andächtigen Gemeinde die reine Lehre des Evangeliums zu verkünden.
Slüter hatte sich bereits einige Male nach Rostock hineingewagt, allerdings im Schutze einer Verkleidung. Dort, im gastlichen Hause des Baders Peter Schmidt, seines treuesten Verehrers, hatte er einen Kreis seiner Glaubensgenossen um sich versammelt. Aber der unermüdlichen Wachsamkeit der vielen Mönche in der Stadt, deren Zahl selten unter 300 Köpfe sank, entgingen die heimlichen Besuche nicht. Den Klosterbrüdern, egal welchem Orden sie angehörten, gelang es stets, den so bitter gehassten Reformator zu erspähen. Sie hatten im Haus des Baders und derer anderer Bürger, die als Lutheraner bekannt waren, eine Menge von ihren Spionen. Von denen erfuhren sie alles, was in den Stuben der sogenannten Ketzer vorging. So war denn Slüters Leben in Rostock wiederholt gefährdet gewesen. Die papistische Partei hatte einen Haufen Pöbel aufgehetzt, das Haus Peter Schmidts zu umringen und die Auslieferung des verruchten Ketzers zu verlangen. Klimpernde Münzen und eine reichliche Spende von dem beliebten starken Rostocker Bier waren imstande, ein tobendes Geschrei zu entfachen. Die Wortführer des Pöbels tönten gar, Slüter werde den Zorn Gottes und den Bannfluch des hohen Stellvertreters Christi auf die Stadt herbeiführen. Es war zu wilden Szenen gekommen und da die Scharwache, deren Pflicht es eigentlich gewesen wäre, das Haus jedes Bürgers vor ähnlichem Unfug zu schützen, sich wohlweislich nicht blicken ließ, so hätte nicht viel gefehlt, dass die tobenden Kerle in die Wohnung des Baders eingedrungen wären, um dort die ärgsten Exzesse zu verüben. Nur das beherzte Eingreifen des Schiffsbaumeisters Willgaß, der mit einem tüchtigen Haufen schnell gesammelter Schiffszimmergesellen und Matrosen auf den Mob eindrang und mit derben Knüttelhieben auseinanderjagte, rettete im letzten Augenblick die Wohnung des Baders und die darin vereinigten Anhänger der lutherischen Lehre. An jenem Abend fanden in verschiedenen Teilen der Stadt noch einige heftige Prügeleien zwischen den lutherisch gesinnten Arbeitern und dem aufgehetzten Pöbel statt.
Auch Rottmeister Horwath hatte das eine oder andere Mal Slüters Anwesenheit in Rostock aufgespürt und war mit einigen Söldnern der Scharwache ausgezogen, um nach ihm zu fahnden und ihn als Störer der öffentlichen Ruhe festzusetzen. Es hatte viele Mühe gekostet, den Reformator den Nachforschungen des eifrigen Rottmeisters zu entziehen, und manche Bekenner der neuen Lehre waren dadurch in sehr böse Verdrießlichkeiten geraten. So hatte Slüter den schweren Entschluss gefasst, auf den Besuch von Rostock, wenigstens für die nächste Zeit, bis dort wieder bessere Verhältnisse eintraten, zu verzichten. Auch das Vorhaben, auf dem flachen Lande, in einem zwischen Rostock und Güstrow passend gelegenen Dorfe, größere Zusammenkünfte seiner früheren Zuhörer zu veranstalten, um mit ihnen gemeinsamen Gottesdienst zu halten, musste leider unterbleiben. Der größte Teil der mecklenburgischen Ritter, denen die meisten Dörfer gehörten, waren noch der Römisch-Katholischen Kirche blind ergeben und schenkten den Einflüsterungen der Geistlichen, die sich als Pfarrer in den Landkirchen oder auch als Hauskaplan in den Hauskapellen auf den großen Rittergütern befanden, unwidersprochen Gehör. So konnte Slüter nicht daran denken, dass ihm ein Rittergutsbesitzer die Genehmigung erteile, auf seinem Gut eine derartige Versammlung abzuhalten. Er musste sogar befürchten, dass ein Gottesdienst von den Gutsuntertänigen gewaltsam gestört werde, er, wie auch seine Anhänger, am Leben oder doch an ihrer Freiheit bedroht wären, wenn er es wagte, ohne eine derartige Erlaubnis eine solche Zusammenkunft auf irgendeinem ritterschaftlichen Gute abzuhalten. Ein gleich ungünstiges Verhältnis herrschte aber auch auf den zur Stadt Rostock gehörigen sogenannten Kämmereigütern. Die Predigerstellen waren mit fanatischen Papisten besetzt und das rohe hörige Landvolk befand sich in deren Abhängigkeit.
Somit hatte Magister Joachim Slüter im Jahre 1524 leider nur wenig Gelegenheit, mit seinen Freunden und Anhängern in Rostock zu verkehren und dort für die weitere Ausbreitung seiner Lehre zu wirken. Das bereitete Slüter tiefen Kummer, seine Gedanken weilten unablässig bei seinen lieben Freunden und Anhängern in der alten Hansastadt. War er doch von der Hoffnung beseelt, gerade diese gute Stadt werde nicht allein im mecklenburgischen Lande die Wiege der Reformation, sondern weit hinauf an den Gestaden der deutschen Ostseeküste; ihre berühmte Hochschule sei berufen, die Jünger zu bilden, die als Apostel der neuen Lehre hinaus in ferne Länder zögen, Luthers Satzungen zu predigen und das Volk von dem harten Druck des damaligen Papismus zu erlösen.
Außer in der Stadt Rostock selbst hatte Joachim Slüter in Warnemünde eifrige Anhänger gefunden. Die einfachen Seeleute dort, deren Leben ein beständiges Ringen mit dem wilden Meer war, hatten das Luthertum mit offenen Ohren und warmer innerer Begeisterung aufgenommen. Schon als Slüter noch als Lehrer an der Schule der Kirche zu St. Petri weilte, war es ihm liebe Gewohnheit gewesen, an schönen Tagen in raschem Boote auf der Warnow nach Warnemünde zu segeln und dort seine Augen an dem Anblick des unendlichen Meeres zu erfreuen. In Gesprächen mit den älteren Fischern und Lotsen und deren Familien suchte er die neuen Lehren Luthers zu verbreiten. Manch goldenes Körnchen der Wahrheit, was auf empfänglichen Boden fiel, war bei diesen Besuchen ausgestreut worden. Die Warnemünder gehörten einem eingewanderten friesischen Volksstamm an, ihre Charaktereigentümlichkeit trat damals noch scharf hervor und gerade der Drang nach Freiheit, Wahrheit und Recht, der den friesischen Stamm während des Mittelalters so vorteilhaft ausgezeichnet, bewirkte, dass vorzugsweise die Friesen sich überall sehr schnell und mit besonderem Eifer der Reformation anschlossen. Hinzu kam, dass die Pfarrstelle an der Kirche zu Warnemünde schlecht besetzt war. Die Gemeinde war klein und ärmlich, die Stelle daher gering dotiert. Auch der Aufenthalt in dem rauen, unwirtlich gelegenen, im Winter von heftigen Seestürmen umbrausten Ort war überaus unangenehm, und so fanden sich schwerlich Bewerber um so eine geringe, so wenig gewährende Pfarre. In den letzten Jahren hatte man dem Dominikanerkloster zu St. Johannis die Besetzung dieser Stelle überlassen. Den Brüdern aus dem behäbigen Kloster zu Rostock, wo sich die Insassen eines besonders vergnüglichen Wohllebens erfreuen durften, erschien es als Strafe, in das dürftige, einsame Pfarrhaus in Warnemünde versetzt zu werden. Auch der Prior des Klosters betrachtete diese Bestimmung nicht anders. Er sandte gewöhnlich nur Mönche dorthin, mit deren Betragen er nicht zufrieden war, oder die aus irgendeinem Grunde eine Bestrafung erhalten sollten. So weilte seit einigen Jahren ein Pater in Warnemünde, der sich einen schlechten Ruf als roher, unwissender, dem Trunke ergebener Mensch erworben hatte. Er las jeden Morgen gewohnheitsmäßig die Messe, besorgte die übrigen, ihm unumgänglich obliegenden geistlichen Pflichten ganz mechanisch, bekümmerte sich aber im Übrigen nicht im Allermindesten um sein geistliches Amt und um das Seelenheil der Gemeinde, die ihm anvertraut worden war. Der Genuss starker geistiger Getränke war seine Hauptfreude und Beschäftigung. Und wenn er keine andere Gesellschaft zum Trinken bekommen konnte, so verschmähte er selbst die sechs bis acht Söldner der Stadt nicht, welche die Besatzung des festen Turmes bildeten, der unweit der Warnow zur Beherrschung der Schifffahrt erbaut worden war. Solch ein Seelsorger konnte dem frommen Sinn der Warnemünder, der nach innerer Erbauung verlangte, nicht genügen, auch deshalb wandten sie sich weit schneller dem Luthertum zu, als es sonst vielleicht geschehen sein dürfte.
Daher war es auch für die Warnemünder ein Freudentag gewesen, als sich die Kunde verbreitet hatte, Magister Slüter sei zum Prediger der Kirche zu St. Petri in Rostock erwählt worden. So diente der hohe Turm von St. Petri den Seeleuten und Fischern nicht nur als Landmarke, nach der sie sicher steuern können, um die richtige Fahrt zu finden, sondern den Frommen dünkte es eine gute Vorbedeutung zu sein, dass von nun an unter dem schützenden Dach dieser Kirche ein Prediger das Wort Gottes verkünden werde, der ihre Seelen in das richtige Fahrwasser des reinen Glaubens leite und sie dem sicheren Hafen der wahren inneren Ruhe entgegenführe. Von Slüters Ernennung an war die Petrikirche an jedem Sonntag von vielen Warnemündern, Jung und Alt, Weib und Mann, die nur irgendwie abkommen konnten, besucht. Mochte die Witterung auch noch so rau sein, die abgehärteten, an stetes Ungemach des Lebens gewöhnten Menschen machten sich nichts daraus, wenn sie nur die Predigt ihres verehrten Slüters hören konnten. In ihren Booten segelten sie die Warnow herauf. War der Wind zum Segeln ungünstig, so legten sich Männer wie Frauen in die Riemen und ruderten die leichten Fahrzeuge beinahe ebenso geschwind die zwei Meilen nach Rostock hinauf, wie es geblähte Segel vermocht hätten. Mindestens ein Dutzend, oft aber noch eine größere Zahl solcher Boote fuhren Sonntag für Sonntag gen Rostock. Magister Slüter konnte keine andächtigeren Zuhörer, als deren Insassen, unter allen, die den weiten Raum seiner Kirche füllten, zählen. Daher war es für alle Bewohner des Fischerdorfes eine Unglücksbotschaft, als Slüter nach kaum Jahresfrist seine Predigerstelle zu St. Petri wieder aufgeben, ja selbst die Stadt Rostock notgedrungen verlassen musste, um den allzu heftigen Nachstellungen seiner Feinde zu entgehen. Von nun an fuhr kein Boot mit Warnemünder Kirchgängern mehr den breiten Strom hinauf. Da ihr Gottesdienst daheim ihnen jetzt noch weniger denn je behagte, enthielten sich die meisten gänzlich der Teilnahme. Zu Hause hielten sie dafür umso fleißiger religiöse Versammlungen ab, wobei sie fromme Lieder sangen oder sich aus der einzigen Bibel, einem Geschenk Slüters für das Warnemünder Kirchspiel, vorlasen. Gewiss gewährten ihnen die stillen Andachten innere Erbauung, weit mehr Erbauung, als ihnen der Besuch der Messe in ihrer Kirche, die mechanisch von einem angetrunkenen Pfaffen abgeleiert wurde, eingebracht hätte, aber Slüters Predigten wurden dadurch lange nicht ersetzt. Nach so langer Pause verlangte es alle Warnemünder wieder eine solche Predigt zu hören und sich an ihrem reinen Inhalt zu erquicken.
Der katholischen Partei in Rostock war der dem Luthertum zugeneigte Sinn fast aller Warnemünder sehr wohl bekannt, der hatte hier auch wiederholt heftigsten Zorn erregt, allerdings unterließ man es, gewaltsam dagegen einzuschreiten. Warnemünde wurde in jeder Hinsicht hart von der Stadt bedrückt, so dass man es nicht wagte, seinen Bewohnern auch noch in Glaubensdingen Vorschriften zu machen. Wegen der strengen Herrschaft Rostocks hatte sich unter den Warnemündern ohnehin große Unzufriedenheit breitgemacht. Einige Male hatten sie bereits erklärt, wenn man sie fernerhin so gängle, so würden sie ihre kleinen Häuschen verlassen und auf ihren Booten mitsamt ihren Familien nach dem benachbarten Holstein segeln, wo man sie als tüchtige Seeleute gewiss mit offenen Armen aufnehme. Den Rostockern jedoch waren die Warnemünder als verlässliche Lotsen, tüchtige Matrosen und fleißige Versorger der städtischen Haushaltungen mit Seefischen und weißem Seesand unentbehrlich. Ihr Wegzug hätte der Stadt großen Schaden zugefügt und viele Interessen benachteiligt und so beschloss ein Hoher Rat wohlweislich, alles aufzubieten, damit die Drohung nicht in die Tat umgesetzt werde. In einer hitzig geführten Ratsversammlung hatten die eifrigsten Papisten zwar den Antrag gestellt, man möge gegen die aufsässigen Warnemünder mit aller Strenge einschreiten, ihnen ihre häuslichen Andachten verbieten und sie nötigenfalls mit Gewalt in den Schoß der allein seligmachenden Römisch-Katholischen Kirche zurückzuführen, doch waren diese Vorschläge mit großer Stimmenmehrheit abgelehnt worden. Selbst der alte Rats- und Handelsherr Niclas Wulf, so eifrig er auch sonst in jeder Hinsicht der papistischen Partei zugetan war, hatte sich mit Entschiedenheit gegen alle derartigen Gewaltmaßregeln ausgesprochen und den Untergang Warnemündes verkündet, wenn so etwas geschehen sollte. So ließ denn ein Hoher Rat die kirchlichen Zustände so fortbestehen, ohne sich eben allzu viel darum zu bekümmern und dies war denn auch das Beste, was er unter den obwaltenden Verhältnissen tun konnte.
Der Winter des Jahres 1525 begann mit einer ungewöhnlich frühzeitigen Strenge hereinzubrechen. Schon Mitte November bedeckte tiefer Schnee alle Felder, die Warnow fing an, in Eis zu gehen, und die Schifffahrt konnte als geschlossen angesehen werden. An den sicheren Pfählen des Hafens zu Rostock lagen in langen Reihen die abgetakelten Schiffe nebeneinander, die sonst in kühner Fahrt die verschiedenen Meere durchkreuzten. Müßiges Seevolk trieb sich überall umher. In Warnemünde zeigten sich alle Hütten so angefüllt, wie es während der guten Jahreszeit niemals der Fall war. Kräftige Männer, junge Burschen bis hin zu den Halbwüchsigen, die schon als Schiffsjungen weit hinaus in die See mussten, kamen von den abgetakelten Fahrzeugen zurück in die Heimat, um dort auf wenige Monate die schwer verdiente Ruhe zu genießen. Der Fischfang in der See konnte bei dieser rauen Witterungszeit nur an vereinzelten, besonders günstigen Tagen betrieben werden und auch die Fahrt mit den Booten den Fluss hinauf nach der Stadt war wegen des vielen Treibeises so beschwerlich, ja gefährlich, dass sie nur in Ausnahmefällen unternommen wurde. Da saßen denn die Menschen in den kleinen niedrigen Stuben eng um den warmen Ofen zusammengedrängt, um, so gut es gehen wollte, die verschiedenen Arbeiten für den Fischfang herzurichten. Die Frauen spannen am Kunkel Flachs und Heede zu Garnen für die vielen Netze, oder Wolle zu Strümpfen und warmen Unterwämsern, indessen die Männer sich mit dem Knüppern der Netze oder auch mit allerlei Holzschnitzereien für häusliche Zwecke beschäftigten. Glasscheiben waren in den Wohnungen der Warnemünder nirgends zu finden, das Tageslicht fiel durch getrocknete ausgespannte Fischblasen, und wo es an diesem schlichten Mittel fehlte, vertraten Holzläden deren Stelle. So herrschte denn den ganzen Tag Finsternis in den niederen Stuben mit den kleinen Fensterluken. Kienholzspäne oder mit Tran gefüllte Lampen brannten bei der häuslichen Arbeit ununterbrochen. Und während draußen ein Nordoststurm nach dem anderen mit ungebrochener Gewalt über das Meer brauste und an den räucherigen Hütten rüttelte, fühlten sich deren Bewohner trotz der groben Nahrung, die zumeist aus getrockneten Fischen und Grütze bestand, recht traulich und behaglich. Schon das Gefühl, in ruhiger Sicherheit auf festem Boden weilen zu dürfen, statt draußen auf schwankendem Schiff ein Spielball der wild empörten Elemente zu sein, verlieh den Seeleuten und Fischern ein seltenes Behagen. Dazu der Genuss des lange entbehrten Familienlebens, dem sie sich im Winter wenigstens auf Wochen in ungestörter Ruhe hingeben durften! Die Mehrzahl der Männer war ja den größten Teil des Jahres auf der wogenden See beschäftigt gewesen, da hatte die Gattin den Gatten, die Mutter den Sohn, die Braut den Verlobten häufig auf lange Monate entbehren müssen, ohne zu wissen, auf welchem Meere er inzwischen segelte. Mit banger Sorge waren alle um die Abwesenden erfüllt gewesen, wenn gewaltige Stürme tobten oder eine unsichere Kunde in den Ort drang, in diesem oder jenem fernen Meere sei eine ganze Flottille hansischer Kauffahrer untergegangen, oder die frechen Seeräuber hätten viele Schiffe gekapert, oder auch die Kämpfe, die zu jener Zeit in Dänemark und Skandinavien das Land zerrütteten, hätten auch manchen fremden Fahrzeugen Verderben bereitet. Die Briefbeförderung war im Verkehr nach überseeischen Ländern in der Regel nur vom Zufall abhängig. Nur durch gerade absegelnde Schiffe wurden etwaige Briefe befördert, mussten oft die größten Umwege von Hafen zu Hafen nehmen, um ihr Ziel zu erreichen. Oft konnten Wochen, ja selbst Monate vergehen, bevor der Rostocker Kaufherr die Kunde erhielt, dass sein Schiff oder seine Fracht in Drontheim oder Riga, oder in einem hispanischen oder englischen Hafen eingelaufen sei. Die Warnemünder, ohnehin der schweren Kunst des Schreibens allzu oft unkundig, erfuhren vom Schicksal der Ihrigen selten früher etwas, als bis das Schiff, das den Angehörigen an Bord genommen, glücklich in den Hafen einlief. Aber gerade diese Ungewissheit während der langen Trennungszeit erhöhte jetzt die Freude bei dem kurzen Beisammensein. Zur Zeit der Wintermonate war es allen Familiengliedern vergönnt im engen Verein miteinander zu leben, bis dann die ersten Frühlingstage die Männer wieder hinaus auf das wogende Meer trieben, nur zu oft auf Nimmerwiedersehen.
Bei aller Rauheit und Festigkeit des äußeren Auftretens, wie es der Seemannsberuf mit sich bringt, herrschte aber bei den Warnemündern ein vortreffliches Familienleben und besonders beim weiblichen Geschlecht eine seltene Reinheit der Sitten. Jetzt während des Winters wurden auch Verlobungen gefeiert und Hochzeiten ausgerichtet. Unter den ledigen Töchtern des Fleckens zeichnete sich Gundula Wegner, die einzige Tochter des alten Seefischers und Lotsen Wegner, in jeder Hinsicht aus. Sie galt nicht nur als das stattlichste und hübscheste, sondern auch fleißigste und tüchtigste Mädchen im ganzen Ort und wenn auch unter deren Bewohnern nicht viel von Vermögen die Rede sein konnte, so wurde doch angenommen, dass der Alte seiner Tochter einen guten Hausstand einrichten und ein festes Boot zur Aussteuer mitgeben könne.
So hatte es Gundula nicht an Bewerbern gefehlt und auch beim Beginn dieses Winters näherte sich ihr ein junger Matrose mit der unverkennbaren Absicht, um ihre Hand anzuhalten. Fritz Ohlsen, der Sohn des Nachbars rechts von Wegner, war ein hübscher, stattlicher Bursche, so kräftig und kühn, wie nur je ein Matrose auf einem hansischen Schiffe gefahren sein mochte. Nach Warnemünder Art war er bereits mit dem 14. Lebensjahr auf die See gegangen, seitdem nur selten zum kurzen Besuch heimgekehrt. Er fuhr größtenteils auf hamburgischen Schiffen, die in das Mittelmeer segelten und hatte manche gefährliche Fahrt und manch verzweifelten Kampf mit raublustigen Barbaresken bestanden. Wohl an die fünf Jahre war er nicht in seiner Heimat gewesen, als er jetzt plötzlich beim Beginn des Winters unerwartet in seinem Geburtsort erschien. Seine Ankunft erregte nicht allein im Elternhause, wo man ihn schon längst verloren geglaubt hatte, die lebhafteste Freude, in Warnemünde wohnten einige, die an der Heimkehr des stattlichen Burschen Anteil nahmen. War er doch ein Seemann, der seinem Vaterlande zum Stolz gereichte. Seine Haut hatte den bronzenen Ton angenommen, der sich bei langem Aufenthalt unter südlicher Sonne einstellt. Auch seine Tracht mit der bunten Seidenschärpe, worin ein krummer, reich blitzender Türkensäbel steckte, den er einst im Enterkampf von einem algerischen Korsaren erbeutet hatte, trug dazu bei, das Fremdländische seiner Erscheinung zu betonen. Die Warnemünder Mädchen freuten sich, wenn sie des Abends in den Spinnstuben zusammenkamen, dort auf den munteren Fritz trafen und seinen lustigen oder auch grausigen Erzählungen über Abenteuer lauschten, die er unter Heiden und Türken erlebt hatte. Und als bekannt wurde, Fritz Ohlsen habe einen großen Lederbeutel voll blanker, spanischer Dublonen aus der Fremde mitgebracht und erklärt, er sei des Umherschwärmens in der Ferne überdrüssig, wolle sich ein Häuschen in der Heimat bauen, ein Leichterschiff kaufen, eine hübsche wirtliche Jungfer zum Eheweib nehmen und sich häuslich niederlassen, da war keine, die sich nicht im Stillen wünschte, seine Wahl möge gerade auf sie fallen. Aber der Gerngesehene schien sich um die Andeutungen, er solle mit einem Heiratsantrag nur an diese oder jene Tür klopfen, die werde ihm gewiss bereitwillig aufgetan, wenig zu kümmern. Nur die Nachbarstochter, Gundula Wegner, schien er besonders gerne zu sehen, sonst war er gegen alle Mädchen gleich freundlich und lustig und zeichnete keine mehr oder weniger aus. Gundula jedoch war diejenige, die sich gegen ihn weit spröder und zurückhaltender benahm als jede andere; die, als sie die sichtbare Annäherung bemerkte, seine Nähe offenbar floh. Die Nachbarn Wegner und Ohlsen hätten es zwar gern gesehen, wenn ihre Kinder einen Ehebund miteinander schlössen, die beiden Alten hatten sogar wiederholt darüber gesprochen, allein Gundula schien dazu nicht die mindeste Neigung zu fühlen.
Seit jenem Aprilabend im Jahre 1523, wo der junge Schiffer Hinrich Wulf Gundula gestanden hatte, wie sehr sie sein Herz berühre, war mit dem früher so unbefangenen Mädchen eine Veränderung vor sich gegangen. Mit dem Geständnis hatte sich Gundulas Welt gewandelt, denn auch sie liebte Hinrich aus vollem Herzen und sie war entschlossen, ihm diese Liebe für alle Zeit ihres Lebens mit unverbrüchlicher Treue zu halten. Zwar war sie sich bewusst, wie gewaltig die Hindernisse waren, die sich der Verbindung zwischen ihr und dem Geliebten entgegenstellten, denn es wäre ein bisher unerhörter, ja kaum denkbarer Fall gewesen, dass der Sohn eines angesehenen, reich begüterten Rostocker Geschlechtes, wie das Wulf’sche, eine niedere Warnemünder Fischertochter als sein Eheweib heimführe. Aber auch hierdurch wurde sie nicht im Geringsten in ihren Gefühlen erschüttert. Sollte Hinrich Wulf ihre Hand nicht erhalten dürfen oder können, dann werde sie unvermählt bleiben und bei der Festigkeit ihres Charakters war nicht davon auszugehen, dass sie diesen Entschluss zurücknehme.
Aber nicht allein die Hoffnungslosigkeit ihrer Liebe, auch die Ungewissheit über das Schicksal des Geliebten trübte jetzt Gundulas Sinn. In den langen Jahren ihrer Trennung war ihr keine direkte Nachricht über Hinrich Wulfs Schicksal zugekommen und was auf Umwegen zu ihr gelangt war, hatte ihr tiefen Kummer bereitet. Vor zwei Jahren war in Rostock, auf der Wulf’schen Schreibstube, die Hiobsbotschaft eingelaufen, dass der junge Hinrich im Kampfe mit einem Raubschiff schwer verwundet worden sei und mit dem Tode ringe. Die geschwätzige Fama brachte die böse Kunde von Rostock nach Warnemünde und träufelte ihre Neuigkeiten, gewürzt mit allerhand schauerlichen Mutmaßungen, in Gundulas Herz. Das junge Mädchen musste alle Kraft aufbieten, seinen Schmerz, seine tiefe Trauer zu verbergen.
Es bat die Mutter, den Fischverkauf in Rostock selbst besorgen zu dürfen, um sich unter dem Vorwand, beste und frischeste Ware feilzubieten, Zutritt zum Wulf’schen Hause zu verschaffen. Über dessen Schwelle zu gelangen, war jedoch einfacher als gedacht, denn die eichenen Torflügel standen sperrangelweit offen. Gundula musste nur achtgeben, nicht unter die Räder der Fuhrwerke zu geraten, die über die Diele des stattlichen Kaufherrensitzes rumpelten. Bei den Hausgenossen fragte sie schüchtern, ob die Näheres über den Vorfall wüssten und zu ihrem Schrecken erfuhr sie sehr viel mehr als erwartet: Alle Einzelheiten der Verwundung wurden vor ihr ausgebreitet, außerdem trafen noch andere traurige Nachrichten ihr Ohr. Es kostete die Arme Kraft, die Tränen im Wulf’schen Hause zu unterdrücken. Für ihre Blässe und ihre schwankende Haltung machte sie notgedrungen ein plötzliches Unwohlsein verantwortlich. Anna, die Tochter des Kaufherrn Niclas Wulf, brachte dem hübschen, bescheidenen Fischermädchen zur Stärkung einen Becher voll Würzwein, ohne im Entferntesten zu ahnen, was der eigentliche Grund der augenblicklichen Erkrankung sei.
Gundula eilte, so schnell ihre Füße sie nur tragen konnten, aus dem Wulf’schen Hause fort hinüber in die nahe Kirche zu St. Marien. Dort warf sie sich vor dem Altar auf die Knie. Sie erflehte im inbrünstigen Gebet vom höchsten Lenker des Schicksals aller Menschen die Heilung des Geliebten und dessen ferneres Wohl. Die ständige Wiederholung ihrer Fürbitte vermochte es, sie ein wenig zu beruhigen. So erhob sie sich und verließ das Gotteshaus gestärkt, zumindest mit Hoffnung im Herzen. Ihre Wangen waren etwas bleicher, der Glanz ihrer Augen schwächer als gewöhnlich, doch hätte niemand geahnt, welch tiefer Schmerz dem einfachen Fischermädchen zusetze, so aufrecht war seine Haltung und so kräftig seine Schritte.
Auch wenn Gundulas Herz aus tiefster Wunde blutete, so ging sie doch tagsüber der strengsten Arbeit nach. Nur wenn sie am Abend im stillen dürftigen Kämmerlein auf ihrem harten Seetanglager saß, gedachte sie ungestört des Geliebten, der im fernen Norden einsam und krank daniederlag. Dann sandte sie ihre Gebete für Hinrichs Genesung zum Himmel empor.
Im Laufe der Zeit erhielt Gundula noch schlimmere Nachrichten: Im Spätherbst 1523 kam plötzlich und unerwartet die „Greif von Rostock“ mit reicher Ladung von Drontheim zurück in den Warnowhafen. Was half es aber, wenn Gundula ungeachtet des eisigen Nordwindes dem in schneller Fahrt einsegelnden Schiff entgegenstürzte, ihre Augen entdeckten den so sehnlich Erwarteten nicht an Bord. Hinrich Wulfs schwere Wunde war noch nicht so weit geheilt, als dass es ihm möglich gewesen wäre, die Reise nach der Heimat mitzumachen. Einige Warnemünder, die auf der Greif als Matrosen dienten, erzählten später, ihr früherer Schiffer sei noch nicht von seinem Leiden genesen und müsse in der Ferne wohl noch lange auf dem Krankenlager ausharren. Das war eine traurige Kunde für das treu liebende Mädchen und es wurde ein weiteres Mal geprüft, als es im nächsten Frühjahr erfuhr, dass der Arzt in Drontheim dem Verwundeten eine längere Reise in ein wärmeres Klima empfohlen habe. Der alte Herr Niclas Wulf habe seinem Sohn eine Führerstelle auf dem Schiff eines Lübecker Reeders vermittelt, das von Norwegen aus mit Stockfischen nach Hispanien segle und ihr Hinrich befinde sich jetzt schon auf der Fahrt dorthin. So hatte Gundula selbst im günstigsten Falle keine Hoffnung, den Geliebten vor Jahresfrist wiederzusehen. Doch so sehr sie sich in der Stille sorgte und härmte, ihre Ausdauer in der Treue wurde dadurch nicht erschüttert. Ihre Standhaftigkeit blieb stets die gleiche.
So hatte denn Fritz Ohlsen auch nicht die mindeste Aussicht, Gundulas Herz und Hand zu erringen, und hätte er gewusst, welche Hindernisse ihm im Weg standen, er würde schwerlich sein Werben mit solchem Eifer fortgesetzt haben. Jedoch die große Sprödigkeit und ernste Zurückhaltung des hübschen jungen Mädchens reizte seinen Stolz und entflammte seine Leidenschaft mehr und mehr. Der lange Winter lag noch vor ihm, wo sich täglich die Gelegenheit ergab, stundenlang in Gundulas Gesellschaft zu verkehren, bevor der Frühling ihn wieder auf die See hinausrief. Deshalb hoffte er, es werde ihm während der Wintermonate gelingen, das kalte Eis, das ihre Brust zu umpanzern schien, durch die Wärme seiner Liebe fortzuschmelzen.
Die frommen Warnemünder fanden zwar während ihrer Hausandachten, die allmorgendlich in den meisten Familien abgehalten wurden, innere Erbauung, aber sie sehnten sich doch danach, wieder einmal eine Predigt ihres hochverehrten Slüters zu hören. Erst recht jetzt im Winter, wo so viele junge Seeleute, die während des Sommers auf ihren Fahrten jeden Gottesdienst entbehren mussten, daheim waren.
Der alte Fischer Wegner, Gundulas Vater, war unter den Warnemündern einer der eifrigsten Verehrer Slüters. Wegner war überhaupt eine gewaltige, alles mit Eifer erfassende Natur, und selbst seine grauen Haare hatten die Heftigkeit seines Blutes noch nicht abzukühlen vermocht. Hinzu kam, dass Wegner in seiner Jugend bei seinen wilden Kreuz- und Querfahrten als Matrose vielleicht kein allzu frommes, Gott wohlgefälliges Leben geführt haben mochte und dadurch umso mehr den inneren Drang fühlte, das früher Versäumte im späteren Lebensalter nachzuholen. So war denn in der Zeit, wo Slüter noch als Prediger in Rostock weilte, kein Sonntag vergangen, an dem Wegner nicht in seinem Boot die Warnow hinauffuhr, um dessen Predigten mit wahrer innerer Andacht beizuwohnen. Jedes Mal kehrte er geistig gestärkt zurück. Auch sein Nachbar Ohlsen war ein besonders eifriger Lutheraner geworden, und so ergab es sich fast von selbst, dass häufig, wenn die Alten in den langen Abendstunden des Novembers sich gegenseitig besuchten, um einige Stunden zu verplaudern, das Gespräch auf Slüter und dessen Predigten kam.
„Muss wirklich ein ganz seltener Mann sein, dieser schwarzröckige Magister Slüter. Wahrhaftig, wenn man euch beiden Alten so von ihm reden hört und vernimmt, dass ihr ein ebenso heißes Verlangen nach seinem Besuch habt, wie ein frischer Matrose nach einem Kuss von seinem Mädchen, steigt bei mir der Wunsch auf, solchem Wundermann einmal ins Auge zu sehen, obgleich ich sonst einem Pfaffen lieber aus dem Wege gehe, als ihn aufzusuchen“, rief der junge Olsen ungeduldig, als er sich bei einem ähnlichen Gespräch der beiden Alten zu langweilen begann.
„Magst an deinem Platze sein, Fritz, wenn es gilt, bei Sturm und dunkler Nacht auf die Spitze des Bugspriets hinaus zu müssen, um ein Segel zu bergen, aber über geistliche Dinge zu spotten, das ziemt dir nicht. Weißt du, Magister Slüter ist ein Mann, dem du und zehn deinesgleichen nicht wert seid, nur die Schuhriemen aufzulösen“, entgegnete Wegner in ernstem Ton auf die leichtfertig hingeworfenen Worte. Auch der Blick, den Gundula dem jungen Mann ob dieser Rede zuwarf, war nichts weniger als freundlich.
„Nehmt ’s nicht für ungut. Hab wahrlich nicht die Absicht gehabt, über euren Slüter zu spotten“, verwahrte sich Fritz betroffen über die Missbilligung seiner Worte. „Aber wenn euch so viel daran liegt, Slüter zu hören, warum ladet Ihr ihn nicht zu uns nach Warnemünde ein, uns eine Predigt zu halten. Von Güstrow bis nach Rostock ist es doch keine weite Fahrt, und von dort holen wir ihn in einem Boot sicher zu uns her. Wer sollte uns hier stören? Die wenigen Söldner des Rats dort im Turm doch gewiss nicht. Die Kerle sind froh, wenn wir sie selbst ungestört lassen. Sollten sie es wagen, sich im Geringsten mausig zu machen, sperren wir sie leicht in ihrem eigenen Turm ein. Aus der Stadt selbst kommt um diese Zeit so leicht niemand hierher, und wenn der Rat es wagen würde, uns seine Scharwache unter diesem Hallunken Horwath zu schicken, nun, dann sollen sie Hiebe kriegen, dass sie am Leben verzagen und so bald nicht wieder ihre Nase nach Warnemünde hereinstecken. Hier sind jetzt an 70 bis 80 Mann junges lediges Seevolk beisammen. Damit schlagen wir alle Pfaffenknechte aus dem Orte heraus, wenn sie sich wirklich bei uns blicken ließen“, rief Fritz Ohlsen, sichtlich bemüht, den schlechten Eindruck seiner früheren Worte bei Gundula und deren Vater vergessen zu machen.
„Der Junge hat wahrhaftig keinen schlechten Einfall! Ja, wenn es möglich wäre, den Herrn Magister zu einem öffentlichen Gottesdienst zu bewegen, das sollte für uns Warnemünder ein rechtes Fest sein, wie wir es seit Jahren nicht mehr erlebt haben“, rief der alte Wegner aus. Allein der Gedanke an ein solches Vorhaben erfreute ihn und verlieh seinem wettergegerbten Gesicht große Lebendigkeit.
„Ja, wenn es geschehen würde, wäre es freilich gut, aber es wird nicht so kommen. Wer soll den Herrn in Güstrow einladen, wie können wir ihm zumuten, jetzt in dieser rauen Jahreszeit den weiten Weg von dort bis zu uns armen Leuten nach Warnemünde zu machen“, meinte kopfschüttelnd und zweifelnd der bedächtige alte Ohlsen.
„O gewiss, der Magister kommt, wenn wir ihn nur dringend bitten. Er ist ein so guter, echt christlich gesinnter Mann, der auch dem Geringsten nichts abzuschlagen vermag“, mischte sich plötzlich Gundula in das Gespräch. Ihr bleiches Gesicht erhielt unter dem Gedanken, Slüter komme vielleicht in den bescheiden Fischer- und Lotsenort, ein wenig Farbe.
Der rosige Schimmer der Freude auf Gundulas Wangen war Fritz nicht verborgen geblieben und spornte seinen Eifer an, den unbekannten Prediger, der ihm im Grunde gleichgültig war, zu einem Besuch in Warnemünde zu bewegen.
„Wisst, lasst die Gundel, die ja schreiben kann, einen Brief an den Magister abfassen, worin er dringend zum Abhalten einer Predigt gebeten wird, und ihr alle unterzeichnet mit eurem Handzeichen. Mit diesem Brief machen wir uns: der Jochen Ohlmann, meine Wenigkeit und noch zwei andere kräftige Kumpane von mir, die ich schon aussuchen will, auf den Weg nach Güstrow. Bis Bramow fahren wir mit dem Boot, dort mieten wir uns einen Wagen von einem Bauern, fahren nach Güstrow und übergeben dem Magister eure Einladung und bitten ihn recht von Herzen, dass er sie annehmen möge. Unter unserm Schutze soll er sicher reisen, ebenso werden wir ihn wieder ungefährdet zurückgeleiten, und wenn die Rostocker Papisten es wagen sollten, ihm auch nur ein Haar auf dem Kopfe zu krümmen, stehen wir Seefahrer hier Mann für Mann zu seinem Schutze auf und wollen ihn schon verteidigen“, rief Fritz und seine Augen blitzten feurig.
Sein Vorschlag fand immer mehr Beifall. Noch am selben Abend gingen die beiden alten Männer zu mehreren angesehenen Lotsen und Fischern, um deren Meinungen über die Einladung Slüters nach Warnemünde, damit der hier eine öffentliche Predigt halte, einzuholen. Zwar gab es noch manches „Wenn“ und „Aber“ zu besiegen, der eine oder andere Einwand zu widerlegen, jedoch am andern Morgen war der Plan mit großer Mehrheit angenommen, eine eigene Deputation mit der dringenden Bitte an Slüter abzuschicken, auf einige Tage nach Warnemünde zu kommen und hier einen Gottesdienst zu feiern.
Weil auch Gundula sich voller Begeisterung für das Unternehmen aussprach, erklärte sich Fritz gern dazu bereit, die Stelle eines Abgesandten zu übernehmen. Nicht lange danach saß Gundula über einem Stück Papier, das eilig herbeigeschafft worden war, und mühte sich, einen halbwegs leserlichen Brief aufzusetzen. Gleichwohl sein Inhalt kurz und einfach ausfiel, hatte Gundula mit dem Abfassen einige Mühe gehabt und sie trug sich mit großer Sorge, ob er den Erwartungen der Warnemünder genüge. Aber es gab niemanden im ganzen Ort, der ihr die Schreibarbeit hätte abnehmen können oder annähernd über so viele Kenntnisse verfügte, ihren Brief zu bekritteln.
Ihr Vater erzählte lachend, er wolle in derselben Zeit, währenddessen seine Tochter ein kleines Blatt Papier mit schwarzen Krähenfüßen bekritzele, gern ein volles Sandboot hin und zurück nach Rostock rudern und würde dabei lange nicht so viel Schweißtropfen vergießen und Anstrengung haben wie Gundula bei ihrer Schreibarbeit.
Fritz Ohlsen fand unter den jüngeren Matrosen, die zu seinen Freunden zählten, vier rüstige, mit Wehr und Waffen versehene Begleiter, auf deren Zuverlässigkeit er sich unbedingt verlassen konnte, falls irgendwelche Papisten etwas gegen Magister Slüters Reise einzuwenden hätten. Geleitet von den besten Wünschen aller Einwohner fuhr die seltsame Deputation in einem raschen Boot nach dem Dorfe Bramow ab, um dort gegen Geld und gute Worte einen Bauern zu bewegen, einen vierspännigen, mit Strohsäcken versehenen Leiterwagen für eine Fahrt nach dem vier Meilen entfernten Güstrow herzugeben.
Magister Joachim Slüter war in seinem kleinen dürftigen Arbeitsstübchen zu Güstrow mit dem Studium theologischer Schriften beschäftigt. Sein Erstaunen über den unerwarteten Besuch von einem halben Dutzend Matrosen war groß. Zumal die wildbärtigen rauen Seefahrer einen Schreck erregenden Anblick boten. Vor allem ihre gewichtigen Harpunen in kräftigen Fäusten, Enterschwerter in schwarzen Lederscheiden und ihre langen Pistolen trugen zu diesem Eindruck bei.
Fritz Ohlsen machte den Sprecher, und obgleich anfänglich mit Verlegenheit, wusste er seine Bitte bald gewandt und beredt vorzutragen. Zu seiner Hilfe überreichte er gleich zu Anfang Gundulas Schreiben.
Slüter las gerührt die in eckigen, ungelenkigen Buchstaben auf grobem Papier geschriebenen Worte, die in einfacher, aber inniger und aus vollem Herzen kommender Sprache die dringende Bitte an ihn richteten, doch nach Warnemünde zu kommen und die dortige Gemeinde, die mit fester Treue zu ihm stehe, mit einen Gottesdienst zu erquicken und zu trösten. Bereits während seines Aufenthalts in Rostock war ihm das hübsche, sittsame Fischermädchen durch das Edle ihrer Erscheinung vorteilhaft aufgefallen, so dass er sich nach ihrem Namen erkundigt und wiederholt einige freundliche Worte mit ihr gesprochen hatte. Gundulas Brief entschied sogleich Slüters Entschluss, dem Wunsch zu entsprechen, in Gesellschaft der Matrosen nach Warnemünde zu fahren und dort eine gemeinsame Andacht zu feiern. Zwar war die Fahrt im rauen, eisigen Novembermonat bei grundlosen Wegen auf einem offenen Wagen und später die Warnow herunter im Boot ungemein beschwerlich, doch dies konnte Slüter nicht von seinem einmal gefassten Entschluss abbringen. Er war der einfache Sohn des Volkes, sein ganzes Leben bestand aus einer Kette von Entbehrungen und Einschränkungen, er war es von jeher gewöhnt, jeglichem Wetter zu trotzen und dessen Ungestüm nicht zu achten, sobald es eine Pflicht zu erfüllen galt. Auch die etwaige Gefahr dieser Reise und die Möglichkeit, dass seine zahlreichen Feinde in Rostock die günstige Gelegenheit seiner Anwesenheit in Warnemünde zu einem Angriff auf sein Leben benutzen mochten, schreckte ihn auch dieses Mal nicht im Geringsten. Gleich seinem Lehrer Luther kannte Slüter kein Bedenken und scheute auch nicht die größte persönliche Gefahr, wenn es galt, die reine Lehre zu verbreiten und ihr neue Anhänger zuzuführen.
Zum größten Jubel der Matrosen, der sich besonders bei Fritz Ohlsen laut und lebhaft Luft machte, nahm Slüter die Einladung an. Er gab den jungen Männern zu verstehen, er werde sie bereits am nächsten Morgen nach ihrem Heimatort begleiten, um dort eine Predigt zu halten.
Die Anwesenheit der so eigentümlich gekleideten, zudem stark bewaffneten Seeleute, ihr lautes, tobendes Wesen, konnte in Güstrow nicht unbemerkt bleiben. Auch erzählten die augenfällig Fremden ohne Scheu und Vorsicht, was sie herführe. Da konnte es gar nicht ausbleiben, dass die Kunde vom Ziel und Zweck der Reise des Reformators auch in die Ohren von Leuten drang, die Magister Joachim Slüter bitter hassten. Schnell wurde beschlossen, den Magister auf dieser Fahrt heimlich ermorden zu lassen. An wilden Strolchen und beutelustigen Kerlen, die einen offenen Überfall auf der Landstraße für ein billiges Handgeld übernahmen, fehlte es nicht, wo selbst ein Teil des niederen Adels vom Stegreif lebte und so seine besten Einkünfte bezog. So waren denn noch am Abend ein halbes Dutzend bekannte Schufte angeworben worden, sich am nächsten Morgen in einen Hinterhalt bei einem dichten Wald zwischen Güstrow und Schwaan zu legen, dort Slüter meuchlings zu überfallen und möglichst niederzumetzeln.
Die Gefahr nicht ahnend, fuhr Slüter mit seinen Begleitern auf dem großen Leiterwagen, gut verpackt gegen die strenge Kälte, in der grauenden Morgendämmerung aus den Toren Güstrows. Die Wege waren so schlecht, dass der Wagen nur langsam vorankam, und so war es fast neun Uhr morgens geworden, als eine dichte Waldstelle erreicht wurde. Plötzlich erhob sich wütendes Geschrei, die Büsche rechts und links des Hohlweges gerieten in Bewegung, vermummte Gestalten sprangen auf den Weg und die Erste feuerte in vorschnellem Eifer ihr Faustrohr ab.
Slüter, der auf dem vordersten Strohsack saß, griff sich an den Kopf, aber die Kugel war dem Magister nur durch die Mütze gefahren und hatte gottlob keinen weiteren Schaden angerichtet.
Die Warnemünder Seeleute schienen auf so eine Gelegenheit, ihre Kampfkünste unter Beweis zu stellen, nur gewartet zu haben. Mit lautem Zorngeschrei sprangen sie vom Wagen und auf die Angreifer zu. Die hatten mit so einem kräftigen Widerstand nicht gerechnet und liefen bald in wilder Flucht in das Dickicht zurück. Fritz Ohlsen setze dem Kerl nach, der den Schuss abgefeuert hatte, holte ihn ein und streckte ihn mit einem gewaltigen Hieb seiner Harpune zu Boden. Mit zertrümmertem Schädel lag der Schurke in seinem Blute und röchelte sein Leben aus. Wie es sich herausstellte, war er ein berüchtigter Strolch und Wegelagerer, der die Landstraßen lange Zeit unsicher gemacht hatte. Slüter musste gewahr werden, der Hass seiner Gegner sei bereits so groß, dass sie selbst die Gemeinschaft mit solchen Menschen nicht verschmähten, nur um ihn aus dem Weg zu räumen.
Auch ob des Sieges über die Wegelagerer wollte sich bei ihm keine Genugtuung einstellen, das schmähliche Ende des gedungenen Mordgesellen stimmte ihn nicht froh, sondern traurig, besonders der Umstand, dass seinetwegen ein Mensch getötet worden war, schmerzte ihn tief.
Seine Begleiter, die an raue Kämpfe gewöhnt waren, kannten solche Skrupel nicht. Der kleine Zwischenfall schien ganz nach ihrem Geschmack gewesen zu sein, sie spotteten über die Feigheit der Wegelagerer und bedauerten nur, dass es nicht zu einem längeren Kampf gekommen sei, bei dem sie noch mehr gewichtige Hiebe hätten austeilen können. Es wurde beschlossen, über das Gefecht vorläufig keine Anzeige zu machen und den Erschlagenen im Holze liegen zu lassen, wo Füchse und zahlreiche Wölfe seine Vertilgung schon besorgen würden.
Slüter und seine Begleiter gelangten ohne weitere Zwischenfälle nach Bramow, wo man sogleich das Boot bestieg und trotz der Dunkelheit und strengen Kälte die Segelfahrt nach Warnemünde antrat. Im Hause des alten Fischers und Lotsen Wegner fand der Gast ein einfaches und warmes Unterkommen. Die Herzlichkeit der Aufnahme von Seiten aller Hausgenossen musste all das ersetzen, was das Quartier an Annehmlichkeiten entbehrte. Besonders Gundula war hoch erfreut, Magister Slüter im elterlichen Hause bedienen und zu seinem Wohlergehen beitragen zu können. Ein warmer Dank aus ihrem Munde belohnte auch Fritz Ohlsen für die Geschäftigkeit und Umsicht, die er bei der Begleitung des Predigers bewiesen hatte.