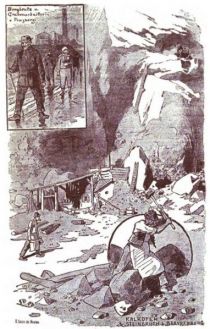Bergleute und Steinarbeiter.
An jener wunderschönen Straße, die von Reichenhall nach Berchtesgaden führt, sitzen, unweit der ersten Häuser Berchtesgadens, ein paar arme Menschen im Gras. Es ist ein alter, blinder Mann in einem verschossenen Bergmannskittel, den Schachthut auf dem Kopfe. Neben ihm kauert sein Enkelkind, ein kleines, blondhaariges Mädchen mit blassem Gesicht und großen traurigen Augen. Es ist die Führerin des alten Mannes. An der anderen Seite des Mannes steht sein Handwerkzeug: ein hoher, dunkelgrün angestrichener Kasten. Unten in diesem Kasten befindet sich eine Drehorgel; darüber zwei Türflügel. Wenn dieselben aufgeschlagen werden, sieht man in das Innere eines Miniaturbergwerks. Da sieht man oben einen Pferdegöpel, darunter einen Schacht, aus welchem an den Seiten Stollen ausmünden. Man sieht an dem Göpel kleine Pferde, in dem Schachte Tonnen an Grubenseilen, und in den Schachten kleine zollhohe Bergleute mit kleinen Wagen, mit Schlägel und Keilhaue. Sobald die Orgel gedreht wird, setzen sich die Figürchen in Bewegung; die Pferde treiben den Göpel, die Tonnen gehen auf und nieder, die Bergleute beginnen mit ihren Werkzeugen in das Gestein zu hämmern.
Ich hatte die beiden Leute schon irgendwo draußen, in einem Dorfe des Alpenvorlandes gesehen, vor ein paar Tagen. Nun setzte ich mich neben den alten Bergmann an den Straßenrand und knüpfte ein Gespräch mit ihm an.
Was ich von ihm erfragte, war wenig erfreulich. Ein Leben voll mühsamer Arbeit und gegen das Ende dieses Lebens zu die bittere Arbeit und Hilflosigkeit. Der Mann war ein geborner Berchtesgadener; seine Eltern und seine Großeltern waren Bergleute in Berchtesgaden gewesen. Ein kleines, armseliges Häuschen war sein Heim; aber dieses Häuschen stand in jener paradiesischen Berglandschaft, in der wir eben saßen. Er hätte das Heimwesen haben können. Aber für ein paar hundert Gulden hatte er sein Erbrecht verkauft und war in die Welt gezogen, das Glück zu suchen. Er hatte es nicht gefunden und war wieder heimgekehrt, um sich in dem benachbarten Schellenberg als Salinenarbeiter niederzulassen und eine Familie zu begründen. Da war er erst vollständig in Armut und Arbeitslosigkeit verkommen. Und als sein Weib gestorben und sein einziges Kind von mitleidigen Leuten angenommen war, da war er denn von neuem in die Welt hinausgezogen. Aber wo er auch gearbeitet hatte: das Glück hatte er sich nirgends erarbeitet. Er hatte in einer Grube am Rauschenberge gearbeitet, bis dieselbe als hoffnungslos aufgeben ward; dann war er tief hinein nach Österreich, in die Goldgruben von Rauris, und hatte überall bloß Not und Elend kennen gelernt. Und endlich hatte ihn das Schicksal bis nach Siebenbürgen verschlagen. Dort hatte er nach langen Jahren gemerkt, dass es mit seinem Augenlichte zu Ende ging, und war dann, vom Heimweh getrieben, den ganzen weiten Weg wieder zurückgewandert bis nach Berchtesgaden. Als er daheim angekommen war, da war er schon soweit erblindet, dass er eben noch die weiße Straße sah. Den Watzmann aber, den er so gern noch einmal gesehen hätte — den sah er nimmer. Dann kauften ihm mitleidige Menschen von seinen kleinen Ersparnissen das Spielwerk, mit welchem er umherziehen konnte, und nachdem er gänzlich erblindet war, gaben ihm seine Verwandten das Enkelkind als Wegweiser mit.
An ihrer Seite hatte er nun seit ein paar Jahren die Dörfer und Märkte im bayerischen Gebirge, im Salzkammergut und in der Schweiz durchwandert, hatte seine Orgel gedreht und seine kleinen Bergmännlein arbeiten lassen. Jetzt war es wieder Spätherbst geworden, und der alte Berginvalide wollte nochmals in seine Heimat zurück. Zum letzten Mal, wie er sagte; denn er gedachte, den Winter nicht mehr zu überleben. Und ich glaubte ihm.
Der Mann war eine Art Philosoph. Ich konnte nicht mit ihm streiten, als er sagte: „Schauen's, Herr! Das is dem Menschen sein Unglück, was unter der Erden is! Wann's unter der Erden nix geben thät, nachher könnt' man kein' Krieg führen, und arme Bergleut' thät's auch keine mehr geben!“
Hernach war er doch wieder recht froh um ein Stückchen Silber, das unter der Erde gewachsen war.
Wenn es nichts gäbe unter der Erde! Dann wäre also die Steinzeit die letzte Phase der industriellen Entwickelung des Menschen geblieben! Der industriellen Entwickelung wohl; aber nicht des ganzen Ausbaues menschlicher Gesittung. Diese hängt nicht bloß von dem ab, was unter der Erde ist.
Die bayerischen Alpen sind im ganzen arm an jenen Schätzen, welche die steinerne Erdrinde dem Menschen bietet. Der hierzuland wertvollste Teil dieser Schätze ist noch das Salz, welches zu Berchtesgaden als Steinsalz und als Sudsalz, zu Reichenhall, Traunstein und Rosenheim aber nur durch Versieden von Soole gewonnen wird. Der Volksfreund muss es entschieden als einen glücklichen Zug unserer wirtschaftlichen Entwickelung ansehen, dass gerade die Salzproduktion den Schwerpunkt des Bergbaus in den bayerischen Bergen bildet. Manches Übel, das an andre bergmännische Betriebe sich heftet, fehlt dem Salzbergbau. Schon die Arbeit der Bergleute selbst ist eine gesündere, reinlichere und minder anstrengende, als in den Gruben, wo andere unterirdische Güter gewonnen werden. Man wird in der ganzen Welt wohl umsonst einen Bergbau suchen, der an Reinlichkeit, man möchte fast sagen an Salonmäßigkeit, dem Berchtesgadener gleicht. Ein weiterer Vorzug dieses Betriebes aber liegt darin, dass der größte Teil der dazu gehörigen Arbeiten nicht unter, sondern über der Erde geschieht. Was unter der Erde zu vollbringen ist, arbeitet ja zumeist das Wasser, indem es das Salz aus dem „Haselgebirge“ für den Menschen heraussaugt. Dagegen beschäftigen die Erhaltung und der Dienst an jenen mächtigen Soolenleitungen, welche die salzhaltigen Wasser weiterführen, in den Sudhäusern und Brunnenhäusern, an Salinenwegen und dergleichen eine Menge von Arbeitskräften, welche über der Erde arbeiten dürfen, oft im grünen Walde und im hellen Sonnenschein.
So kommt's, dass alles, was an der Saline mitarbeitet, ein menschenwürdiges Dasein führt. Um so mehr, als der ganze Betrieb keine fetten Dividenden zu erzielen braucht, sondern dem bayerischen Staate gehört, der immer mit einer gewissen väterlichen Milde darauf bedacht war, die Arbeiterbevölkerung seiner Werke nicht zum verzweifelten Proletariat verkümmern zu lassen.
Neben dem Salze spielt in den Bergbauen der bayerischen Alpen die Steinkohle eine Hauptrolle. Und man muss sagen, dass auch hier, obschon es nicht so leicht war wie beim Salze, sowohl das Staatswerk bei Peissenberg, als auch die Privatwerke bei Penzberg und Miesbach alles getan haben, um die schlimmsten Schäden, die sich an den Betrieb von Kohlengruben knüpfen, fernzuhalten. Dass es ihnen gelang, mag wohl auch daran liegen, dass die oberbayerischen Kohlenfelder nicht sehr reichhaltig sind. Die paar hundert Familien von Bergleuten, welche in diesen Kohlenfeldern Beschäftigung finden, sind von einer so kraftvollen und wohlhabenden landwirtschaftlichen Bevölkerung umwohnt, dass sie gar nicht dazu kommen können, ihrer Landschaft einen stark industriellen Zug zu verleihen.
Zum Graben in den Eingeweiden der Erde hat übrigens der Altbayer keine rechte Lust. Er braucht zu viel frische Luft und überlässt daher die Arbeit in den Kohlenwerken meist zugewanderten Arbeitern: Oberpfälzern, Schlesiern, Sachsen.
Zahllos sind die Stätten in den bayerischen Bergen, wo vordem Bergbau getrieben oder wenigstens versucht ward, und wo man jetzt nichts mehr sieht, als ein düsteres Stollenmundloch oder die grünüberwachsenen Trümmer eines zerfallenen Tagbaus. Eigenartig ist der Eindruck solcher längstverlassener Arbeitsstätten, von welchen heutzutage die Umwohner kaum mehr wissen, wozu sie einst dienten. Fragt man darnach, so erfährt man mitunter, wie die Sage allmählich ihr goldnes Gewebe über diese vergessenen Felsenlöcher spinnt. So ward zu Fischbachau am Anfange des fünfzehnten Jahrhunderts Bergbau auf Eisen und Grünerde getrieben; zu Fischbach am Inn grub man dazumal auf Silber. Bei Bayerischzell ward noch im vorigen Jahrhundert Eisen verhüttet. Im Aigenthal bei Prien geht ein vergessener Stollen in den Berg, und hoch droben, zwischen den Schroffen der Kampenwand, zeigten einem vor zwanzig Jahren noch die Sennerinnen der Schlechtenberger Alm das „Goldloch“, in welchem man noch die Reste der früheren Grubenzimmerung fand. Auch im Eschelmoos ward einst auf Silber gegraben; im Staufen bei Reichenhall auf Gold, Silber und Galmei. Die Reste der alten Hüttengebäude kann man dort noch finden. (Vierthaler.) Auf der Königsbergalm, über dem Königsee, liegen verlassene Galmeigruben; der ehedem erzreiche Rauschenberg liegt verödet, und auch in der schauerlichen Wildnis des Höllenthals, unter den Steilwänden der Zugspitze, erwies die Tiefe der Berge sich als unzuverlässig und trügerisch. Wo sich in den Kalkgebirgen Erzlagerstätten finden, sind's eben keine langgestreckten Gänge, sondern regellos verstreute Nester, nur dazu angethan, um Hoffnungen zu erwecken und dann den suchenden Menschen bitter zu enttäuschen, bis er verzweifelnd den Platz verlässt, wo er Arbeit und Wohlstand an taubem Gestein vergeudete. Wenn man eine solche alte Arbeitsstätte betrachtet, über deren Trümmern jetzt das Krummholz seine knorrigen Wurzeln flicht und Alpenblumen im Winde sich wiegen: dann mag vielleicht einseitiger Industrialismus es bedauern, dass kein reicherer Segen aus den Tiefen dieser Berge zu holen war. Wir wollen darüber nicht schwere Klage führen.
Wenn auch aus den Tiefen der Berge nicht viel zu holen ist: mancherlei Arbeit gibt doch das Gestein, das zu Tage liegt. Da die ganze Kette der bayerischen Alpen aus Kalk besteht und weißes Kalkgestein das Bett jedes den Bergen entströmenden Wassers bildet, ist die Kalkbrennerei ein wichtiger Erwerbszweig, und zahlreiche kleine Kalköfen sind als charakteristische Einrichtungsstücke der Landschaft am Fuß der Alpen zu betrachten. Am bequemsten erschien ihre Anlage an den Ufern der größeren Alpenströme, wo das Material von den rastlosen Wellen bereitwillig hergerollt wird; insbesondere an der Isar, die dann auch dienstbar sein muss, um die auf Flößen verladenen gebrannten Kalksteine stromabwärts zu tragen. Das Einsammeln der Kalksteine im Strombette der oberen Isar besorgen in der Regel Weiber und Mädchen, die dabei ihre arbeitshinderlichen Gewänder in weiten, weißen Beinkleidern verbergen; und es macht einen eigenen Eindruck, auf den grellweißen Kiesbänken des Stromes diese weißen Gestalten gleich mittäglichen Gespenstern umherwandeln zu sehen, wie sie sich nach den Steinen bücken, dieselben in ihre Schiebkarren — „Radeltruhen“ heißen sie hier — werfen und dann die wohlfeile Ausbeute auf Bretterpfaden das Stromufer hinaufschleppen zu dem ebenfalls schneeweiß vom waldigen Hintergrunde sich abhebenden Kalkofen.
Anderer Art ist die Arbeit in vielen Steinbrüchen, die sich allenthalben am Rande des Gebirgs und in den Thälern finden. Zu Steinbrucharbeiten lässt sich auch der Altbayer lieber herbei, als zu dem unterirdischen Werke des Bergmanns. Denn in den Steinbruch leuchtet doch die liebe Sonne herein; und die Arbeit an sich, der Kampf mit großen und kleinen Felstrümmern, sagt dem Volkscharakter zu. Die bedeutendsten Unternehmungen der Gesteinsindustrie in den bayerischen Alpen sind die Staudacher und die Peissenberger Zementbrüche. Auf eine Entfernung von zwölf Kilometern erkennt man deutlich das mächtige Loch, welches die erstgenannten Werke in den waldigen Fuß des Hochgern gegraben haben. Wie die Steinkohle ihre ganze Landschaft schwarz färbt, so färbt, hier der Cement ockergelb; licht ockerfarbig werden Straße, Wände, Dächer und Menschen; es ist, als wäre man in eine gelbe Welt geraten.
Neben den Zementbrüchen sind aber auch zahlreiche Brüche von Bausteinen vorhanden. War schon von alters her der Untersberger und Tegernseer Marmor berühmt, so sind später auch Brüche von rotem Marmor bei Hohenschwangau und Füssen, bei Unterau, am Spitzstein, am Kammerkahr und am Haselberge bei Ruhpolding erschlossen worden; eine sehr ansehnliche Marmorindustrie arbeitet neuerdings in Kiefer. Wetzsteine und Mühlsteine werden auch stellenweise gebrochen. Die meisten dieser Werke sind so bescheidenen Umfangs, dass sie nur als industrielle Pünktchen in der großen Wald- und Felslandschaft des Gebirgs erscheinen. Die Hauptmasse des Alpengesteins ragt kahl und unfruchtbar seit Jahrtausenden, Schrofen und Wände, Karrenfelder und Schutthalden. Aber überall, wo die Natur nicht bis ins Kleinste nutzbar ist, wird sie dafür zu einer unvergänglichen und unerschöpflichen Schatzkammer, aus welcher der Mensch Lebenskraft und Lebensfreude holen kann.
Eine besondere Sorte von Steinarbeitern sind die Wegmacher. Auch im Gebiete des Straßen- und Wegebaus hat in den bayerischen Bergen die uralte Salzverwaltung eine leitende Rolle gespielt. Wo es Salz zu verfrachten gab, da gab es auch von alters her gute Straßen. Und das Gestein in unseren Kalkbergen ist dem Straßenbau günstig. Ist eine Straße einmal in gutem Stande, so genügt wenig, um die Abnutzung, die sie durch den Verkehr erleidet, auszugleichen. Weit gefährlicher als das rollende Rad ist für unsere Bergstraßen das fließende Wasser. Im Frühjahre, wenn die Tauwasser von den Höhen niederdrängen, pflegen sie die Alpenstraßen anzunagen und zu zerwaschen, sodass es für den Wegmacher immer Arbeit gibt. Das ist ein meist einschichtiger Arbeiter, den ganzen Tag auf der Landstrasse. Jeder Kutscher kennt ihn und nickt ihm zu; denn der Wegmacher ist ja der treueste und uneigennützigste Freund von Ross und Rad. Aber ebensowenig als das vorübereilende Fuhrwerk können wir uns bei dem einsamen Manne aufhalten, der mit seinem Spaten über der Schulter und seinem Messingschild auf dem Hute die Strasse entlang wandert, und sich seine Gedanken darüber macht, dass, wenn man auch den Menschen den Weg noch so schön und eben richtet, doch ab und zu ein Wagen in den Graben gerät und umgeworfen wird.
Wenn nun der gewöhnliche Wegmacher überall zu finden ist, nicht allein in den Alpen, sondern auch bei Berlin und Leipzig, so haben wir doch in den bayerischen Bergen eine besondre Spielart davon: den Almputzer. Um Pfingsten schicken die Bauern, deren Vieh auf die Almen getrieben werden soll, einen oder ein paar Burschen hinauf, dass sie die Wege und Hütten in Ordnung bringen. Almputzer heißt man diese Menschen. Sie müssen in ihrer Art technische Genies sein. Wo das wilde Bergwasser den Viehsteig zerrissen hat, müssen sie denselben wieder herstellen, indem sie an der Seite gegen den aufsteigenden Berghang zu das Erdreich abhacken und es an der anderen Seite des Weges aufschütten. Wo ein Steg zerbrach, müssen sie ihn wieder bauen; wo eine Lawine über den Weg gegangen ist und Schutt darüber geführt hat, durch den Schuttkegel Bahn schaffen. Hie und da bei besonders steilen Wegwindungen muss eine oder die andere Stufe gebaut werden; entweder aus Holz oder aus herbeigeschafften Steinen. So geht es in tagelanger Arbeit den Berg hinauf. Droben auf der Alm aber werden die Hütten nachgesehen, ob der Schnee kein Dach eingedrückt hat; die Wasserleitung, die zum Almbrunnen führt, wird geprüft; Steine, die etwa aus dem höher droben ragenden Gewand abgestürzt sind, werden, so gut es geht, weggeräumt. Es ist erstaunlich, mit wie geringen Hilfsmitteln in den Bergen ein völlig unwegsamer Berghang gangbar gemacht werden kann; wie ein paar Stücke hohler Baumrinde hinreichen, um die zwischen Moos und Gestein unsichtbar sickernden Wassertropfen aufzufangen und in einen roh gezimmerten Brunnentrog zu leiten; wie ein mit kundigem Blicke gefällter Stamm so stürzen muss, dass er von selbst zum Weggeländer wird; wie ein paar geschickt zurecht gerückte Steine aus einem wüsten Trümmerhaufen eine Treppe gestalten, für Menschen und Tiere gangbar. Alle Vorstufen und Grundformen der verwegensten Kunststücke, welche der moderne Strassen- und Wasserbautechniker ersinnen kann, finden sich an den einsamen Steigen des Hochgebirgs.
In den höchsten felsigen Einöden aber, wo die Almwirtschaft zu Ende ist, wo über pflanzenleeres Geklipp und Geröllfelder nur mehr die Steige der Jäger, Wildschützen und Schwärzer führen: dort endet auch jeder sichtbare Pfad. Dort leitet nur den durchaus bergkundigen Wanderer sein erfahrener und forschender Blick, falls nicht etwa der Alpenverein seine roten Wegmarken an die weißen Kalktrümmer hingemalt oder ein Bergführer seine „Dauben“ oder „Steinmannln“ errichtet hat. Das sind Steine, an weithin sichtbaren Punkten so hingelegt, dass der in die Geheimnisse der Bergwelt eingeweihte Wanderer sie als absichtlich hingesetzt erkennt und zu Wegweisern nimmt. Es sind die letzten und höchsten Spuren waltender Menschenhand in einsamer Wildnis.
Ich hatte die beiden Leute schon irgendwo draußen, in einem Dorfe des Alpenvorlandes gesehen, vor ein paar Tagen. Nun setzte ich mich neben den alten Bergmann an den Straßenrand und knüpfte ein Gespräch mit ihm an.
Was ich von ihm erfragte, war wenig erfreulich. Ein Leben voll mühsamer Arbeit und gegen das Ende dieses Lebens zu die bittere Arbeit und Hilflosigkeit. Der Mann war ein geborner Berchtesgadener; seine Eltern und seine Großeltern waren Bergleute in Berchtesgaden gewesen. Ein kleines, armseliges Häuschen war sein Heim; aber dieses Häuschen stand in jener paradiesischen Berglandschaft, in der wir eben saßen. Er hätte das Heimwesen haben können. Aber für ein paar hundert Gulden hatte er sein Erbrecht verkauft und war in die Welt gezogen, das Glück zu suchen. Er hatte es nicht gefunden und war wieder heimgekehrt, um sich in dem benachbarten Schellenberg als Salinenarbeiter niederzulassen und eine Familie zu begründen. Da war er erst vollständig in Armut und Arbeitslosigkeit verkommen. Und als sein Weib gestorben und sein einziges Kind von mitleidigen Leuten angenommen war, da war er denn von neuem in die Welt hinausgezogen. Aber wo er auch gearbeitet hatte: das Glück hatte er sich nirgends erarbeitet. Er hatte in einer Grube am Rauschenberge gearbeitet, bis dieselbe als hoffnungslos aufgeben ward; dann war er tief hinein nach Österreich, in die Goldgruben von Rauris, und hatte überall bloß Not und Elend kennen gelernt. Und endlich hatte ihn das Schicksal bis nach Siebenbürgen verschlagen. Dort hatte er nach langen Jahren gemerkt, dass es mit seinem Augenlichte zu Ende ging, und war dann, vom Heimweh getrieben, den ganzen weiten Weg wieder zurückgewandert bis nach Berchtesgaden. Als er daheim angekommen war, da war er schon soweit erblindet, dass er eben noch die weiße Straße sah. Den Watzmann aber, den er so gern noch einmal gesehen hätte — den sah er nimmer. Dann kauften ihm mitleidige Menschen von seinen kleinen Ersparnissen das Spielwerk, mit welchem er umherziehen konnte, und nachdem er gänzlich erblindet war, gaben ihm seine Verwandten das Enkelkind als Wegweiser mit.
An ihrer Seite hatte er nun seit ein paar Jahren die Dörfer und Märkte im bayerischen Gebirge, im Salzkammergut und in der Schweiz durchwandert, hatte seine Orgel gedreht und seine kleinen Bergmännlein arbeiten lassen. Jetzt war es wieder Spätherbst geworden, und der alte Berginvalide wollte nochmals in seine Heimat zurück. Zum letzten Mal, wie er sagte; denn er gedachte, den Winter nicht mehr zu überleben. Und ich glaubte ihm.
Der Mann war eine Art Philosoph. Ich konnte nicht mit ihm streiten, als er sagte: „Schauen's, Herr! Das is dem Menschen sein Unglück, was unter der Erden is! Wann's unter der Erden nix geben thät, nachher könnt' man kein' Krieg führen, und arme Bergleut' thät's auch keine mehr geben!“
Hernach war er doch wieder recht froh um ein Stückchen Silber, das unter der Erde gewachsen war.
Wenn es nichts gäbe unter der Erde! Dann wäre also die Steinzeit die letzte Phase der industriellen Entwickelung des Menschen geblieben! Der industriellen Entwickelung wohl; aber nicht des ganzen Ausbaues menschlicher Gesittung. Diese hängt nicht bloß von dem ab, was unter der Erde ist.
Die bayerischen Alpen sind im ganzen arm an jenen Schätzen, welche die steinerne Erdrinde dem Menschen bietet. Der hierzuland wertvollste Teil dieser Schätze ist noch das Salz, welches zu Berchtesgaden als Steinsalz und als Sudsalz, zu Reichenhall, Traunstein und Rosenheim aber nur durch Versieden von Soole gewonnen wird. Der Volksfreund muss es entschieden als einen glücklichen Zug unserer wirtschaftlichen Entwickelung ansehen, dass gerade die Salzproduktion den Schwerpunkt des Bergbaus in den bayerischen Bergen bildet. Manches Übel, das an andre bergmännische Betriebe sich heftet, fehlt dem Salzbergbau. Schon die Arbeit der Bergleute selbst ist eine gesündere, reinlichere und minder anstrengende, als in den Gruben, wo andere unterirdische Güter gewonnen werden. Man wird in der ganzen Welt wohl umsonst einen Bergbau suchen, der an Reinlichkeit, man möchte fast sagen an Salonmäßigkeit, dem Berchtesgadener gleicht. Ein weiterer Vorzug dieses Betriebes aber liegt darin, dass der größte Teil der dazu gehörigen Arbeiten nicht unter, sondern über der Erde geschieht. Was unter der Erde zu vollbringen ist, arbeitet ja zumeist das Wasser, indem es das Salz aus dem „Haselgebirge“ für den Menschen heraussaugt. Dagegen beschäftigen die Erhaltung und der Dienst an jenen mächtigen Soolenleitungen, welche die salzhaltigen Wasser weiterführen, in den Sudhäusern und Brunnenhäusern, an Salinenwegen und dergleichen eine Menge von Arbeitskräften, welche über der Erde arbeiten dürfen, oft im grünen Walde und im hellen Sonnenschein.
So kommt's, dass alles, was an der Saline mitarbeitet, ein menschenwürdiges Dasein führt. Um so mehr, als der ganze Betrieb keine fetten Dividenden zu erzielen braucht, sondern dem bayerischen Staate gehört, der immer mit einer gewissen väterlichen Milde darauf bedacht war, die Arbeiterbevölkerung seiner Werke nicht zum verzweifelten Proletariat verkümmern zu lassen.
Neben dem Salze spielt in den Bergbauen der bayerischen Alpen die Steinkohle eine Hauptrolle. Und man muss sagen, dass auch hier, obschon es nicht so leicht war wie beim Salze, sowohl das Staatswerk bei Peissenberg, als auch die Privatwerke bei Penzberg und Miesbach alles getan haben, um die schlimmsten Schäden, die sich an den Betrieb von Kohlengruben knüpfen, fernzuhalten. Dass es ihnen gelang, mag wohl auch daran liegen, dass die oberbayerischen Kohlenfelder nicht sehr reichhaltig sind. Die paar hundert Familien von Bergleuten, welche in diesen Kohlenfeldern Beschäftigung finden, sind von einer so kraftvollen und wohlhabenden landwirtschaftlichen Bevölkerung umwohnt, dass sie gar nicht dazu kommen können, ihrer Landschaft einen stark industriellen Zug zu verleihen.
Zum Graben in den Eingeweiden der Erde hat übrigens der Altbayer keine rechte Lust. Er braucht zu viel frische Luft und überlässt daher die Arbeit in den Kohlenwerken meist zugewanderten Arbeitern: Oberpfälzern, Schlesiern, Sachsen.
Zahllos sind die Stätten in den bayerischen Bergen, wo vordem Bergbau getrieben oder wenigstens versucht ward, und wo man jetzt nichts mehr sieht, als ein düsteres Stollenmundloch oder die grünüberwachsenen Trümmer eines zerfallenen Tagbaus. Eigenartig ist der Eindruck solcher längstverlassener Arbeitsstätten, von welchen heutzutage die Umwohner kaum mehr wissen, wozu sie einst dienten. Fragt man darnach, so erfährt man mitunter, wie die Sage allmählich ihr goldnes Gewebe über diese vergessenen Felsenlöcher spinnt. So ward zu Fischbachau am Anfange des fünfzehnten Jahrhunderts Bergbau auf Eisen und Grünerde getrieben; zu Fischbach am Inn grub man dazumal auf Silber. Bei Bayerischzell ward noch im vorigen Jahrhundert Eisen verhüttet. Im Aigenthal bei Prien geht ein vergessener Stollen in den Berg, und hoch droben, zwischen den Schroffen der Kampenwand, zeigten einem vor zwanzig Jahren noch die Sennerinnen der Schlechtenberger Alm das „Goldloch“, in welchem man noch die Reste der früheren Grubenzimmerung fand. Auch im Eschelmoos ward einst auf Silber gegraben; im Staufen bei Reichenhall auf Gold, Silber und Galmei. Die Reste der alten Hüttengebäude kann man dort noch finden. (Vierthaler.) Auf der Königsbergalm, über dem Königsee, liegen verlassene Galmeigruben; der ehedem erzreiche Rauschenberg liegt verödet, und auch in der schauerlichen Wildnis des Höllenthals, unter den Steilwänden der Zugspitze, erwies die Tiefe der Berge sich als unzuverlässig und trügerisch. Wo sich in den Kalkgebirgen Erzlagerstätten finden, sind's eben keine langgestreckten Gänge, sondern regellos verstreute Nester, nur dazu angethan, um Hoffnungen zu erwecken und dann den suchenden Menschen bitter zu enttäuschen, bis er verzweifelnd den Platz verlässt, wo er Arbeit und Wohlstand an taubem Gestein vergeudete. Wenn man eine solche alte Arbeitsstätte betrachtet, über deren Trümmern jetzt das Krummholz seine knorrigen Wurzeln flicht und Alpenblumen im Winde sich wiegen: dann mag vielleicht einseitiger Industrialismus es bedauern, dass kein reicherer Segen aus den Tiefen dieser Berge zu holen war. Wir wollen darüber nicht schwere Klage führen.
Wenn auch aus den Tiefen der Berge nicht viel zu holen ist: mancherlei Arbeit gibt doch das Gestein, das zu Tage liegt. Da die ganze Kette der bayerischen Alpen aus Kalk besteht und weißes Kalkgestein das Bett jedes den Bergen entströmenden Wassers bildet, ist die Kalkbrennerei ein wichtiger Erwerbszweig, und zahlreiche kleine Kalköfen sind als charakteristische Einrichtungsstücke der Landschaft am Fuß der Alpen zu betrachten. Am bequemsten erschien ihre Anlage an den Ufern der größeren Alpenströme, wo das Material von den rastlosen Wellen bereitwillig hergerollt wird; insbesondere an der Isar, die dann auch dienstbar sein muss, um die auf Flößen verladenen gebrannten Kalksteine stromabwärts zu tragen. Das Einsammeln der Kalksteine im Strombette der oberen Isar besorgen in der Regel Weiber und Mädchen, die dabei ihre arbeitshinderlichen Gewänder in weiten, weißen Beinkleidern verbergen; und es macht einen eigenen Eindruck, auf den grellweißen Kiesbänken des Stromes diese weißen Gestalten gleich mittäglichen Gespenstern umherwandeln zu sehen, wie sie sich nach den Steinen bücken, dieselben in ihre Schiebkarren — „Radeltruhen“ heißen sie hier — werfen und dann die wohlfeile Ausbeute auf Bretterpfaden das Stromufer hinaufschleppen zu dem ebenfalls schneeweiß vom waldigen Hintergrunde sich abhebenden Kalkofen.
Anderer Art ist die Arbeit in vielen Steinbrüchen, die sich allenthalben am Rande des Gebirgs und in den Thälern finden. Zu Steinbrucharbeiten lässt sich auch der Altbayer lieber herbei, als zu dem unterirdischen Werke des Bergmanns. Denn in den Steinbruch leuchtet doch die liebe Sonne herein; und die Arbeit an sich, der Kampf mit großen und kleinen Felstrümmern, sagt dem Volkscharakter zu. Die bedeutendsten Unternehmungen der Gesteinsindustrie in den bayerischen Alpen sind die Staudacher und die Peissenberger Zementbrüche. Auf eine Entfernung von zwölf Kilometern erkennt man deutlich das mächtige Loch, welches die erstgenannten Werke in den waldigen Fuß des Hochgern gegraben haben. Wie die Steinkohle ihre ganze Landschaft schwarz färbt, so färbt, hier der Cement ockergelb; licht ockerfarbig werden Straße, Wände, Dächer und Menschen; es ist, als wäre man in eine gelbe Welt geraten.
Neben den Zementbrüchen sind aber auch zahlreiche Brüche von Bausteinen vorhanden. War schon von alters her der Untersberger und Tegernseer Marmor berühmt, so sind später auch Brüche von rotem Marmor bei Hohenschwangau und Füssen, bei Unterau, am Spitzstein, am Kammerkahr und am Haselberge bei Ruhpolding erschlossen worden; eine sehr ansehnliche Marmorindustrie arbeitet neuerdings in Kiefer. Wetzsteine und Mühlsteine werden auch stellenweise gebrochen. Die meisten dieser Werke sind so bescheidenen Umfangs, dass sie nur als industrielle Pünktchen in der großen Wald- und Felslandschaft des Gebirgs erscheinen. Die Hauptmasse des Alpengesteins ragt kahl und unfruchtbar seit Jahrtausenden, Schrofen und Wände, Karrenfelder und Schutthalden. Aber überall, wo die Natur nicht bis ins Kleinste nutzbar ist, wird sie dafür zu einer unvergänglichen und unerschöpflichen Schatzkammer, aus welcher der Mensch Lebenskraft und Lebensfreude holen kann.
Eine besondere Sorte von Steinarbeitern sind die Wegmacher. Auch im Gebiete des Straßen- und Wegebaus hat in den bayerischen Bergen die uralte Salzverwaltung eine leitende Rolle gespielt. Wo es Salz zu verfrachten gab, da gab es auch von alters her gute Straßen. Und das Gestein in unseren Kalkbergen ist dem Straßenbau günstig. Ist eine Straße einmal in gutem Stande, so genügt wenig, um die Abnutzung, die sie durch den Verkehr erleidet, auszugleichen. Weit gefährlicher als das rollende Rad ist für unsere Bergstraßen das fließende Wasser. Im Frühjahre, wenn die Tauwasser von den Höhen niederdrängen, pflegen sie die Alpenstraßen anzunagen und zu zerwaschen, sodass es für den Wegmacher immer Arbeit gibt. Das ist ein meist einschichtiger Arbeiter, den ganzen Tag auf der Landstrasse. Jeder Kutscher kennt ihn und nickt ihm zu; denn der Wegmacher ist ja der treueste und uneigennützigste Freund von Ross und Rad. Aber ebensowenig als das vorübereilende Fuhrwerk können wir uns bei dem einsamen Manne aufhalten, der mit seinem Spaten über der Schulter und seinem Messingschild auf dem Hute die Strasse entlang wandert, und sich seine Gedanken darüber macht, dass, wenn man auch den Menschen den Weg noch so schön und eben richtet, doch ab und zu ein Wagen in den Graben gerät und umgeworfen wird.
Wenn nun der gewöhnliche Wegmacher überall zu finden ist, nicht allein in den Alpen, sondern auch bei Berlin und Leipzig, so haben wir doch in den bayerischen Bergen eine besondre Spielart davon: den Almputzer. Um Pfingsten schicken die Bauern, deren Vieh auf die Almen getrieben werden soll, einen oder ein paar Burschen hinauf, dass sie die Wege und Hütten in Ordnung bringen. Almputzer heißt man diese Menschen. Sie müssen in ihrer Art technische Genies sein. Wo das wilde Bergwasser den Viehsteig zerrissen hat, müssen sie denselben wieder herstellen, indem sie an der Seite gegen den aufsteigenden Berghang zu das Erdreich abhacken und es an der anderen Seite des Weges aufschütten. Wo ein Steg zerbrach, müssen sie ihn wieder bauen; wo eine Lawine über den Weg gegangen ist und Schutt darüber geführt hat, durch den Schuttkegel Bahn schaffen. Hie und da bei besonders steilen Wegwindungen muss eine oder die andere Stufe gebaut werden; entweder aus Holz oder aus herbeigeschafften Steinen. So geht es in tagelanger Arbeit den Berg hinauf. Droben auf der Alm aber werden die Hütten nachgesehen, ob der Schnee kein Dach eingedrückt hat; die Wasserleitung, die zum Almbrunnen führt, wird geprüft; Steine, die etwa aus dem höher droben ragenden Gewand abgestürzt sind, werden, so gut es geht, weggeräumt. Es ist erstaunlich, mit wie geringen Hilfsmitteln in den Bergen ein völlig unwegsamer Berghang gangbar gemacht werden kann; wie ein paar Stücke hohler Baumrinde hinreichen, um die zwischen Moos und Gestein unsichtbar sickernden Wassertropfen aufzufangen und in einen roh gezimmerten Brunnentrog zu leiten; wie ein mit kundigem Blicke gefällter Stamm so stürzen muss, dass er von selbst zum Weggeländer wird; wie ein paar geschickt zurecht gerückte Steine aus einem wüsten Trümmerhaufen eine Treppe gestalten, für Menschen und Tiere gangbar. Alle Vorstufen und Grundformen der verwegensten Kunststücke, welche der moderne Strassen- und Wasserbautechniker ersinnen kann, finden sich an den einsamen Steigen des Hochgebirgs.
In den höchsten felsigen Einöden aber, wo die Almwirtschaft zu Ende ist, wo über pflanzenleeres Geklipp und Geröllfelder nur mehr die Steige der Jäger, Wildschützen und Schwärzer führen: dort endet auch jeder sichtbare Pfad. Dort leitet nur den durchaus bergkundigen Wanderer sein erfahrener und forschender Blick, falls nicht etwa der Alpenverein seine roten Wegmarken an die weißen Kalktrümmer hingemalt oder ein Bergführer seine „Dauben“ oder „Steinmannln“ errichtet hat. Das sind Steine, an weithin sichtbaren Punkten so hingelegt, dass der in die Geheimnisse der Bergwelt eingeweihte Wanderer sie als absichtlich hingesetzt erkennt und zu Wegweisern nimmt. Es sind die letzten und höchsten Spuren waltender Menschenhand in einsamer Wildnis.
Dieses Kapitel ist Teil des Buches Arbeitergestalten aus den Bayerischen Alpen